Die Botschaft des Osterfestes vom neuen Leben reicht in die Gegenwart: Das schon halbtot gesagte Christentum erlebt eine unerwartete Blüte. In manchen Ländern in der Kirche, in Deutschland auch außerhalb. Die Gründe sollte man begreifen – aber auch das Phänomen selbst
Als Jesus am dritten Tag das Grab verlässt, kann Thomas die Auferstehung nicht glauben. Er sieht den lebendigen Jesus, aber das genügt ihm nicht. Also fordert Jesus Thomas seinen Jünger auf, den Finger in die Wunde zu legen, dorthin, wo ihn, den Hingerichteten, am Karfreitag die Lanze eines römischen Soldaten verletzt hatte.
Bei dem Gedankengang und dem Gefühl des Gefolgsmanns handelt es sich um echten Zweifel. Thomas möchte sich überzeugen, ihm liegt alles daran, in einer so wichtigen Angelegenheit nicht in die Irre zu gehen. Nach Paul Tillich ist „Zweifel nicht das Gegenteil, sondern ein Element des Glaubens.“ Warum möchte Thomas – der nicht gesehen hatte, wie Jesus das Grab verlässt – unbedingt wissen, ob ihn vielleicht nicht nur eine Illusion heimsucht, wenn er den Gekreuzigten als Lebenden sieht? Weil sich in der Auferstehung vom Tod das Unwahrscheinliche vollzieht, das Gegenläufige zum üblichen Gang der Welt. Selbst für einen Jünger, der in der Überzeugung lebt, dass Jesus Gottes Sohn ist, kommt die Erfahrung des neu gewonnenen Lebens so plötzlich und grunderschütternd, dass er das Wunder mit der Hand fühlen will. Denn er sieht ja kein irgendwie fortgesetztes Leben. Jesus starb wirklich am Kreuz, und zwar unter den gleichen Qualen und im gleichen Elend wie jeder auf diese Weise hingerichtete Mensch. Bekanntlich ist er ganz Gott und zugleich ganz Mensch, das Göttliche mildert aber seine Schmerzen nicht. Warum hätte er sonst in der neunten Stunde gerufen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ In seiner Passionsgeschichte gibt es keinen Determinismus, der ihn und seine Jünger schon von vornherein mit der Gewissheit ausstatten würde, dass alles gut ausgeht. Der Tod ist das Geläufige, seine Überwindung die Sensation. Ebendeshalb behilft sich Thomas, indem er das, was er sieht, auch fassen und tasten will. Jesus wendet nichts gegen dieses Begreifenwollen ein. Er lädt ihn ein, selbst zu prüfen.Mit Weihnachten verbindet sich das Wort Hoffnung, mit Ostern die Vorstellung des neuen Lebens, der Wendung, wirklich geschehen, aber nicht schon vorher abgesichert durch eine Garantie. Womit wir von der biblischen Geschichte zur Gegenwart übergehen, in der sich gerade eine Wende besichtigen lässt, die noch vor einem Jahrzehnt die wenigsten für wahrscheinlich gehalten hätten. In Frankreich erlebten die Priester zu Aschermittwoch einen Ansturm vor allem junger Gottesdienstbesucher, der alle Zahlen der vergangenen Jahrzehnte übertraf. Im vergangenen Jahr ließen sich fast doppelt so viele Elf- bis Siebzehnjährige taufen wie 2023. Mehr als ein Drittel aller Taufen in Frankreich entfallen auf junge Erwachsene zwischen achtzehn und fünfundzwanzig. In dieser Altersgruppe nahmen die Kircheneintritte in den vergangenen fünf Jahren um einhundertfünfzig Prozent zu. Geistliche stehen nicht nur vor vollbesetzten Bänken, sie schauen – ein ungewohnter Anblick – seit kurzem auch in junge Gesichter. Viele von denen, die sich im Nachbarland taufen lassen, stammen aus atheistischen Familien, zumindest aus einem Elternhaus, dessen Kontakt zur Amtskirche irgendwann abgerissen war. Diese Bewegung führt nicht zu einer Rekatholisierung Frankreichs. In vielen städtischen Gebieten gibt es längst zumindest in den jüngeren Generationen eine islamische Mehrheit. Auf der anderen Seite lassen sich Jahrzehnte der Entkirchlichung selbst durch große Eintrittswellen nicht wieder ausgleichen. Jenseits des Rheins findet keine christliche Reconquista statt, sondern die Vorbereitung auf eine bewusst eingenommene Minderheitsposition.
Für Deutschland gibt es nur vage Zahlen zu dem Stärkeverhältnis der Glaubensbekenntnisse untereinander, da für das islamische nur Schätzungen existieren. In Österreich sieht das etwas anders aus. Die Stadt Wien erhebt das religiöse Bekenntnis beispielsweise an den Volks- und Mittelschulen der Stadt. Dort bekennen sich aktuell 41,2 Prozent der Schüler zum Islam, 34,5 Prozent zum Christentum, 23 Prozent geben an, keinem Bekenntnis zu folgen. In den Schulen – auch in Deutschland – lässt sich ablesen, wohin sich die Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten entwickelt. Die Ausbreitung des Islam, der muslimische Machtanspruch – beides wirkt zurück. Der Druck, den der Islam im Westen ausübt, erzeugt eine gegenläufige Bewegung, ein Bedürfnis, das Eigene zu definieren, zumindest aber erst einmal nach dem Eigenen zu fragen.
Der britische Autor Douglas Murray zitierte kürzlich aus einem Text, in dem der Erzähler beschreibt, wie er als Kind lange glaubte, bei Vanilleeis handle es sich um eine neutrale Sorte, gewissermaßen die Grundlage für alle anderen Geschmacksrichtungen von Erdbeere bis Nougat, bis er verstand, dass er auch ein spezielles und sogar sehr komplexes Aroma kostet, wenn er Vanilleeis isst. So ähnlich, meint Murray, sei es auch lange mit dem Selbstbewusstsein im Westen gewesen: „Uns ist eingeredet worden, dass wir selbst eigentlich kein Aroma besitzen und Geschmack und Farben etwas sind, das uns andere erst von außen bringen müssen.“ Nach dieser Logik kann das, was von dort in den Westen eindringt, gar nichts verdrängen – weil es nichts zu verdrängen gibt, jedenfalls nichts von Wert. Jetzt geschieht etwas Ähnliches wie mit dem Kind in dem von Murray zitierten Text: Vor allem Jüngere stellen fest, dass durchaus ein eigenes westliches Aroma existiert, zu dem untrennbar auch das Christentum gehört. Seine kulturelle Ausstrahlung nehmen sie vielleicht noch in ihrer Familiengeschichte wahr, in Traditionen, aber sie finden sie auch in ihrer weltlichen Umgebung, und zwar auch dort, wo die meisten sie auf den ersten Blick gar nicht vermuten. Die fragende Skepsis, ohne die es nie den Aufstieg der Wissenschaften im Westen gegeben hätte, wurzelt genauso im Christentum wie die Dialektik, die wir schon in der Formel finden, Jesus sei ganz Gott und ganz Mensch gewesen. Seine Aufforderung zur Nachfolge richtet sich an den Einzelnen, nicht an ein Kollektiv. Auch die Idee des selbstverantwortlichen Individuums findet sich in dieser Gestalt schon im Neuen Testament, nicht erst in den frühen Verfassungen des 18. Jahrhunderts. Das christliche Erbe liegt nicht unter einer Schuttschicht begraben, sondern immer noch sehr offen für alle, die sich dafür interessieren.
In Deutschland tun die Amtskirchen wenig dafür, Menschen außerhalb der Kirche zu dieser Aneignung zu ermutigen. Sie ermuntert noch nicht einmal diejenigen, die noch regelmäßig zu ihr kommen. In seiner Osterpredigt sprach der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing lang und breit davon, wie „demokratische Strukturen autoritär umgebaut“ und „die Freiheit der Medien attackiert“ würden – in den USA, wohlgemerkt. Auch die Zollpolitik ließ er nicht unkommentiert. Wer so etwas hören will, ob nun am Ostersonntag oder an allen anderen Tagen des Jahres, kann genauso gut die Tagesthemen einschalten.
Dass die Spitzen der deutschen Amtskirchen regelrecht eine Verlegenheit vor dem Eigenen und Eigentlichen zelebrieren, bedeutet aber nicht, dass es diese Suchbewegung in Deutschland nicht gäbe. Sie findet nur woanders statt. Zu den von Johannes Hartl organisierten Glaubensfesten kommen regelmäßig mehr als zehntausend Menschen zusammen. Hartl, selbst Katholik, betreibt seit einigen Jahren ein ökumenisches Gebetshaus in Augsburg. Nach seinen Schätzungen stammt etwa ein Fünftel von denjenigen, die das Haus besuchen, aus einer völlig atheistischen Umgebung. Mit dem bloßen Bedürfnis nach Spiritualität lässt sich diese Erscheinung nicht angemessen beschreiben.
Spiritualität ließe sich auch im Sufismus oder Buddhismus finden. Es geht denen, die aus einer kirchenfernen Zone aufbrechen, um woanders anzukommen, eben auch um die Frage nach der Kultur, zu der sie immer noch gehören. In der VI. Kirchenmitgliedsuntersuchung von 2023, für die Soziologen – nicht Theologen – Angehörige evangelischer und katholischer Gemeinden befragten, lautete ein Kernsatz: „Die Lösung institutioneller Bindungen zur Kirche und der Verlust des traditionellen Gottesglaubens gehen Hand in Hand.“
Allerdings schnitten die Verantwortlichen ihre Fragen von vornherein so zu, dass „traditioneller Glaube“ und Kirchenmitgliedschaft in eins fallen. Wieder einmal kommen Soziologen gerade noch rechtzeitig, um das Ende einer Entwicklung zu beurkunden. Dafür, wie und wo es danach weitergeht, fühlen sie sich offenbar nicht so recht zuständig. Funktionäre wie Bätzing übrigens auch nicht.
Niemand sollte dieses neue Interesse an Glauben und Zugehörigkeitsgefühl als fest gebuchte Entwicklung betrachten, die man sowieso schon habe kommen sehen. Dialektik lässt sich nicht vorausberechnen. Wenn junge Leute aus völlig kirchenfernen Elternhäusern nach dem Christentum fragen, ohne dass Medien und Parteien ihnen diese Suche nahelegen, dann geschieht das Gegenläufige, das Sensationelle, das man erst einmal vorsichtig betasten möchte, um sich nicht zu irren.
Paul Tillich definierte das Religiöse einmal als das, „was den Menschen unbedingt angeht“. Unbedingt, das heißt eben: losgelöst von allen bekannten Bedingungen.
Publico wünscht allen Lesern ein frohes Osterfest.
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.

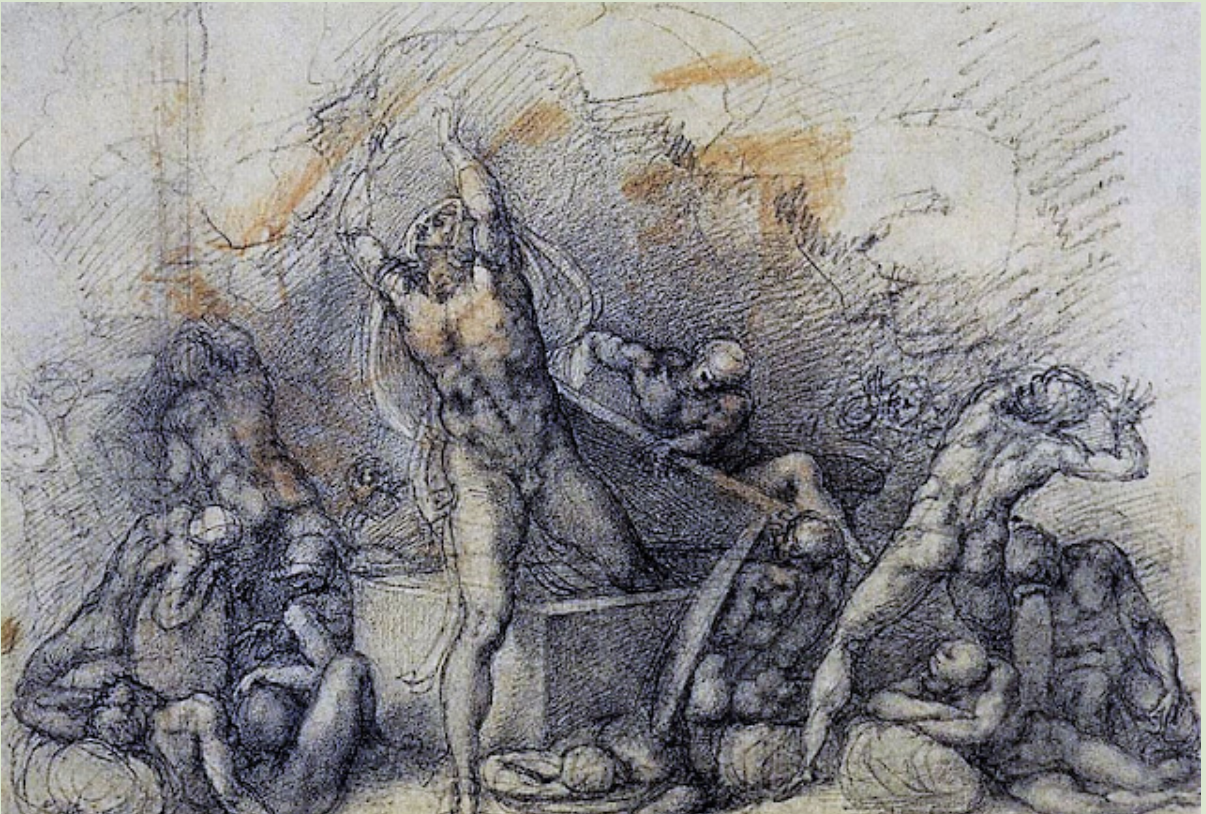


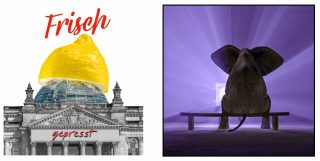

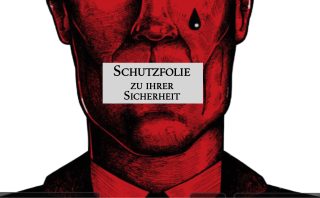



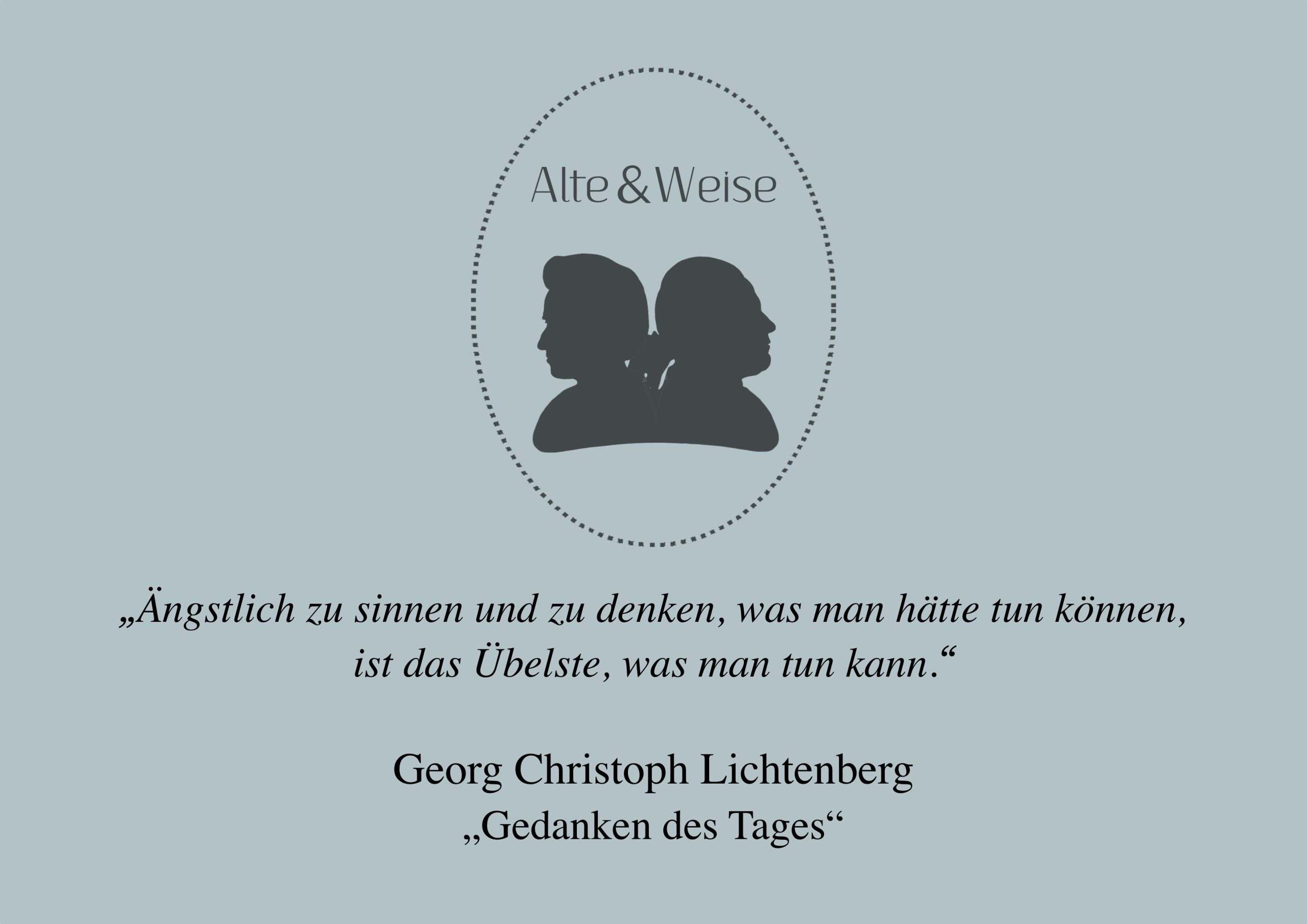

Christoph Nielen
20.04.2025Lieber Herr Wendt,
tatsächlich auch wir haben uns gewundert; Gründonnerstag, sogar In der Karfreitagsliturgie und erst recht in der Osternacht aben sehr viele junge Leute, Mädchen wie Jungen, mitgefeiert. Wir „alten Hasen“ haben uns angeschaut und gedacht : was ist passiert??
Bin gespannt.
Gerhard Lenz
20.04.2025Diese behutsame Beschreibung einer möglichen Trendwende zum Christentum in Europa war für mich die Osterüberraschung 2025. Die zentrale Glaubensfrage, ob Jesus Christus nach seiner Kreuzigung wieder auferstanden ist, wird auch künftige Generationen beschäftigen. Beantworten kann sie nur jeder Einzelne für sich selbst.
Von den deutschen Amtskirchen in ihrer „Verlegenheit vor dem Eigenen und Eigentlichen“ erwarte ich dabei wenig Ermutigung. Ob das so bleiben wird ist ebenso offen wie die Frage nach dem künftigen Miteinander konkurrierender Glaubensüberzeugungen.
Alexander Wendt macht deutlich, dass sich für die Jünger Jesu in der Auferstehung vom Tod etwas Unwahrscheinliches vollzieht, „das Gegenläufige zum üblichen Gang der Welt“. Für Jeden, der daran glaubt, hat sich daran nichts geändert. Kaum Vorstellbares bleibt weiterhin möglich – auch unerwartete Signale aus der Medienwelt wie dieser Text in Publico.
Oskar Krempl
21.04.2025Sehr geehrter Herr Wendt,
ich interpretiere es eher mit der menschlichen Sinnfrage. Da kommt es zur Rückbesinnung auf bekannte Traditionen. Da ist nun mal hier in Europa das Christentum vorhanden, welches alles was vor ihm existierte mit Stumpf und Stiel ausgerottet hat, inkluisve Aneignung mancher Feiertage.
Nein das Glaubenskonstrukt hat nichts mit selbstverantwortlichen Individuen zu tun, denn der christliche Glauben verlangt Unterwerfung unter Gott, ansonsten gibt es ewige Verdammnis.
Es ist die Verfassung, welches mir Bürgerrechte gab und leider eingeschränkt noch immer gibt und nicht die Religion.
Tortzdem Frohe Ostern.
Leonore
28.04.2025@Oskar Krempl
Da scheint Ihnen aber einiges durcheinandergeraten zu sein!
„Unterwerfung“, meinen Sie, würde der christliche Glaube fordern – ?
Verwechseln Sie da nicht was? „Islam“ heißt „Unterwerfung“ – fordert sie also bereits im Namen.
Der christliche Glaube verkündet die Frohe Botschaft, daß Gott sich des Sünders erbarmt (im Gegensatz dazu Allah im Koran: „…und habt kein Mitleid mit den Übertretern…“) , ihre Schuld von Anbeginn der Zeiten und bis zum Jüngsten Gericht freiwillig und aus Liebe auf sich nimmt, die Strafe für die unfaßbare Menge an Schuld, an Verrat und Intrige, an Egoismus, Sadismus und was nicht allem erleidet, um uns zu erlösen und aus dem Kreislauf des Bösen zur Liebe zu Gott und dem Nächsten zu befreien.
Jesus Christus hat die Frage nach dem größten und wichtigsten Gebot wie folgt beantwortet: „Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen und mit all deiner Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst!“
Und er hat hinzugesetzt, daß darin alle Gebote stecken – denn wer seinen Nächsten liebt, der wird ihn weder bestehlen noch ermorden, noch Lügen über ihn verbreiten.
Der christliche Gott ist der einzige auf der Welt, der nicht zuerst Gehorsam fordert, sondern liebt und geliebt werden möchte.
Stephan Fleischhauer
22.04.2025Man findet das seit längerem im rechten Vorfeld. Dort wird auch von manchen Atheisten eine Art Rechristianisierung Deutschlands befürwortet.
Mir erscheint das logisch. Meines Erachtens waren Religionen immer schon hochpolitisch und der Niedergang der (nichtmuslimischen) Religionen eine Folge der Befriedung der westlichen Zivilisationen. Religion, die nicht als bloße Spiritualität verstanden wird, ist nichts anderes als Tribalismus, ist der Gegensatz zu Liberalismus und Rechtsstaatlichkeit.
Wenn junge Leute heute zum Christentum zurück wollen, ist das wohl eine Art Selbstverteidigung.
Leonore
28.04.2025Der kleine Fehler gleich im 2. Satz sei Ihnen verziehen. Thomas zweifelt nicht, obwohl er den Auferstandenen sieht“, sondern weil er nicht dabei war, als Jesus den Jüngern erschienen ist.
Wie so vielen anderen seitdem ist es auch ihm nicht ohne weiteres möglich gewesen zu glauben, daß der, den er eines so grausam-gründlichen Todes hat sterben sehen, auferstanden ist und lebt.
Es lohnt sich, das entsprechende Kapitel in der Bibel zu lesen, das uns im Duktus einer knappen und nüchternen Berichterstattung informiert:
„Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.
Thomas, der Dídymus – Zwilling – genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Wundmale der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Wundmale der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas:
Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände!
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!
Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.“
(Joh 20,19–31)