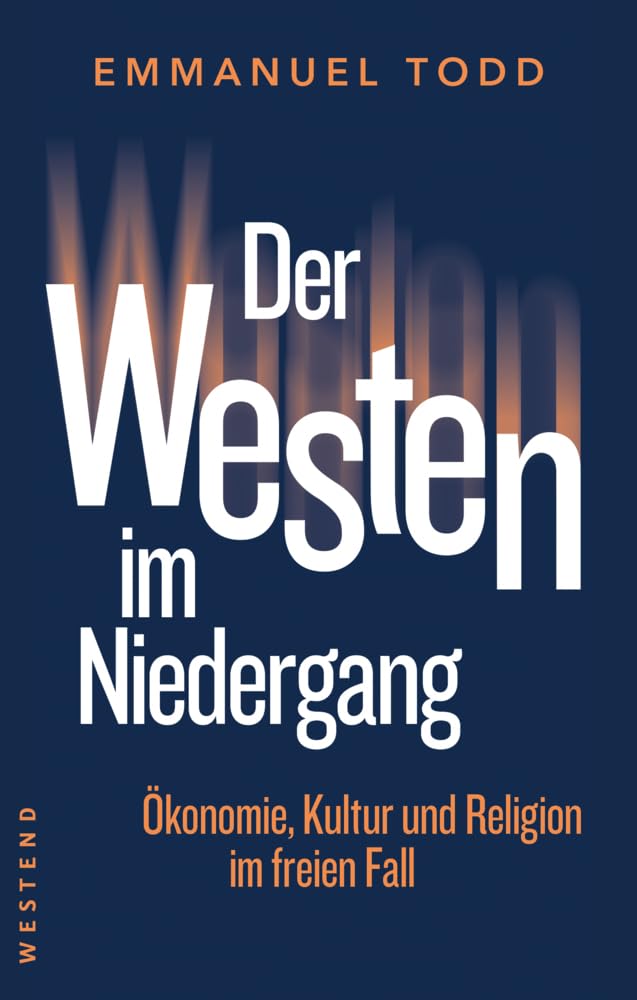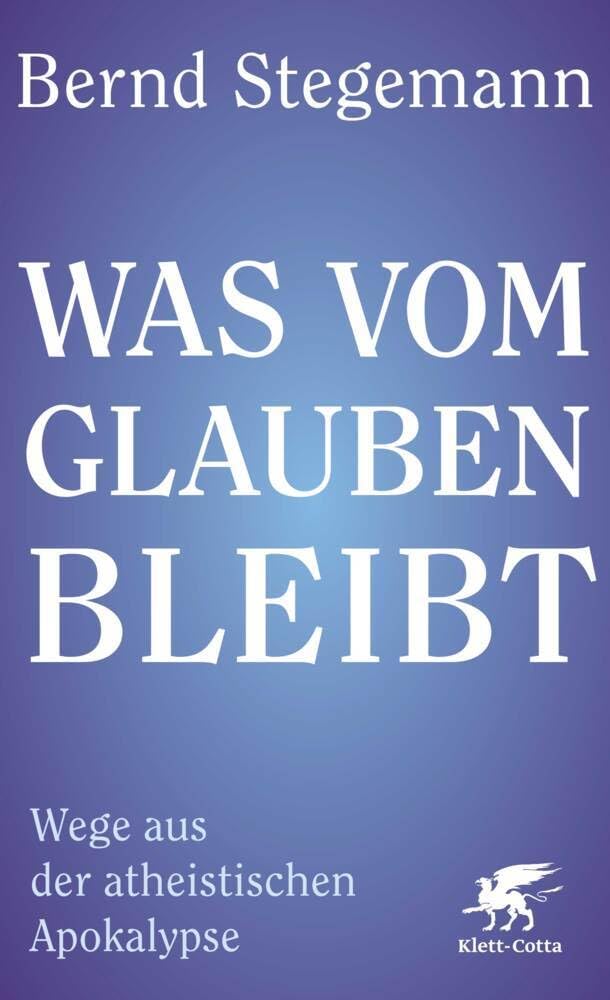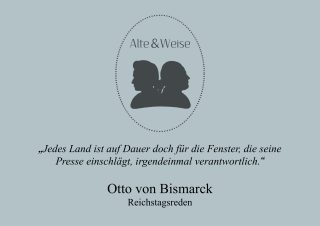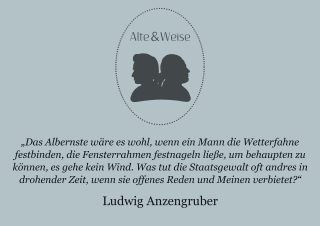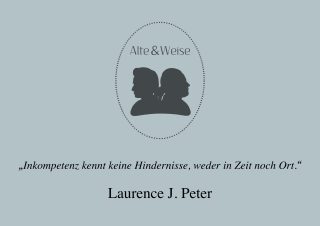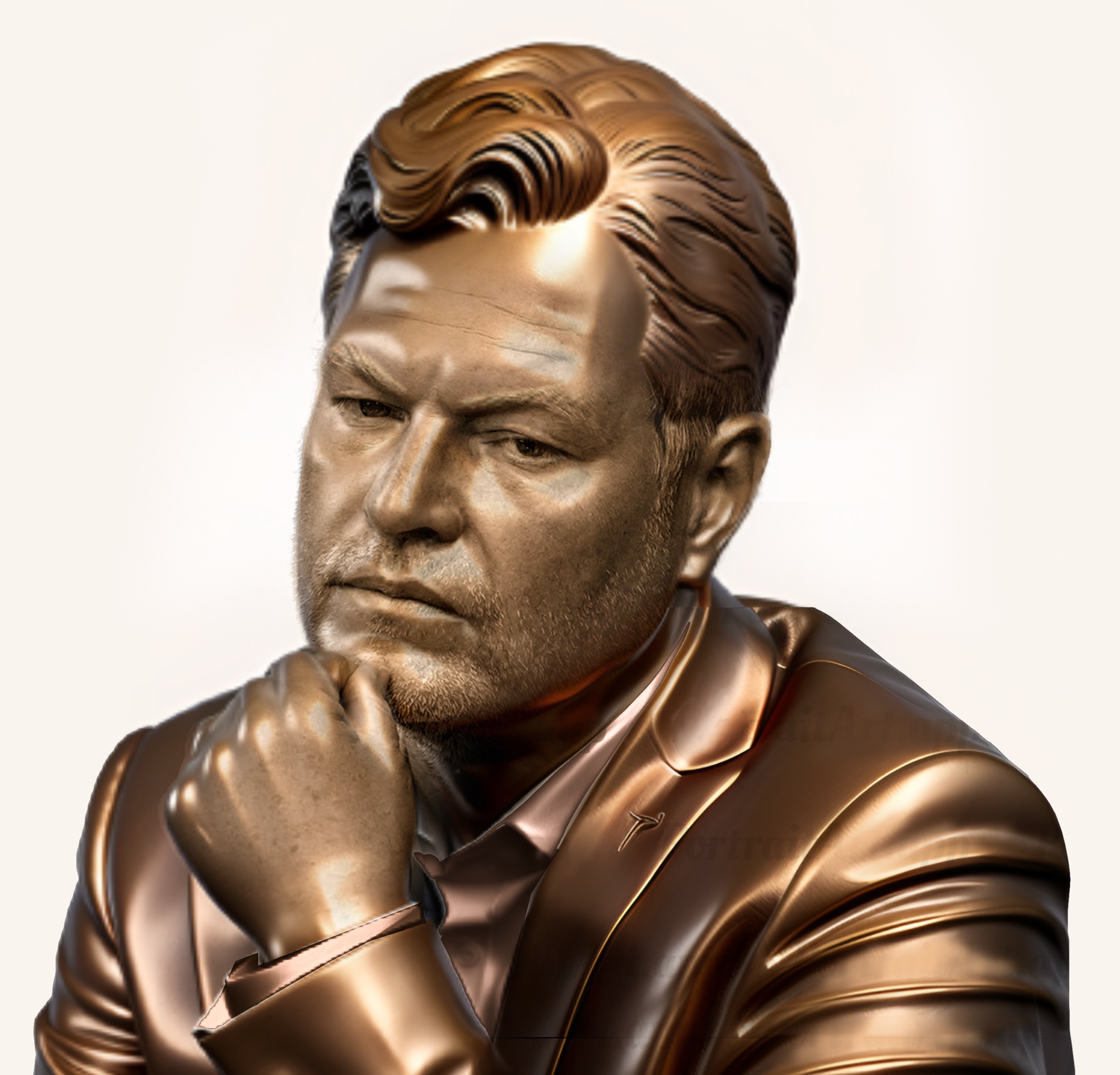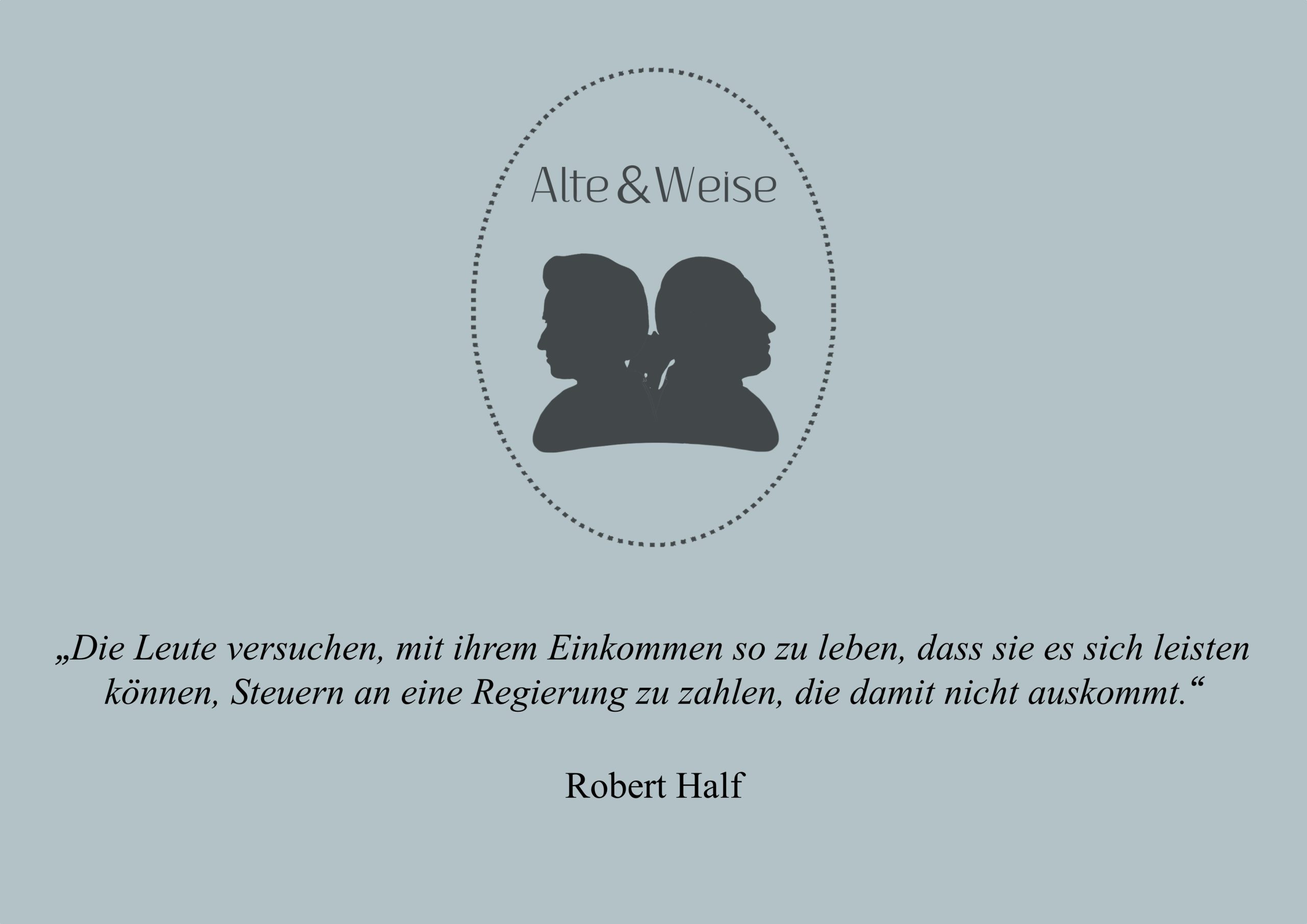Beate Broßmann fällt ein durchwachsenes Urteil über Emmanuel Todds großen Abgesang, Jürgen Schmid kann sich für Bernd Stegemanns Abhandlung über Religion nicht erwärmen.
Nihilismus hier, Nihilismus da, der Weltdeuter in der Mitten
Emmanuel Todd sieht den Westen im Niedergang. Sein Bild malt er allerdings mit einem sehr breiten Pinsel: Es bietet interessante Stellen, aber auch viele verwischte Konturen
von Beate Broßmann
Emmanuel Todd hat sich eine historisch-anthropologische Analyse der globalen Gegenwart und unserer geopolitischen Situation vorgenommen. Aus der Sicht der Rezensentin ist es allerdings nur eine soziologisch-sozialpsychologische Darstellung der Lage geworden. Was nicht wenig gewesen wäre, könnte sie als geglückt gelten.
Die Lektüre von „Der Westen im Niedergang“ ist ein intellektuelles Abenteuer, mit allen Höhen und Tiefen, die in der Natur von Abenteuern angelegt sind. Die meisten Einschätzungen des Autors leuchten intuitiv ein. Sieht man sich seine Begründungen aber genauer an, wird man ein um das andere Mal stutzig. Des Öfteren sind sie fragwürdig, unterkomplex, manchmal wirken sie geradezu willkürlich und durch deduktives, nicht induktives Durcharbeiten des umfangreichen Stoffes zustande gekommen. Aus gewagten, halsbrecherischen Prämissen zieht der Autor ebenso verwegene Schlussfolgerungen.
Worum geht es Todd? Und wie geht er vor?
Emmanuel Todd ist der Überzeugung, dass der gesamte Westen im Untergang begriffen ist, die NATO im Zuge des russisch-amerikanischen Krieges – auf dem Rücken der Ukraine – auseinanderfallen wird und die Zukunft den Nationalstaaten (des Ostens) gehört. Um diese Überzeugungen zu beweisen, setzt der Politikwissenschaftler Axiome voraus, die er nicht in einem Einleitungskapitel abstrakt vorstellt, sondern sofort „bei der Arbeit“ demonstriert, und zwar im ersten Kapitel, das sich dem russisch-ukrainischen Krieg widmet. Axiome oder Postulate sind nach Todds Definition Setzungen, aus denen sich Theoreme ableiten lassen. Sie selbst ließen sich nicht beweisen, verfügten aber über einen solch hohen Grad an Plausibilität, dass man sie „als gegeben betrachtet“. Diese methodische Erklärung ist ehrlich, so wie man dem ganzen Buch eine gewisse zutraulich-spielerische Behauptungslust attestieren kann, die leider nur ungenügend von einem angemessenen Beweisführungsbedürfnis ergänzt wird. Beides hat zur Folge, dass ein Eindruck von akademischer Vorgehensweise gar nicht erst aufkommt. Solcherart entlastet, kann man sich nun durch dieses Werk hindurchschmökern.
Die axiomatischen Prämissen Todds sind folgende:
1. Die Nationalstaaten des Westens existieren nicht mehr.
2. Der Protestantismus, der zum guten Teil die wirtschaftliche Stärke des Westens ausgemacht hat, ist tot. Er verwandelte sich über das Stadium „Zombireligion“ zur „Nullreligion“. Das ist die Hauptursache für den Niedergang des Abendlandes. (analog: „Zombimoral“ und „Zombination“)
3. Der „religiöse Nullzustand“ führte zu Nihilismus.
4. In der westlichen Welt existieren zwei verschiedene Gesellschaftssysteme: der patrilineare Familientyp, (bei dem der Vater Autorität und Werte vermittelt wie (seine) Autorität und die Gleichheit der Söhne) und die Kernfamilie, (in der ein Paar mit seinen Söhnen und Töchtern zusammenlebt, die gleiche Rechte als Erben haben). Der erste Familientyp brachte Autoritarismus und in der Folge Kommuni(tari)smus, der zweite die liberale Demokratie und den Nationalsozialismus hervor.
5. Es gibt bewusste, aktive Nationen und träge Nationen.
Obwohl selbst Franzose, nimmt Todd nur Russland und Ukraine, die USA und Deutschland genauer unter die Lupe und wendet seine Axiome auf sie an. Als Kern des Buches bezeichnet Todd „die Analyse der regressiven Dynamik der amerikanischen Gesellschaft“.
Von Politikern und Mainstreammedien wird der Kampf für die Ukraine als einer zwischen liberaler Demokratie und neostalinistischer Autokratie dargestellt. Dagegen setzt Todd: Im ukrainisch/westlichen Krieg mit Russland träfen in ideologischer Hinsicht die liberalen Oligarchien des Westens und die autoritäre Demokratie Russlands aufeinander. Das klingt bei Todd dann so:
„Im Fall Russlands, wo gewählt wird und wo die Regierung – mitsamt ihren die Minderheiten unterdrückenden Unvollkommenheiten – unterstützt wird, habe ich die Idee der Demokratie behalten, jedoch ‚liberal‘ durch das qualifizierende Adjektiv ‚autoritär‘ ersetzt. Im Fall des Westens verbietet es die Dysfunktion der Mehrheitsvertretung, den Begriff „Demokratie“ beizubehalten. Währenddessen spricht nichts dagegen, den Begriff ‚liberal‘ beizubehalten, ist doch der Schutz von Minderheiten zur Obsession des Westens geworden. […] Aus unseren liberalen Demokratien werden also ‚liberale Oligarchien‘.“
Diese Begriffsgebung ist an sich schon problematisch. Einige Kritiker aus den Reihen der Wohlmeinenden, von denen das Buch verrissen wurde, bockten hier schon einmal – nicht zu Unrecht. Was Todd danach aber über den Zustand der Demokratie in der westlichen Welt sagt, findet die Rezensentin recht treffend:
„Das absolut Einmalige an den westlichen Oligarchien ist, dass ihre Institutionen und Gesetze sich nicht verändert haben. Formal betrachtet haben wir es immer noch mit liberalen Demokratien zu tun, ausgestattet mit allgemeinem Wahlrecht, Parlamenten und manchmal mit gewählten Präsidenten und freier Presse.“
Demokratische Sitten hingegen seien verschwunden. Hier wüsste man als Leser aber gern Genaueres, und zwar in Gestalt von Belegen, die dann in Analysen übergehen. Er liefert in etlichen Passagen plausible Skizzen der Verhältnisse, vor allem dann, wenn er die neuen Eliten westlicher Staaten beschreibt, die ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass sie erstens den richtigen Weg für die ganze Gesellschaft kennen, und dass ihnen zweitens die Mission zufällt, alle anderen mit den Mitteln der Gesellschaftsklempnerei auf diesen Pfad zu bringen:
„Die besser gebildeten Schichten halten sich für intrinsisch besser und weigern sich, […] ein Volk zu vertreten, dessen Verhalten in den Bereich des Populismus verbannt wird […]. Die Menschen bleiben alphabetisiert, und die Grundlage des allgemeinen Wahlrechts wird zwar von der neuen Bildungsschicht überlagert [? – d.A.], ist aber immer noch lebendig. Die oligarchische Dysfunktion der liberalen Demokratien muss also geordnet und kontrolliert werden. Was bedeutet das? Ganz einfach, dass, obwohl die Wahlen weiterbestehen, das Volk von der wirtschaftlichen Verwaltung und der Verteilung des Wohlstands ferngehalten werden muss, mit einem Wort: getäuscht. Für die politischen Klassen bedeutet dies viel Arbeit, wenn nicht sogar die Arbeit, der sie sich vornehmlich widmen. So kommt es zur Hysterisierung rassistischer oder ethnischer Probleme und zum wirkungslosen Geschwätz über gleichwohl wichtige Themen: Umweltschutz, die Stellung der Frauen oder globale Erwärmung.“
Dann aber stellt er einen merkwürdigen Kausalzusammenhang auf: Weil die westlichen Regierungsmitglieder so viel [falsche – d.A.] Arbeit haben und alles in den Dienst stellen, Wahlen zu gewinnen, die blanke Theateraufführungen sind, und sie infolgedessen unter Zeitnot leiden, und weil die Funktionsweise liberaler Oligarchien eine chaotische ist, bringen diese nur noch „diplomatisch inkompetente Eliten hervor und damit massive Fehler in der Bewältigung des Konflikts mit Russland und China.“ Aha: keine Zeit + Chaos = dilettantische und gefährliche Außenpolitik. Wer hätte das gedacht?
Allerdings ist Westeuropa weder aus Zufall noch aus Dummheit oder aus Versehen in den Krieg mit Russland gestürzt, meint Todd, sondern weil die EU implodiere. „Ein Gefühl soziologischer und historischer Leere hat unsere Elite und unsere Mittelschicht beschlichen.“ Und da kam die Ukraine-Krise wie gerufen. Sie gab dem europäischen Konstrukt wieder einen Sinn. Vom äußeren Feind wurden die europäischen Länder wieder zusammengeschweißt, meint der Autor. Da ist was dran. Doch dann beginnt der Autor zu delirieren: Die Reaktion der Europäer auf die „Spezialoperation“ sei keineswegs ein Ausdruck von vorwärtstreibendem Aktivismus, sondern – im Gegenteil – ein suizidärer Reflex, Ausdruck einer „Hoffnung, dass dieser endlose Krieg letzten Endes alles explodieren lässt“. Der geheime Wunsch der Eliten sei, dass der Krieg Europa von sich selbst befreit. „Putin wäre ihr Retter, ein erlösender Teufel.“ Derlei ist weder ein Ergebnis historischer noch anthropologischer Forschung, sondern schlicht Vulgärpsychologie. Dass die EU ein „unkontrollierbares“ und „irreparables Kraftwerk“ ist, mag hingegen zutreffen.
Das intellektuelle Defizit des Westens sei erschreckend, konstatiert Todd und nennt das derzeitige Kriegsdilemma als Beispiel. Die Angst der europäischen Machthaber davor, von Russland um dessen Expandierung willen militärisch überfallen zu werden, kontert er so:
„Mit seiner schrumpfenden Bevölkerung von 144 Millionen Menschen hat Russland Schwierigkeiten, seine 17 Millionen Quadratkilometer zu bewohnen. Für die Russen ist es ein Glück, die Polen und Balten losgeworden zu sein. Jede Behauptung, Russland wolle über die Ukraine hinausgehen, stammt von einem Schwindler oder einem Verrückten. Vielmehr wird die russische Armee bis zum Dnepr und bis nach Odessa gehen. Die Russen sind seit der Weigerung, das Minsker Abkommen umzusetzen, und der Aufkündigung des Atomvertrags mit dem Iran der Ansicht, dass der Westen seine Verpflichtungen nie einhält. Nur das Erreichen geografischer Ziele, die ihre Sicherheit garantieren, zählt für sie. Der Krieg hat sie zu viel gekostet. Sie werden nicht das Risiko eingehen, dass der Krieg in einigen Jahren wieder aufgenommen wird. Dieses Mal werden sie bis zum Ende gehen.“
Und das heißt für Todd auch, dass Russland im Falle einer Bedrohung für Nation und Staat taktische Nuklearschläge auf dem Schlachtfeld erlauben wird. Der Westen habe Russland provoziert:
„Der amerikanische Politologe John Mearsheimer hat nüchtern festgehalten, dass die Zusammenarbeit der Briten und Amerikaner mit seiner Armee die Ukraine faktisch zum Nato-Mitglied machte. Sie wurde aufgerüstet, um Russland anzugreifen. Putins Angriff war eine defensive Invasion. Er hatte diese Reaktion angekündigt und mit Krieg gedroht.“
Kleine Anmerkung: Einen unterschriebenen „Atomvertrag“ zwischen den USA und Iran gab es nie – sondern nur eine gemeinsame Protokollerklärung auf der unteren diplomatischen Arbeitsebene. Eine echte Überprüfungsmöglichkeit, ob der Iran seine Verpflichtungen einhält, sah das Papier nie vor. Solche Details spielen in dem Bild keine Rolle, das Todd nicht nur hier mit breitem Pinsel malt.
Auf den „Nachdenkseiten“ war zu diesem Thema in Todds Buch zu lesen: Die Möglichkeit des Friedens werde von unseren Politikern verneint, als ob er, mehr noch als ein thermonuklearer Austausch, eine Bedrohung wäre. Die Russen wiederholten immer wieder, dass sie nicht die Absicht hätten, ihre Armee über die Ukraine hinaus zu führen. Die westlichen Politiker „sind heute nicht fähig, sich vorzustellen, dass Russland danach Frieden will, nicht aus Gutmütigkeit, sondern weil es in seinem Interesse liegt. Russland wird in der Ukraine nicht nachgeben. Europa ist in keiner Weise bedroht. Frieden sollte möglich sein.“
Diese Einschätzung teilt die Autorin – allerdings dessen eingedenk, dass man auch dann Laie bleibt, wenn man russische Medien verfolgt und auf Röpers Blog „Anti-Spiegel“ die Übersetzungen von Reden und Interviews russischer Politiker und Berater liest. Es handelt sich mehr um eine Hoffnung, einen Glauben. Todd ist um seine unerschütterliche Gewissheit zu beneiden.
Insgesamt stellt Todd eine Unwilligkeit der Bevölkerungen in einem Großteil der Welt fest, Kriege zu führen. „Die Bevölkerungen heute werden immer älter und schrumpfen. Vor allem in China. Indien wird folgen. Die Energie ist nicht mehr da, um sich gegenseitig zu töten.“ Speziell Deutschland und Russland könnten nicht mehr gegeneinander Krieg führen, denn ihre wirtschaftlichen Spezialisierungen ergänzten sich gegenseitig. Früher oder später würden sie kollaborieren. Deutschland sollte sich von der Abhängigkeit der USA lösen und sich mit Russland verbünden. Die Russen träumten davon, die Komplementarität ihrer Wirtschaft mit der deutschen wiederherzustellen.
Nun, diese Träume eines Revivals spezieller deutsch-russischer Beziehungen hat die russische Staatsführung ausgeträumt. Heute sieht Putin keinen Unterschied mehr zwischen allgemeinen westeuropäischen Interessen und politischen Verhaltensweisen einerseits und deutschen andererseits. Für ihn haben wir alle den Verstand verloren, er wendet sich kopfschüttelnd ab und orientiert sich nun vollständig nach Asien.
Allerdings liegt Todd wohl richtig, wenn er meint, dass die Deutschen das eigentliche Ziel der Amerikaner bei ihrer Unterstützung der Ukraine seien: Deutschland von Russland zu trennen sei ein wichtiges US-amerikanisches Anliegen. Ihm habe auch der „Terrorakt“ der Zerstörung der Nord Stream-2-Pipelines gegolten. Der Krieg müsse aus Sicht der USA weitergehen, nicht um die ukrainische „Demokratie“ zu retten, sondern um ihre Kontrolle über Westeuropa und Ostasien aufrechtzuerhalten. Ob die Präsidentschaft Donald Trumps hieran etwas ändert, muss sich erst noch erweisen.
Zu Deutschland fällt dem vorgeblichen Historiker und Anthropologen auch sonst eine Menge ein, indem er seine Axiome in Anschlag bringt.
Die deutsche Gesellschaft sei nicht individualistisch. Seine anthropologische Grundlage ist die autoritäre und nicht die egalitäre Stammfamilie. Derzeit könne man der zwergenhaften, untergeordneten Führungsschicht einer Stammgesellschaft zusehen, die sich ihrer Autonomie verweigert und nach Unterwerfung strebe, indem sie auf das Handeln verzichte. Das Unvermögen der Regierenden von Stammesländern, mit Macht umzugehen, sei auch Japan eigen, führte zum Angriff auf Pearl Harbor und brachte die erste Wirtschaftsmacht der Epoche zum Sturz.
„Der Verlust an self-control von Menschen an der Spitze der Pyramide könnte als strukturell induzierter Größenwahn in der Stammgesellschaft bezeichnet werden“.
Deutschland unter Wilhelm II. stellt aus Sicht Todds dafür den Idealtypus dar. Als erste Industriemacht des Kontinents zog es vereint, herrschend und herrisch Europa mit in seinen ersten Untergang.
„Die Personen, die es regierten, nicht nur Wilhelm II. und sein Gefolge, sondern auch die oberen deutschen Klassen, hatten den Kontakt zur Realität verloren.“
Auch hier macht es sich der Autor sehr leicht. Im August 1914 war es der Kaiser, der zögerte, der k.u.k.-Monarchie den berühmten Blankoscheck auszustellen, während Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg und der Generalstab mit Macht zu einem Krieg drängten, den sie aber übereinstimmend als Präventivkrieg deuteten.
„Die Schwierigkeit, Oberhaupt eines Stammsystems zu sein, wird in Deutschland verstärkt durch das Fehlen eines Nationalbewusstseins und damit eines leitenden Handlungsprinzips“, schreibt Todd über die Gegenwart: „Vor Angst wird das Stammoberhaupt passiv.“ Zur Hyperaktivität von der „wertegeleiteten Außenpolitik“ bis zur grün-deutschen Weltklimapolitik will auch dieser Befund nicht recht passen.
Deutschland, meint der Autor, setze weiterhin auf die Industrie und nicht ihre Abwicklung: Deshalb sei es kein westlicher Staat. „In Deutschland ist die Emanzipation der Frauen weniger weit fortgeschritten und die Rollenverteilung der Geschlechter traditioneller als in Frankreich und England. Und weil die Frauen weniger studieren, gibt es mehr Ingenieure.“
Auch für diese steile These hätte man gern Belege.
Weiter: „1933, als Hitler an die Macht kam, wäre niemand auf die Idee gekommen, Deutschland als westliches Land zu bezeichnen.“ Hier zeigt sich, wie sehr dem Buch eine kohärente Definition des titelgebenden Begriffs „Westen“ fehlt. Doch, bis zum Machtantritt Hitlers herrschte in Deutschland ein ausgeprägt westliches Kultur-, Kunst- und Geistesleben, ein zwar schon beschädigter, aber noch intakter Parlamentarismus, übrigens mit Frauenwahlrecht seit 1919. In dem von Todd als „westlicher“ beschriebenen Frankreich durften Frauen erst ab 1944 an die Wahlurnen. Folgt man dem Autor, dann hätte Hitler nah seiner Machtübernahme gar nicht so viel zu zerstören gehabt. Genau das trifft aber nicht zu.
Auch die Japaner, führt Todd aus, hätten keine Lust, zum Westen zu gehören. Sie seien sehr modern, doch gleichzeitig hielten sie an ihrer Tradition und Kultur fest. „Die Deutschen tun so, als würden sie zum Westen gehören. Auch das ist Teil ihrer Neurose.“ Leider bietet Todd keine Theorie dazu an, wohin Deutschland seiner Ansicht nach denn sonst gehören sollte.
Deutschlands Interventionen bei der Auflösung Jugoslawiens und der Tschechoslowakei wie auch die Hinwendung der Europäischen Union unter seiner Führung zur Ukraine, die 2014 zum Maidan führte, „erinnern fürchterlich an die Expansionsgeografie der Nationalsozialisten“, meint Todd – so, als hätte erst die Bundesregierung unter Helmut Kohl dafür gesorgt, dass das nach-titoistische Jugoslawien auseinanderbrach. Kohl und Genscher drängten vielmehr darauf, die damals schon vollzogenen Volksabstimmungen 1991 über die Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens anzuerkennen, also die Tatsache zu akzeptieren, dass diese Völker eigene Staaten wollten.
Wie passt das nun alles auf das Deutschland der Gegenwart? „Der Ukrainekrieg hingegen hat uns auf einmal das Gegenteil beobachten lassen: eine Absage, ja, eine Weigerung, Einfluss auf die Ereignisse zu nehmen.“ Diese Behauptungen sollen vermutlich auf eine allgemeine nationale Schizophrenie hindeuten, was auch nicht originell wäre, entbehrt aber jeder rationalen Erklärung für das Handeln der politischen Funktionseliten in der Gegenwart.
„Deutschland ist nicht nationalistisch, es hat keinerlei Machtprojekt, was seine sehr unzureichende Geburtenrate von maximal 1,5 Kindern pro Frau über einen langen Zeitraum zeigt.“ Eine Geburtenrate soll heutzutage darüber entscheiden, ob eine Nation ein „Machtprojekt“ verfolgt? Russlands Geburtenrate liegt übrigens bei 1,42.
Auch den USA fehlt laut Todd ein nationales Projekt, woraus dieselbe Leere und derselbe Zerfall kollektiver Kräfte resultieren, was hier aber keineswegs Passivität, sondern fieberhaften Aktionismus hervorbringe. Deutschland sei eine träge Nation, die USA eine bewusst-aktive.
Deutschlands Tragödie bestehe darin zu glauben, von den USA beschützt zu werden. Auf die Pipeline-Sprengung habe es mit absoluter Willenlosigkeit reagiert. Die Macht, die sie zu beschützen vorgab, hat nichts unversucht gelassen, um die vorherrschende Stellung Deutschlands in Europa zu zerschlagen. Deutschland befinde sich in einer Lage, „die es in kognitiver Hinsicht überfordert“.
Zwischen der offensiven Strategie der Amerikaner und der defensiven Strategie der Russen befänden sich die Europäer in einem atemberaubenden „Zustand der geistigen Verwirrung“. Das gelte ganz besonders für Deutschland.
„Durch den Krieg ist die führende europäische Wirtschaftsmacht wieder zu einem verängstigten, bevormundeten Protektorat geworden.“ Die Deutsche Elite verweigere sich ihrer Autonomie.
Deutschland betreibe Wachstumsverweigerung. Einen Grund dafür sieht Todd in der Überalterung des Landes. „Das Durchschnittsalter liegt bei fast 46 Jahren. Vielleicht ist dieser Verzicht charakteristisch für eine Gerontokratie. Ältere Menschen sind alles andere als abenteuerlustig. Auch das schlechte historische Gewissen könnte es erklären. In seinem Verlangen nach Buße strebt Deutschland danach, auf der Seite des Guten zu stehen.“
Der Auflösungsprozess von Nationen, der einen Zerfall des gesamten europäischen Gefüges erzeugte, habe nicht verhindert, dass gewisse Nationen, wie etwa Deutschland, sich als widerstandsfähiger erwiesen haben als andere. Trotz des selbstzerstörerischen Kurses der Deutschen, bestünden doch einige ihrer Werte weiter und das schon länger als der Protestantismus oder der Katholizismus. „Trotz des Verschwindens der großen Religionen und der Ideologien, die ihnen gefolgt waren, bestehen in Deutschland mentale Gewohnheiten der Disziplin, Arbeit und Ordnung fort. Daher konnte es sich während der Globalisierung seine industrielle Effizienz besser bewahren.“ Und: „Dadurch, dass Deutschland in seinem Wesen durch sein anthropologisches System unterstützt wurde, konnte es dem Sterben der Ideologien besser Widerstand leisten.“ Was soll denn ein „anthropologisches System“ sein?
Und hier nun findet sich die Schnittstelle zwischen schrumpfendem Protestantismus und Nihilismus: Die metaphysische Krise führe zur Vergötterung des Nichts und drücke sich einerseits im Trieb aus, Dinge und Menschen und andererseits den Begriff der Wahrheit zu zerstören und jede vernünftige Beschreibung der Welt zu verbieten. Der Neoliberalismus sei Produkt der religiösen Leere. Und das dargestellte Verhalten, Denken und Fühlen der deutschen „Elite“ sei eine repräsentative Erscheinung dieses Nihilismus, der aber den ganzen Westen erfasst habe, auch die USA, deren Situation er mit derjenigen Deutschlands in den Dreißigerjahren vergleicht.
„In beiden Fällen funktioniert das politische Leben ohne Werte, es ist nichts als eine Bewegung mit Tendenz zur Gewalt“, stellt er fest. Der endgültige Untergang der Religion bringe den des Nationalgefühls mit sich. „Der Nullprotestantismus definiert die Nullnation eher noch als die träge Nation.“
Amerikas Niedergang ist Todd zufolge auf eben diesen Nihilismus einerseits und auf die permanente Verkleinerung der Industrieproduktion und das Fehlen von Ingenieuren zurückzuführen. „Die USA haben bereits verloren, weil ihr Problem nicht Russland, sondern ihr eigener innerer Verfall ist. Ihre Bevölkerung wächst, ihre Wirtschaft ist fiktiv und die Welt verfügt nicht mehr über die Mittel, ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten.“
Hier verrät Todd ein von der Zeit überholtes Verständnis von Industrie, Ingenieurskunst und Produktion. Der Übergang von Hardware-Technik zu Software-Technik wird von ihm als Deindustrialisierung verstanden. Digitalität und KI verwandeln in seinen Augen die Wirtschaft in eine fiktive, als gingen sie automatisch den Weg des Fiat-Geldes. Doch elektronische Geldverarbeitung und -verbreitung heißt nicht per se Geldschöpfung aus dem Nichts.
Da Todd jedwedes spirituelles Bedürfnis als Ausdruck des „absolut Irrationale[n]“ im Menschen versteht, bleibt er auch hier nur an der Oberfläche. Die Bedeutung des Protestantismus für das Abendland übernimmt Todd von Max Weber. Das Nihilismus-Narrativ stammt von Nietzsche und wurde in seinem amerikanischen Exil von Hermann Rauschning ausführlich und mit intellektueller Gründlichkeit dargestellt.
Für einen Historiker spekuliert Todd zu viel und drückt zu viele Details beiseite, wenn sie sein Gesamtbild stören. Für einen Philosophen geht er zu eklektizistisch vor und es fehlt ihm an Theorie. Und für einen Anthropologen wiederum argumentiert er zu soziologisch. Man findet einige nachdenkenswerte Interpretationen, doch sein Ziel, die Unaufhaltsamkeit des Niedergangs und der totalen Niederlage des Westens im Kampf gegen Russland zu beweisen, erreicht er nicht. Seine Beweisführung ist intellektuell zu wackelig und empirisch zu dünn. Gern hätte sich die Verfasserin beispielsweise erklären lassen, was das Fehlen von Ingenieuren in den USA mit einer nihilistischen Weltauffassung und entsprechendem Verhalten zu tun hat. Aber keine Chance.
Das große analytische Werk über den Zerfall des Westens steht wohl noch aus. Erkenntnishungrige aber werden auf Schritt und Tritt mit Irritationen, deutlichen Worten und originellen Ideen beschenkt.
Das letzte Zitat ist eine Diagnose von großer Treffsicherheit und lakonischer Sachlichkeit: „Im heutigen Amerika beobachte ich im Bereich des Denkens und der Ideen einen gefährlichen Zustand der Leere, in der eine übriggebliebene Besessenheit von Geld und Macht waltet. Diese beiden können jedoch für sich genommen keine Ziele oder Werte sein. Die Leere führt einen Hang zur Selbstzerstörung herbei, zum Militarismus, zu einer anhaltenden Negativität, kurz: zum Nihilismus.“ Dieser dürfte auch eine Ursache sein für das allgemeine wechselseitige Misstrauen zwischen Eliten und Bevölkerungen, das Todd beklagt und das auch die Beziehungen zwischen den Ländern immer mehr prägt, so dass eine Friedensstiftung, wie sie in der Ukraine dringend erforderlich wäre, ein langwieriger Prozess zu werden droht.
Emmanuel Todd, „
Wenn von einem Buch über den Glauben nicht viel mehr als das Wort „glauben“ bleibt
Viele sind – politische Lager übergreifend, eine Seltenheit – angetan von Bernd Stegemanns Essay „Was vom Glauben bleibt“. Unser Rezensent nicht
von Jürgen Schmid
Schon der Untertitel „Wege aus der atheistischen Apokalypse“ suggeriert nicht nur Betrachtung und Analyse, sondern: Handlungsanweisung. Das siedelt schon sehr nah an der politrhetorischen Formel: „Wir brauchen“. Bei dem Rezensenten jedenfalls ruft die Ankündigung, „Wege“ aufzuzeigen, einen Abwehrreflex hervor. Er zieht es vor, erst einmal ins offene Denken mitgenommen zu werden.
Dafür aber bräuchte es Substanz – und nicht nur eine Wortanhäufung. Bereits die Einleitung („Mein Anfang der Suche“) und das Kapitel „Glaube ohne Religion“ weisen eine Dichte des Wortstammes „Glaube“ auf wie wohl kaum ein zweites Buch, theologische Werke inklusive: Auf 25 Seiten versammeln sich 217 Mal Glaube, glauben, das Geglaubte, Gläubige und Ungläubige, Glaubenswahrheiten (nebst Glaubensuntauglichkeiten und dergleichen mehr), darunter elf „Glaubensreste“ und sechs „Glaubenspartikel“. Auf zwei besonders glaubensintensiven Seiten glaubt es sich 21 beziehungsweise 23 Mal, fast in jeder Zeile.
Inflation bedeutet Entwertung, das hätte ein Lektorat erkennen können. (Auch das Wort „säkular“ verdient sich Zeilengeld en masse, es hat auf wenigen Seiten 42 Auftritte.)
Beispiele dafür, mit immer denselben Versatzstücken wenig auszusagen? „Es gibt nicht nur zwei Arten zu glauben, […] sondern im Glauben sind zwei verschiedene Dimensionen verborgen. Zum einen ist mit dem Glauben eine menschliche Fähigkeit gemeint, und zum anderen wird im Glauben etwas vorgestellt, an das geglaubt wird.“ Oder: „An jemanden zu glauben, vertrauensvoll gläubig zu leben oder an Gott zu glauben und dann im Glauben zu leben, diese verschiedenen Existenzweisen sind sprachlich nur mit Mühe zu differenzieren.“ Und ein letztes: „Der säkulare Glaube steht vor der Versuchung, den Glauben […] zu einem innerweltlichen Bescheidwissen zu verhärten.“ Statt dass sich ein weiteres Mal etwas zu einem „anmaßenden Bescheidwissen verhärtet“ und noch zweimal das Bescheidwissen, wiederum „innerweltlich“, aufgerufen wird, hätten die Bescheidwisser etwas genauer benannt werden können als mit „zahlreiche politische und weltanschauliche Fundamentalismen unserer Zeit“.
Wenn Stegemann explizit wird, klingt das in einer Aufzählung „falscher Propheten“ der Jetztzeit so: „Abtreibungsgegner, Klimaaktivisten, Corona-Leugner und identitätspolitische Aktivisten“, sie alle gefährden nichts weniger als „die Demokratie“, was inzwischen offensichtlich von jedem bei jeder Gelegenheit behauptet werden muss.
Diese Liste von Irrläufern in den „post-christlichen“, „säkularen Bewegungen“, wie Stegemann das nennt, was seines Erachtens vom Glauben übriggeblieben ist, erscheint als fatale Gleichsetzung von allem mit allem. Wer so Ungleiches in einen Topf wirft, nach dem Motto: Wenn ich ein Feindbild der Linken kritisiere, muss die Kritik an einem Feindbild der Rechten folgen, offenbart wohl wenig mehr als seine Absicht, nicht aus dem Mainstream fallen zu wollen. Wer dezidiert aus seiner Biographie als Katholik heraus schreibt, dem hätte eine ernsthafte Abprüfung der genannten „falschen Propheten“ dahingehend, wie biblisch ihr jeweiliges Anliegen ist oder eben auch nicht, gut zu Gesicht gestanden.
Das Buch lässt den Leser ratlos zurück: Man hat nie das Gefühl, der Autor beziehe einen Standpunkt; er laviert sich mit Andeutungen durchs Thema, das er selbst gewählt hat, ohne sich festzulegen. „Überall entstehen neue Wir-Gruppen, die sich in Feindschaft zu anderen formieren.” Wer mag das sein, die neuen „Wirs“ in Gruppenform? Auskunft täte Not. Wer ist gemeint mit orientierungslos Erregten, wer sind die „betont säkularen Menschen“, die „endzeitlichen Fantasien“ folgen? Wenn dekretiert wird: „Wir können nicht auf die Technik verzichten, aber wir sollten sie nicht zum Götzen machen“ – Wer macht was genau zum Götzen? Und wer ist überhaupt „Wir“?
Wenn Stegemann feststellt, wie allgegenwärtig Fanatismus und Fundamentalismus heute sind: Warum schweigt er über diejenige Religion, die keineswegs säkular gesinnt ist und unser Land immer mehr im Griff hat – den Islam? Weil man dann eine religiöse Apokalypse beschreiben müsste?
Carl Christian Brys Studie „Verkappte Religionen“ von 1924 – später hinzugefügter Untertitel: „Kritik des kollektiven Wahns“ – zeigt, wie eine fundierte Ideologiekritik beschaffen sein kann, die sich vor allem durch Unterscheidungswillen auszeichnet:
„Religion sagt: Der letzte Sinn deines Daseins liegt jenseits deines Lebens, liegt über deinem Leben. Verkappte Religion hingegen sagt: Hinter der gewöhnlichen Welt liegt etwas bisher Verborgenes, […] eine noch nie realisierte Möglichkeit, der wir […] beizukommen gerade im Begriff sind. Der Anhänger der verkappten Religionen glaubt an etwas hinter der Welt. Man kann ihn kurz den Hinterweltler nennen.“
Wer an dieser Definition obige Liste angeblich falscher Propheten abgleicht –„Abtreibungsgegner, Klimaaktivisten, Corona-Leugner, identitätspolitische Aktivisten“ –, wird schnell erkennen, dass zwei von vier zu streichen sind. (Überhaupt mutet es befremdlich an, von „Corona-Leugnern“ zu sprechen, wenn man auch Gegner staatlicher Corona-Maßnahmen und Impfpflichtpläne mitmeint).
Identitätspolitiker sind bestenfalls Utopisten, Klimajünger (Aktivisten ist eine Beschönigungsformel) Dystopisten, die ebenfalls einer Utopie anhängen. Bry grenzt die Utopie, die auf Erden errichtet werden soll, von Vorstellungen echter Religionen ab: „Der Fromme glaubt an ein unvorstellbares Reich jenseits der Wolken, der Hinterweltler an eine neue Wirklichkeit hinter der Tapete.“ Der verkappt Religiöse ist überzeugt, „daß eines Tages dasjenige, was heute noch Hinterwelt ist, die Welt besiegt haben wird. An diesem Siege zu arbeiten, die Hinterwelt zur Welt zu machen, ist der Inhalt seines Glaubens.“ Wo wäre die Bemühung eines Abtreibungsgegners, „die alte Welt zu erobern und zu durchdringen“, was nach Bry erst „das Wesen der verkappten Religion“ ausmacht?
Auch die Besprechungen stochern im Nebel des Raunens, wenn sie – Beispiel Katholische Nachrichten-Agentur – einen Stegemann-Gedanken so wiedergeben: „Politiker und Aktivisten würden zu ‚falschen Propheten’, die gegen Personen kämpfen.“ „Personen“, das klingt wie „ein Mann“, der, wenn er eine Straftat begeht, nicht genauer benannt werden darf. Und „Politiker“ gibt es von links bis rechts. Wer aber ist gemeint? Vom falschen Prophetentum sei „das ganze Polit-Spektrum betroffen“. Aha.
Der Autor weiß wohl, warum er so laviert. Denn schon seine wenigen Andeutungen sind selbst der FAZ zu viel. Möglichst unkonkret und stets ein wenig gewollt auch nach rechts auskeilend, um weiter salonfähig zu bleiben – der Klärung von Sachverhalten dient eine solche Selbstschutztaktik jedenfalls nicht.
Aufschlussreich, aber ein Thema für sich, wäre die Suche danach, wo die Humanisten – jedenfalls jene von der Konkretisierung HVD (Humanistischer Verband Deutschlands) – falsch abgebogen sind, für die Johannes Schwill kundtut, Stegemanns „Erinnerung ans Heilige“ („als rettende Geste hat der Glaube nur die Scheu vor dem Heiligen, um zu verhindern, dass die weltliche Macht die Erlösung zu ihren Konditionen erzwingt“) wäre wenig hilfreich für ein „Gefühl des ‚Getragen- und Aufgehobenseins’“, das auch Schwill genehm wäre – aber bitte ohne das Heilige, das sage ja „sogar die FAZ“. Der Humanist will getragen sein vom „Diesseits“ – und übersieht dabei zweierlei: Dass es gerade das von ihm besprochene Buch ist, das diesseitige Propheten als falsche bezeichnet, die nicht tragen. Und zum zweiten, dass die FAZ längst nicht mehr dort steht, wo er sie immer noch verortet: im konservativen Lager. Denn bei den klugen Köpfen in Frankfurt bricht Marianna Lieder, die ebendort auch „Idealfälle des nonbinären Denkens“ feiert, unter der polemischen Überschrift „So, so, das Problem ist also die Identitätspolitik“ den Stab über Stegemann aus einer ultra-progressiven Position heraus: Was brauche es Glauben und Religion, was brauche es Gott, wo doch eine „universalistische Moral“ bereitstehe, die „existenzielle Sinnhaftigkeit ohne Rückgriff auf eine höhere Macht“ im Angebot habe?
Vielleicht findet mancher mehr in Stegemanns Glaubensverteidigung als der Rezensent. Die Verlegerin und Buchhändlerin Susanne Dagen etwa zitiert begeistert aus Stegemanns Text: „Die Antwort des Glaubens […] kann nicht in der Erinnerung an die Stärken des Glaubens bestehen, die heute als Glaubenshärten auftreten, sondern sie erlernt die Hoffnung, die das Geschenk bedeutet, das Gott uns mit seiner Schwäche gemacht hat“. Die meisten Christen vertrauen allerdings nicht deshalb auf Christus, weil sie ihn als schwach sehen.
Auch wenn hier einer mehrfach bekundet, wie persönlich für ihn das Schreiberlebnis war, die seitenfüllenden Exzerpte aus Werken anderer Autoren sprechen eher dafür, dass da auf die Schnelle etwas zusammengestellt werden sollte, um an den überragenden medialen Erfolg des Vorgängers „Identitätspolitik“ anzuknüpfen. Wer im Herbst 2023 ein Buch von 110 Seiten herausbringt („Identitätspolitik“), dann auf monatelange Tour damit geht, bereits ein Jahr später ein weiteres Buch mit nun 288 Seiten hinterherschiebt (das Anzuzeigende), um nur wenige Monate danach, im Januar 2025 die nächsten 176 Seiten („In falschen Händen. Wie Grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“) vorzulegen, erweist sich als hoch produktiver Quantitätsschreiber. „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“, heißt es bei Goethe. Unbeschränkt gilt das allerdings nicht. Erst recht nicht bei einem Thema von so hohem Rang.
Bernd Stegemann, „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“, Klett-Cotta, 2024, 288 Seiten, 25 Euro
Publico verwendet Affiliate-Links zu Amazon. Das bedeutet: wenn Sie dort ein Buch bestellen, erhält Publico eine kleinen prozentualen Anteil je Verkauf. Natürlich können Sie Bücher aber auch gern beim Buchhändler Ihrer Wahl oder direkt beim Verlag bestellen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen als Leser.
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.