Habeck, Merkel, Amann und die Fortsetzung des Kampfs außerhalb des Erwartungsraums
Von Dirk Schwarzenberg
Vor vielen Jahren erschien im New Yorker ein Cartoon, in dem ein Berater dem namenlosen Amtsinhaber mit dem Kapitol im Hintergrund den Hinweis gibt: „The mark of true leadership is knowing when to resign in disgrace.“ Diesen Rat beherzigten in der vergangenen Woche auf ihre ganz persönliche Art gleich drei Personen, indem sie sich von Deutschland und den Deutschen verabschiedeten: Robert Habeck, Angela Merkel und Melanie Amann.
Warum Angela Merkel, deren Geist nach allgemeiner Wahrnehmung ja immer noch über der Republik liegt wie feuchtkalter Nebel auf den Wiesen der Uckermark? Auch sie meinte jetzt endgültig, dieses, nun ja, Aufenthaltsgebiet in Mitteleuropa wäre spätestens jetzt nicht mehr ihr Land. Das fiel nur außer dem Verfasser dieser Zeilen bisher keinem auf. Der große Stern-Journalist Nico Fried bemerkte im Vorwort zu „Angela Merkel. Die großen Reden“: „Ein Problem an Angela Merkels Reden war das Zuhören.“ Nicht das einzige, gewiss. Aber tatsächlich entging vielen bei ihr nicht nur das jeweils letzte Satzglied, sondern auch die hier und da versteckte subkutane Botschaft. Wie sich Merkel gerade final von den Menschen im Land trennte – dazu gleich mehr.
Beginnen wir mit der nun wirklich nicht subkutanen Abschiedsrunde von Robert Habeck, Ex-Wirtschaftsminister, Ex-Großporträtierter auf dem Münchner Siegestor und Immernochdoktor der Literaturwissenschaften mit einem schwebenden Verfahren zu 168 Fußnotenübernahmen aus anderen Werken. Der Mann geht auf seinen Feldern unbesiegt, mit dem Dolch der Wähler im Rücken, aber auch, wie sich gleich zeigen wird, nicht unbesungen.
Sein eigener Beitrag zur Verewigung begann mit einem taz-Interview, in dem es unter anderem hieß: „Sie hat immer nur polarisiert, polemisiert und gespalten. Insofern war von Anfang an klar, dass sie eine Fehlbesetzung ist.“ Wieso sie? Ach so, es handelte sich um Habecks Charakterisierung von Julia Klöckner, der er hauptsächlich vorwirft, sie wolle die Regenbogenfahne nur einmal im Jahr über dem Reichstag wehen lassen, und sie habe der Gruppe queerer Bundestagsmitarbeiter nicht gestattet, unter der Marke ‘Bundestag‘ am Christopher Street Day teilzunehmen.
Zweitens geißelte der Wirtschaftsminister a. D. noch das fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder. Der Franke lässt sich tatsächlich gern beim Fleischverzehr fotografieren, während der große Grüne sich in seiner Amtszeit lieber vor Windparks filmen ließ, von denen er behauptete, sie könnten ein Kernkraftwerk ersetzen. Als Fetisch wollte er das allerdings nicht verstanden wissen. Bei „Lanz“ brachte der Bündniskanzler a. D. dann noch einmal das rechtskonservative Gedankengut von Klöckner und die Wurstverdrückerei Söders zur Sprache, beklagte den von anderen angezettelten Kulturkampf und stellte fest, das alles habe doch nichts mit den Problemen des Landes zu tun.
In dem Moment warteten viele Zuschauer wie Schießhunde darauf, dass Robert Habeck nun über genau diese wirklichen Probleme sprechen würde statt über Fleisch, Vegetarismus, Regenbogenfahne und Rechte. Ihm fiel offenbar gerade noch rechtzeitig ein, dass diese Probleme allesamt mit ihm und seiner Politik mehr oder weniger stark zusammenhängen, weshalb er sich entschloss, kein Politiker mehr zu sein bei seinem bewährten Stiefel zu bleiben. Und der klang dann vollständig transkribiert so, nämlich auf die Moderatorenfrage, warum er sich jetzt aus dem Bundestag zu verkrümeln beabsichtige:
„Ich bin aber, meine ich jedenfalls, gewählt worden für eine bestimmte politische Idee, jedenfalls war das mein Angebot. Ich habe ja nicht auf meine Plakate geschrieben, ich möchte im außenpolitischen Ausschuss sein, sondern der Anspruch war, und das war ein hoher Anspruch, über die Grünen, eine politische Idee von politischer Kultur in Deutschland mit zu formen, vielleicht zu prägen, je nach dem wieviel der Zuspruch gewesen wäre. Und das kann ich nicht. Und das kann ich auch in dieser Position heraus nicht. Ich kann es vielleicht ein Stück weit tun, indem ich rausgehe; nicht prägen sicherlich, und nicht in der Verantwortung sein im harten Sinne des Mandats, aber ich kann das, was ich glaube, was die politische Debatte braucht, vielleicht bereichernd mit befeuern.“
Ungefähr das Gleiche sagte der letzte sächsische König 1918 bedeutend kürzer und sogar mit einem sympathischen Zungenschlag. Dafür hörten die Zuschauer hier wirklich noch einmal den allerauthentischsten Robert Habeck. Damit endete sein mäandernder Monolog noch nicht ganz:
„Um das zu bringen, was von mir erwartet wurde oder was ich glaube, was diese vielen Menschen von mir erwarten, muss ich außerhalb des Erwartungsraums agieren. Das ist die Analyse, klingt ein bisschen widersprüchlich, weiß ich wohl, aber es ist nicht, es ist für mich aber nicht widersprüchlich.“
Während er also ankündigte, seinen Kampf außerhalb des Erwartungsraums an US-amerikanischen Universitäten fortzusetzen, also dort, wo den wohlgesinnten deutschen Medien zufolge Trump jetzt Intellektuelle verfolgen lässt, zündeten ebendiese Medien eine befeuernde Bereicherung seines Angedenkens, wie sie noch kein Bündniskanzler vor ihm erlebte. Die Zeit wählte Trauerschwarzweiß,
die Süddeutsche stellte fest: „Seine Verdienste werden von vielen unterschätzt.“ Und: „Sein größter Fehler war nicht das Heizungsgesetz, sondern dass er in der Debatte dazu viel zu vornehm blieb.“ Text zwei in der Süddeutschen stellte in einem Ton des Vorwurfs fest, der so klang, als käme er vom Meister selbst: „Die Deutschen wollen nicht, was Habeck wollte“. Nämlich ein bisschen Degrowth und eine Neudefinition von Wohlstand. Wobei: Sowohl das eine wie das andere bekommen ja Mitarbeiter des Blattes derzeit gleich reihenweise. Im Tagesspiegel frug Malte Lehming: „ist er zu klug für die Politik?“ (Eine Teilantwort gibt es hier).
Der gleiche Tagesspiegel-Redakteur schrieb übrigens 2010: „In Berlin gibt es ausländische Jugendbanden. Das ist ein Problem. Noch größer wäre das Problem, wenn es sie nicht gäbe.“ Klug genug für die Medienarbeit ist der Mann also allemal.
Mit einem etwas zweischneidigen Erfolg druckte die Süddeutsche noch einen Text mit der Überschrift: „Der letzte echte deutsche Denker nimmt Abschied“. Dabei handelte es sich um eine Glosse. Nur lag die eben für sehr, sehr viele deutsche Mediennutzer, die nur die Überschrift lesen und nicht auch noch hinter die SZ-Bezahlschranke steigen, deutlich neben ihrem Erwartungsraum.
So hart, dass ein viel zu vornehmer Schwachkopf deswegen die Staatsanwaltschaft Bamberg bemühen würde, dürfte der milde Spott aus München aber nicht ausgefallen sein.
Die beste und vollumfänglichste Würdigung des früh Gegangenen findet sich allerdings nicht in den einschlägigen Habeckfachmedien, sondern hier.
Während Habeck feststellt, dass die Wähler an ihm versagten, weshalb er keinen Möglichkeits- beziehungsweise Erwartungsraum mehr mit ihnen zu teilen, sondern vielmehr einen Ozean zwischen sie und sich zu bringen wünscht, äußerte sich Angela Merkel in einem sehr ähnlichen Sinn, nur mit anderen Worten, und zwar zum 10. Jahrestag ihres Satzes: „Wir schaffen das.“ Im Original sagte sie das damals nicht exakt so, sondern drückte sich in habeckähnlichen Windungen aus. Trotzdem blieb diese Kurzform im öffentlichen Gedächtnis, bei den öffentlich-rechtlichen Medien in Reinform, bei etlichen Normalbürgern in Verbindung mit Ortsnamen wie Freiburg, Kandel, Würzburg, Brokstedt, Mannheim, Solingen, Aschaffenburg, Friedland und vielen anderen. In jedem dieser Fälle handelte es sich bei den Totschlägern und -stechern um Migranten, die nicht vor politischer Verfolgung flohen, die nie hätten ins Land kommen dürfen, und die in den meisten Fällen auch schon lange vor ihren Taten einen Ablehnungsbescheid bekamen. Und eben trotzdem bleiben durften.
Merkel leistete, wie sie selbst es sagen würde, einen Beitrag für den propagandistisch-politischen Apparat, der diesen Zustand absicherte. Zu besagtem Zustand gehören nicht nur Messergebrauch auf der Straße, Betonklötze vor Volksfesten beziehungsweise keine Volksfeste, sondern auch seit 2015 ein dramatischer Verfall der Schulqualität und eine wachsende Zahl von Vandalismusakten, die sich gegen Kirchengebäude richten. Forscher resp. Forschende rätseln seitdem, woran das liegen könnte. Ein vom ZDF befragter Experte vermutete kürzlich als Ursache der Messergewalt: „Das Leben ist teurer geworden.“
Was man beispielsweise am Buchmarkt studieren kann: Angela Merkels Rechenschaftsbericht „Freiheit“ kostet satte 42 Euro.
Der Religionssoziologe Detlef Pollack wiederum stellte die These auf, die unbestreitbare Zunahme der Kirchenbeschädigungen seit 2015 liege wahrscheinlich an den Missbrauchsfällen. Das öffentliche Dummstellen zählte zu den Disziplinen, die Merkel aus dem Effeff beherrschte. Jetzt, befreit von der Amtsbürde, genießt sie das Privileg, sich ein bisschen direkter äußern zu können. „Ich war immer wieder verwundert“, sagte sie zum 10. Wirschaffendas-Jahrestag in der ARD, „wie sehr mir diese drei Worte um die Ohren gehauen wurden. Ich habe nicht gesagt: Ich schaffe das. Sondern: Wir schaffen das, weil ich auch auf die Menschen im Lande gehofft habe.“
Nun kann man als Mensch im Lande natürlich fragen, wem denn die Worte sonst um die Ohren gehauen werden sollten, wenn nicht ihrer Urheberin. Die Antwort kennt Madame natürlich: Selbstverständlich eben diesen Menschen, auf die sie hoffte. Sie selbst gab, was sie konnte, wozu es auch gehörte, weder zu verraten, was eigentlich geschafft werden sollte, noch, ob die Menschen, die schon länger hier wohnen, das mehrheitlich überhaupt schaffen wollten.
Im Rückblick muss sie nun feststellen: Das deutsche Volk hat sich als zu willkommensschwach erwiesen. Mit ihrer Bemerkung gibt sie erstmals zu, dass das Experiment bisher etwas suboptimal verlief, jedenfalls aus der subjektiven Sicht von Leuten, die sich nicht ständig in Begleitung von drei BKA-Personenschützern durch den Möglichkeitsraum Deutschland bewegen. Aber genau diesen Durchschnittsexistenzen weist sie auch die Schuld für die benörgelte Lage zu. Damit bewegt sie sich in einer gewissen deutschen Staatslenkertradition, den Geführten am Ende die Verantwortung weiterzureichen und ihnen zu erklären, sie sollten jetzt gefälligst nicht so überrascht tun, was die Konsequenzen anbelangt. „Wer Vielfalt will, muss Toleranz üben“, erklärte sie einmal in einer ihrer großen Reden. Sie behauptete also nie, das Einreißen der Grenzen würde das Leben im Land allgemein angenehmer und sicherer machen, sondern machte immer klar, dass sie das, was 2015 ff. kam, als Prüfung für die Menschen da draußen verstand, die sie vielleicht bestehen konnten, vielleicht aber auch nicht.
Die Leute hätten natürlich einmal fragen können, warum sie überhaupt jedes Jahr ein bisschen mehr Toleranz aufbringen sollen, zumal das Wort sich von tolerare herleitet, also ertragen. Das hier zum Beispiel. Und noch einiges mehr:
Pro-Hamas- und Anti-Drusen-Aufmärsche, Zonen in Berlin, von denen sich laut offizieller Warnung Juden und Schwule besser fernhalten sollten, Schulen, an denen die Schüler erklären: „Hier ist der Islam Chef“. Und eine von einer Stasispitzelin gegründete Organisation mit mittlerweile 95 hauptamtlichen Mitarbeitern, die gerade der Öffentlichkeit erklärte, die 16-Jährige, die ein Iraker in Friedland vor den Zug stieß, sei nicht etwa getötet worden, sondern „gestorben“ – und der Iraker das eigentliche Opfer, da unzureichend umsorgt. Man sollte immer wieder daran erinnern, dass es sich bei der Amadeu Antonio Stiftung unter Rot-Grün um ein Nischenpflänzchen handelte, das erst durch den Millionenregen nach 2015 so richtig aufblühte.
Merkel gehört zweifellos zu den wenigen deutschen Staatspersonen, deren Wirken die Zeit in ein Vorher und Nachher teilt. Das kann man beispielsweise von Olaf Scholz nicht behaupten. Noch nicht einmal von Robert Habeck. Jedenfalls bleibt sie zwar in Deutschland, vorläufig jedenfalls, zieht aber mit ihren Worten symbolisch schon mal die Tür hinter sich zu. Den Satz „die Zukunft gehört dem stärkeren Südvolk“ verkneift sie sich. Den sprechen dafür andere aus.
Jedem dieser beiden Abschiede wohnt ein Schauder inne. Die dritte, die sich gerade davonmacht, genießt eine nicht ganz so große öffentliche Bekanntheit. Viele Leute wussten gar nicht, dass Melanie Amann den Spiegel leitet, sondern ordneten sie als Sidekick von Markus Lanz ein. Die Journalistin verlässt jedenfalls zum Ende des Jahres nicht nur das Magazin, das Trump auf dem Titelblatt mal als weltverschlingenden Kometen und mal als Kopfabschneider darstellte, sondern auch das Land und zwar wie Habeck in Richtung USA. Vor einiger Zeit sagten Medienschaffende eine Fluchtwelle kluger und klügster Köpfe aus Amerika nach Deutschland voraus. Jetzt herrscht bemerkenswerter Gegenverkehr über dem Atlantik.
Die Kosten für Amanns Lehraufenthalt in Harvard kommen, wie man hört, aus einem deutschen Steuertopf. Wenn die öffentliche Hand nur genügend Geld in die Hand nimmt, richtet Harvard oder eine andere Hochschule möglicherweise auch noch eine Gastprofessur in amerikanischer Geschichte für Elmar Theveßen ein. Einen Versuch wäre es wert.
Die Frau vom Spiegel verlor einen interredaktionellen Machtkampf, geht aber auch sonst als Beleidigte, denn Robert Habeck verschmähte bei „Lanz“ ihren guten Rat, in Deutschland eine NGO zu gründen, um mit Regierungsgeld gegen rechts zu kämpfen. Da sie sich wie erwähnt erst zum Jahresende empfiehlt, trägt sie noch die Mitverantwortung für den Spiegel-Text über die Geburtstagsfeier des Molkereiunternehmers Theo Müller und die entsprechende Liste von investigativen Fragen, die zwei Redakteurinnen des Blattes Müller zuschickten.
Bei dessen Geburtsparty kreuzten nämlich Gäste auf, die auf einer besonderen Gefährderliste der Redaktion in Hamburg stehen, ein Dokument, das der Milchhersteller gar nicht zu kennen scheint. „Steckt dahinter die Absicht, die AfD bzw. ihr rechtsextremes Gedankengut regierungsfähig zu machen?“, will die Redaktion von Müller wissen. Und noch viel mehr. In dem Fragenkatalog heißt es beispielsweise: „In einem Video vom 14.12.2023 lobt Roger Köppel Sie als ‘fulminanten Unternehmer‘, legt aber nicht offen, wie gut Sie sich kennen. Wie lange kennen Sie sich so gut, dass Sie ihn zu Ihren Feiern einladen und woher?“ Er. Legt. Es. Nicht. Offen. So beginnt der Faschismus.
Eine weitere Frage – allerdings ohne Fragezeichen oder Punkt – zu Geburtstagsgast Rainer Zitelmann lautet:
„Herr Zitelmann hat bereits vor 30 Jahren einen geschichtsrevisionistischen ‘Appell gegen das Vergessen‘ initiiert und gilt als früher Ermöglicher der sogenannten Neuen Rechten. Er veröffentlichte unter anderem eine verharmlosende Hitler-Biografie, die man heute unter anderem im Shop des rechtsextremen Compact-Verlags kaufen kann. Finden Sie das unproblematisch?“
Bei Zitelmanns 1986 erschienenen Buch „Hitler. Selbstverständnis eines Revolutionärs“ handelt es sich mitnichten um eine Biografie, sondern um Zitelmanns Dissertation als Historiker, die sich mit Hitlers wirtschafts- und sozialpolitischem Konzept befasste. Wer so fragt wie die beiden Spiegel-Vertreterinnen, kennt ganz offensichtlich nicht eine einzige Seite dieses Buchs, sondern höchstens einen einschlägigen Eintrag dazu aus dem Formenkreis staatsfinanzierter Meinungsbekämpfungsstiftungen.
Zitelmanns Studie erhielt damals übrigens positive Kritiken in der Süddeutschen („ebenso quellennah wie reflektiert, ebenso kritisch wie schöpferisch“), in der FAZ („Die Stärke der Arbeit liegt darin, vorurteilsfrei und neugierig die Quellen gelesen und ausgebreitet zu haben“), dem NDR und etlichen anderen Medien, in denen damals noch ernstzunehmende Personen statt Knallchargen und -charginnen saßen. In dieser Mediengeneration wusste man auch noch, dass Verlage ihre Bücher an alle Buchhandelsplattformen liefern, also auch an die von „Compact“. Natürlich kann man Zitelmanns Buch auch auf Amazon, anderen Seiten und in jedem Buchladen bestellen. Die Verhörfragen des Amann-Spiegel und der dazugehörige Denunziationstext strahlen eine solche Brummdummheit aus, dass man sich fast schämt, mit den Zuständigen den gleichen Möglichkeitsraum zu teilen. Zumal R. Habeck und M. Amann, die ihm Charisma bescheinigt – laut Definition „Gesamtheit der durch den Geist Gottes bewirkten Gaben und Befähigungen des Christen in der Gemeinde“ oder ganz weltlich „besondere Ausstrahlungskraft eines Menschen“ –, früher oder später höchstwahrscheinlich nach Deutschland zurückkehren.
Gäbe es die Medien- und die allgemeine Öffentlichkeit von 1986 noch, dann wäre Habeck spätestens seit seinen Ausführungen zur Pendlerpauschale und zur Insolvenz von der Bühne gelacht worden; Merkels Kanzlerschaft hätte sich spätestens nach 2015 erledigt. Und eine Spiegel-Chefredakteurin Amann wäre gar nicht erst in die Nähe des Möglichkeitsraums gekommen, ebenso wenig Redakteurinnen, die es für Recherche halten, MfS-ähnliche Verhörfragen zu verschicken. Unter den Verhältnissen der alten Bundesrepublik müsste also niemand sein Taschentuch zum Abschiedswinken entfalten, weil dann alle Betreffenden höchstens im Mittelbau der Gesellschaft geblieben wären.
Es kam bekanntlich anders.
In Peter Alexanders „Sag beim Abschied leise Servus“ heißt es: „So ist’s halt im Leben /
Und drum kann’s auch eben / Ew′ge Lieb′ nicht geben.“
Das sollten sich die Vertreiber von Habeck-Merkel-Amann gefälligst hinter die Ohren schreiben.
Dirk Schwarzenberg verfasste früher Kriminalromane und bleibt auch als Journalist dem Genre im weitesten Sinn treu. Er lebt und arbeitet in Bayern. In der neuen Publico-Kolumne „Frisch gepresst“ behandelt er gesellschaftliche Stilfragen.
Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” – fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt –, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.
Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.
Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.
Publico ist am Ende, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.
Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto
A. Wendt/Publico
DE88 7004 0045 0890 5366 00
BIC: COBADEFFXXX
Die Redaktion
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.


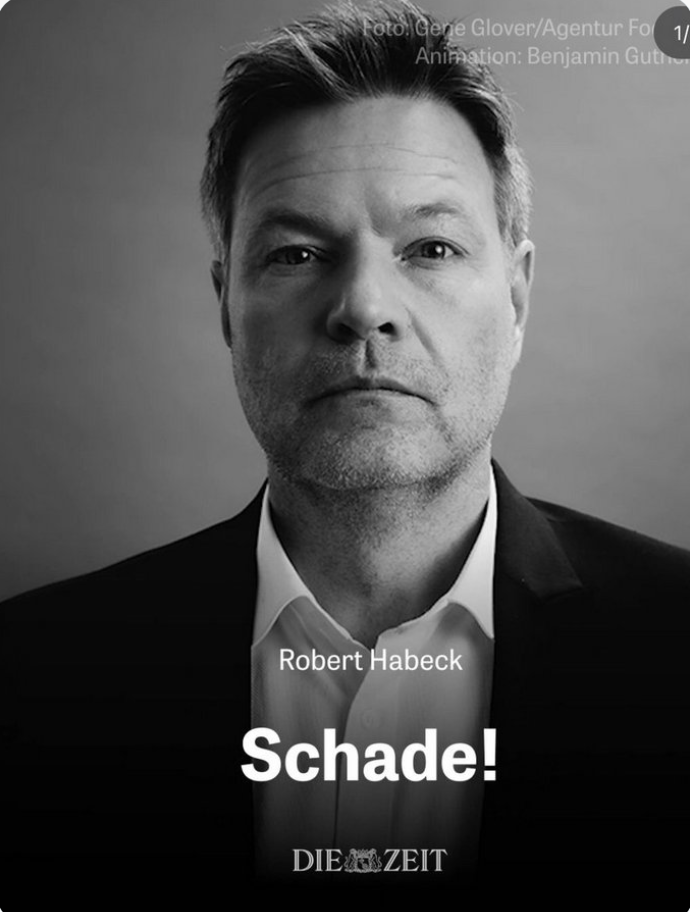



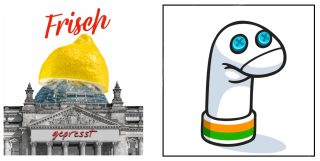
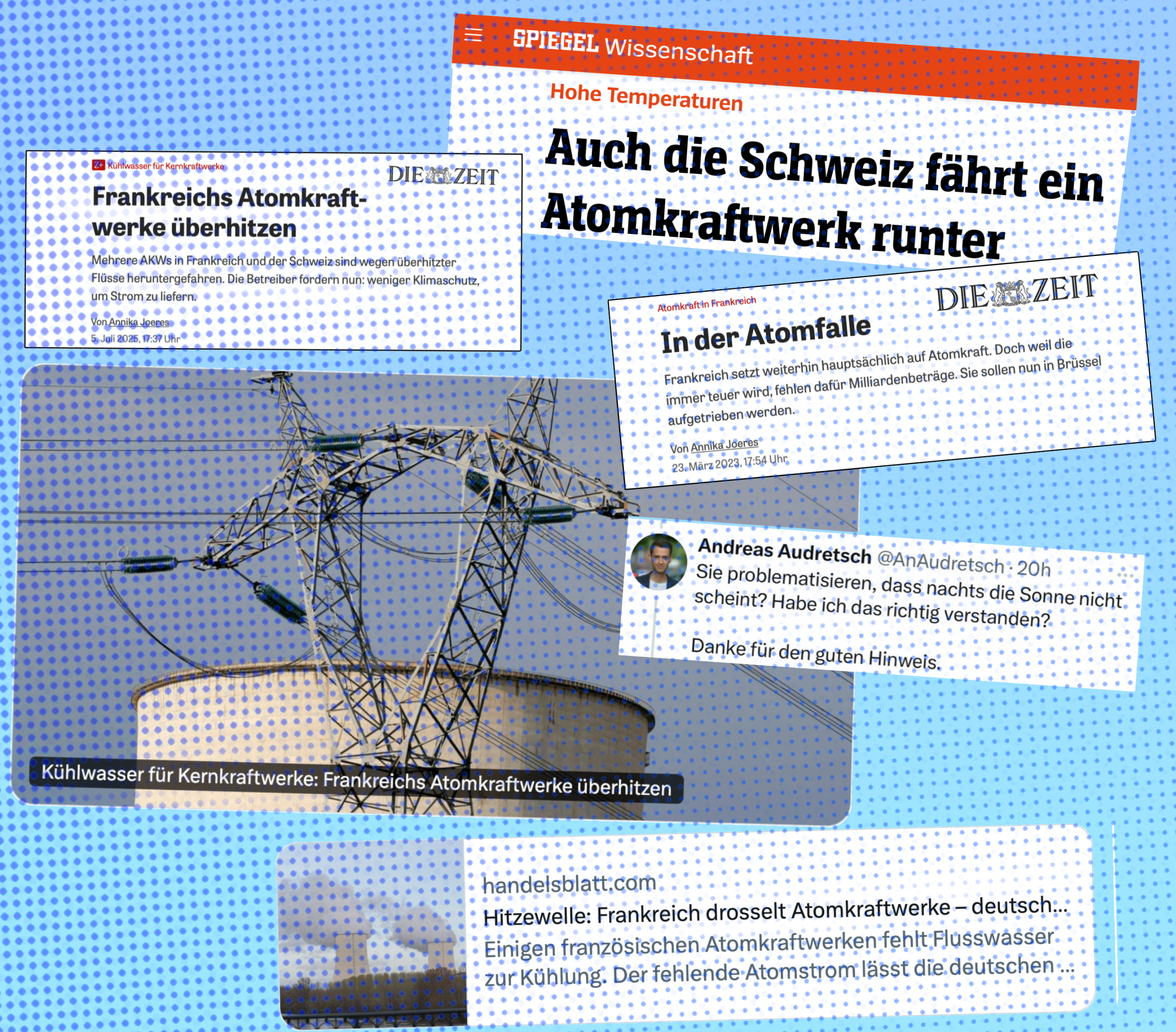
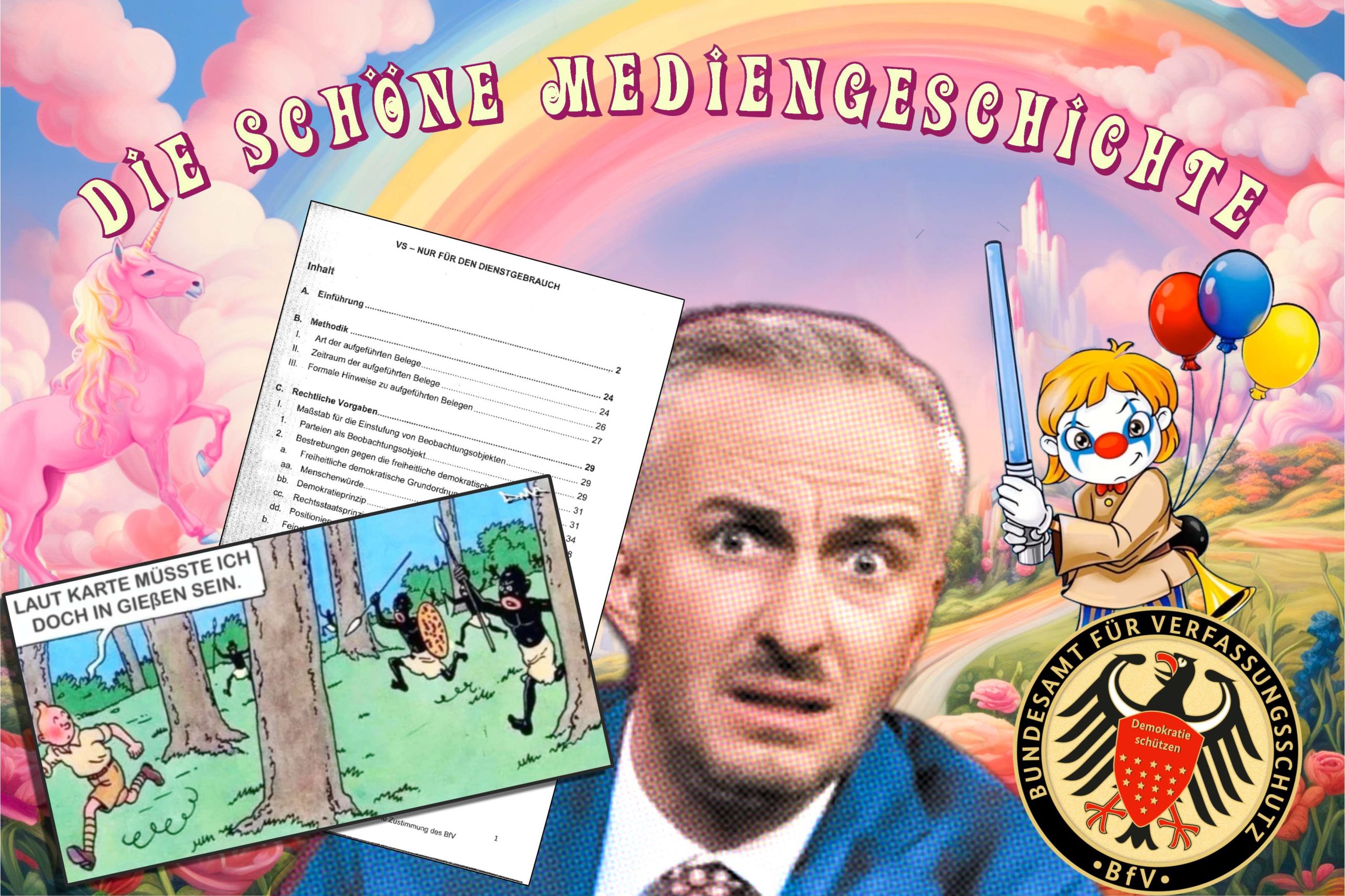


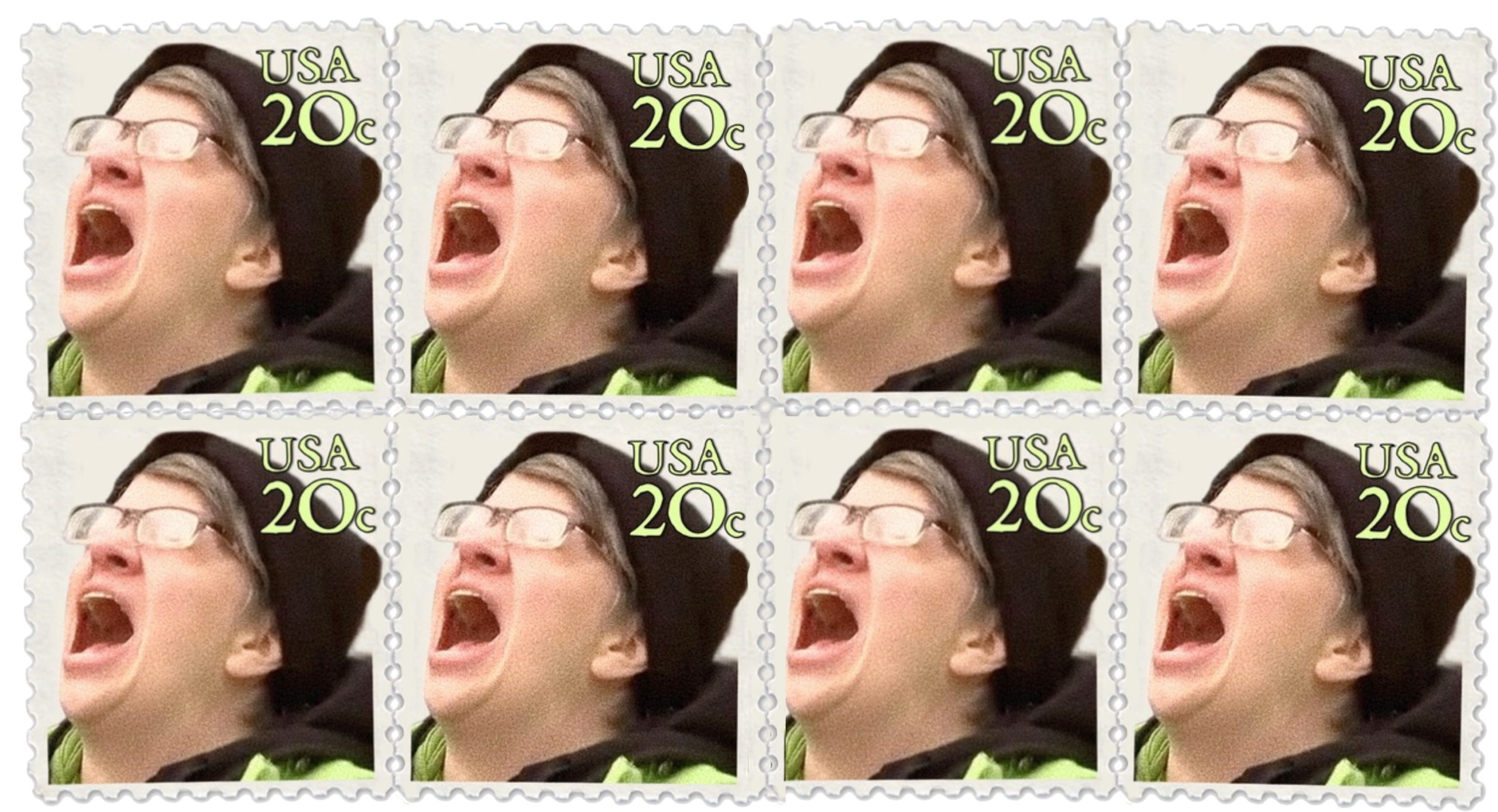

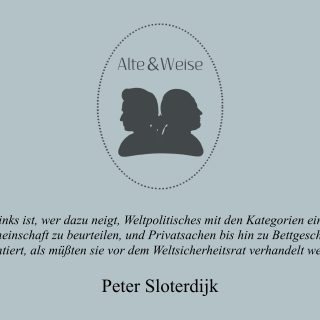
Johanna
04.09.2025Was für ein wunderbarer und wunderbar zu lesender Artikel! Passt sehr gut zu Publico. Danke!
Petersilikum
04.09.2025„Gastprofessur in amerikanischer Geschichte für Elmar Theveßen“ OMG
Nachrufer
04.09.2025Brillante Artikel dieser Art konnte man im zitierten Jahr 1986 noch in Publikationen lesen, die am Kiosk erhältlich waren.
Christian
05.09.2025Das Niveau stürzt ab.
In allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.
Unser einziger Rohstoff, die Bildung, ist im dramatischen Sinkflug begriffen. Der Durchschnitts IQ ist messbar gefallen. Jedes Jahr verlassen eine Viertelmillion Leistungsträger das Land, die gleiche Summe Analphabeten strömt herein.
Das ist das Ende.
Nelke
05.09.2025Meinem Eindruck nach bereichert der neue Autor den Möglichkeitsraum von publico aufs vortrefflichste. Das musste ich jetzt mal rasuhauen, da ich ein bissl in den Begriff „Möglichkeitsraum“ verliebt bin, dessen variable Anwendungsmöglichkeiten in diesem gelungenen Artikel wunderbar demonstriert werden.
Und was sagt die Google-KI zum Möglichkeitsraum.
Alles klar. Ich denke, der Möglichkeitsraum ist für den Meisterschwurbler Habeck der ideale Aufenthaltsort.
Schilling Dieter
07.09.2025Ich habe irgendwann irgendwo im tv dem r.h. zugehört und wollte mir notizen machen über seine Art sich auszudrücken,wie etwa das:
„Hätte ich gewußt – hätten wir gewußt…“
“ …das garantiert der Mindestlohn- oder soll es garantieren…“
„…war erschreckend und auch erschreckend neu…“
Ich hab dann aufgegeben,ich konnte mir dieses Geschwafel und Geschwurbel einfach
nicht mehr antun.
Materonow
16.09.2025Ein herausragender Artikel über zwei Figuren der Nachkriegswelt, die unermeßlichen Schaden im Siedlungsraum Rhein-Oder verursacht haben. Die eine ging mit einer Sonderkreation des Bundesverdienstkreuzes, der andere trat schwer beleidigt nach und keilte aus, wie ein von einer Wespe gestochenes Weidetier.
Über die verspiegelte Knallcharge ist weiter nichts zu erwähnen als das Bedauern der „Omas-gegen-rechts“, eine keifende Knallfröschin weniger zu haben.
Patrick Büttner
21.09.2025Wieso muß für den Zustand der verfaulten BRD das MfS herhalten? Das nervt… und es ärgert mich, bis dahin gelesen zu haben. Macht euern Dreck alleine und laßt die DDR aus dem Spiel.