Die Selbstgefälligkeit der Diskurstechnokraten täuscht: In Wirklichkeit zeigt ihre Kaste schwache Nerven. Debatten lassen sich nicht mehr wie früher abwürgen. Und manchmal entscheiden auch Gerichte anders als erwartet
Zu der kalkulierten, durchchoreografierten und trotzdem sehr unerfolgreichen Linksreaktion auf die Stadtbild-Bemerkung von Friedrich Merz gehörte die Flutung der Plattform X mit generischen Memes, die jeweils aus historischen Fotos bestand, kombiniert mit einem kurzen Text.
Ein Post zeigt beispielsweise ausgebombte Deutsche in einer Ruinenstraße nach einem Luftangriff im Zweiten Weltkrieg und dem Pseudodialog: „Mama, wie konnte das damals nur passieren?“ – „Wir wollten ein anderes ‚Stadtbild‘, mein Kind.“In einer Wortmeldung des ehemaligen RBB-Zuarbeiters Sebastian Hotz auf X marschiert die Wehrmacht durch Berlin, der Kommentar lautet: „Wie sich Friedrich Merz ein ansprechendes Stadtbild vorstellt“.
Ohne es selbst zu merken, führen diese und andere progressiven Kämpfer ihre Weltvorstellung in konzentrierter Form vor. Entweder, so lautet ihre Botschaft, akzeptiert die Bevölkerung das von ihnen geprägte und genau so gewollte Stadt- und Landbild, zu dem Betonsperren um jedes Volksfest gehören – die beim Vielfaltsfest in Solingen allerdings nicht halfen –, außerdem Messerverbotszonen, Männergruppen in Parks und auf Bahnhofsvorplätzen, Aufmärsche im Stil von Ramallah, die aber in Berlin stattfinden, Besetzungen von Universitäten durch einen hamasfreundlichen Mob unter den Augen einer islamistenfreundlichen Universitätsleitung, Veranstaltungen an Hochschulen mit geschlechtergetrennter Sitzordnung, dazu auch noch Erklärungen regierender Politiker, dass es für Antisemitismus keinen Platz gibt und wir uns unsere Art zu leben keinesfalls nehmen lassen.

Entweder also, so lautet die Quintessenz, das oder Wehrmachtsknobelbecher und zerbombte Städte. Damit markieren die Anhänger dieses Weltbilds zwei Extreme, die sich durch eine zwar nicht unmittelbare, aber auch nicht ganz ferne Verwandtschaft auszeichnen. Für eine übergroße Mehrheit im Land liegt der erstrebenswerte Zustand genau dazwischen. Wer sich die Augen nicht absichtlich zuhält, der sieht, mit welchen Leuten sich eine Gesellschaft zwischen diesen Extrempunkten vielleicht erhalten lässt, und mit wem garantiert nicht.
Was Merz, der inzwischen schon wieder halb zurückruderte, mit „Stadtbild“ meint und was nicht, wissen alle. Auch die Empörungsbeauftragten. Auch die „Eltern“, „Omas“ und öffentliche Angestellte gegen rechts, die am Wochenende vor dem Brandenburger Tor mit ihren Handylampenfackeln „Wir, wir, wir sind das Stadtbild“ und „Die Brandmauer hoch“ skandierten. Wobei „die Brandmauer hoch, die Reihen fest geschlossen“ noch einen historischen Tick besser gepasst hätte.
Es handelte sich übrigens um eine nahezu reinweiße Almanveranstaltung, abgehalten auf einem Platz, der in Berlin wie das eine aufgeräumte Zimmer in einer Messi-Wohnung wirkt. Warum finden Kundgebungen dieser Güte nicht auf der Sonnenallee statt, also an der politischen Basis des Stadtbildners, der ab nächstem Jahr die Hauptstadt regieren könnte?
Die Antwort lautet: Weil die Marschierer für das eine Extrem dort womöglich auf ein Stück Stadtbild stoßen, an dem sie mit größter Anstrengung vorbeisehen müssen, um ihre Kampfmoral nicht zu gefährden.
Es gibt übrigens nicht wenige Migranten, die sich einerseits an diesen Stadtbildern stören, und zum anderen wissen, dass Merz nicht sie meint – also diejenigen, die ausdrücklich in einem westlichen und geordneten Staat leben möchten. Genau diejenigen müssen sich von Linksweißdeutsch öffentlich zurechtweisen lassen, in diesem Fall von einem „Volksverpetzer“- Typ, weil sie sich nicht in eine Inszenierung einfügen, die für einen großen Teil des politisch-medialen Raums mittlerweile die real existierende Gesellschaft ersetzt.
In dieser Gesamtinszenierung besteht das Problem in deutschen Schwimmbädern darin, dass weiße Frauen dunkelhäutige behinderte Jungen angrapschen und blonde Man-Bun-Träger im U-Bahnhof türkische Frauen belästigen. Der Import muslimischer Männer – teils per Flugzeug – macht die Gesellschaft bunter und lebenswerter, gleichzeitig gibt es keine größere Bedrohung als toxische und überhaupt Männlichkeit.
In diesem in unendlich vielen Folgen aufgeführten Stück verdankt Deutschland außerdem das Wirtschaftswunder der fünfziger Jahre den türkischen Gastarbeitern, die ab 1961 kamen, jedenfalls verhält es sich nach Ansicht des Außenministers aus Berlin so (und nicht nach Meinung des Kollegen aus Ankara).
Die Überrepräsentation bestimmter Migrantengruppen in der Kriminalstatistik liegt an der verzerrten Statistik beziehungsweise daran, dass überhaupt jemand zählt; dass zehntausende Jobs in der Autoindustrie verschwinden, rührt wiederum daher, dass die Unternehmen nicht genügend Elektroautos auf Halde bauen, die hohen Energiepreise kommen davon, dass noch nicht genügend Windräder auf den Feldern stehen. In dieser Welt erregt sich auch eine prominente Grünenpolitikerin, die während der Fußball-EM Spieler öffentlich nach Hautfarbe in Qualitätsklassen einteilte, über das angeblich rassistische „Stadtbild“-Wort.
Und es versteht sich dort auch von selbst, von einer nur gefühlten Unsicherheit der Bürger zu reden und gleichzeitig reihenweise Volksfeste abzusagen, die ihre Sicherheitsauflagen nicht mehr erfüllen können. Ein anderer Programmpunkt verlangt, Hinweise auf die wacklige Energieversorgungslage als rechte Panikmache zu rahmen.
Zusätzlich ergeht an die Bevölkerung der offizielle Aufruf, einen Notvorrat für mindestens 72 Stunden einzulagern.
Einerseits gibt es inzwischen eine Ausgabe von Orwells „1984“ mit einem Vorwort von Robert Habeck, andererseits gehören Leute, die das Wort Doppeldenk auf dessen Milieu anwenden, zu dem Hassmob, der sich nicht wundern soll, wenn die staatsfinanzierte Zivilgesellschaft ungehalten reagiert. Für Doppeldenk aka kognitive Dissonanz gilt nämlich: immer praktizieren, nie davon sprechen.
Laut Spiegel und anderen Organen marschierte die Trump-USA mit der sechstägigen Sendepause für Jimmy Kimmel bei dem privaten Sender ABC den nun wirklich allerletzten Meter in den Faschismus. Bei der dauerhaften Absetzung der mäßig konservativen Moderatorin Julia Ruhs beim Zwangsbezahlsender NDR wegen der Abstoßungsreaktion, die sie beim lauten und gut organisierten Teil der Belegschaft auslöste, handelt es sich dagegen laut Katrin Göring-Eckardt um „einen ganz normalen Vorgang“.
 Womit die Politikerin schon richtig liegt, wenn sie sich auf die innere Normalität einer Sphäre beziehen, in der schon das Wort „Zwangsbeitrag“ einen tagelangen Empörungstremor auslöst, ähnlich wie „Mauer“ in einem anderen totalen Binnensystem erlaubter und verbannter Begriffe zu einer anderen Zeit. Damals lautete die strenge Zurechtweisung in der Schule und später von den Aufpassern bei der Arbeit: „Das heißt antifaschistischer Schutzwall.“ Wer diesen Tonfall von damals wieder hört, wenn er eine Social-Media-Kachel mit dem Antlitz von Georg Restle sieht, der kann nichts dafür. Es gibt nun einmal eine Reihe unwillkürlicher Körperreflexe.
Womit die Politikerin schon richtig liegt, wenn sie sich auf die innere Normalität einer Sphäre beziehen, in der schon das Wort „Zwangsbeitrag“ einen tagelangen Empörungstremor auslöst, ähnlich wie „Mauer“ in einem anderen totalen Binnensystem erlaubter und verbannter Begriffe zu einer anderen Zeit. Damals lautete die strenge Zurechtweisung in der Schule und später von den Aufpassern bei der Arbeit: „Das heißt antifaschistischer Schutzwall.“ Wer diesen Tonfall von damals wieder hört, wenn er eine Social-Media-Kachel mit dem Antlitz von Georg Restle sieht, der kann nichts dafür. Es gibt nun einmal eine Reihe unwillkürlicher Körperreflexe.
Für diese Inszenierung einer hermetisch abgeschlossenen Sonderwelt bietet der öffentlich-rechtliche Rundfunk die mit Abstand größte und teuerste Bühne. Die Darsteller dort erinnern an die dauergrinsenden chinesischen Blechkatzen mit dem unermüdlichen Wackelarm. Damit grüßen sie zum einen einander in Redaktionen, Talkshowstudios und auf Preisverleihungsgalas, zum anderen die Menschen draußen im Land. Gerade die Tatsache, dass sie dort jenseits des wohlgesinnten Milieus weitgehend ins Leere winken, gilt im Automatenreich als gutes Zeichen. Denn dort sieht man sich als Vorhut, die den noch weit entfernten Rest mitnehmen muss. Die ARD-Frau Anja Reschke zieht aus dieser Sicht durchaus den richtigen Schluss, wenn sie meint, dass ihr ein Erziehungsauftrag zufällt, ob sie nun will oder nicht. Aber keine Bange, sie will ja.
In Afrika benutzt man den Begriff „fat cats“ für Personen, die ihren Wohlstand beziehungsweise Reichtum keinem unternehmerischen Fleiß verdanken, sondern ihrer Fähigkeit, am richtigen Ende einer Geldpipeline zu sitzen. Für die oberen Etagen der Öffentlich-Rechtlichen bietet sich also die Kombibezeichnung „fette Grinsekatzen“ an.
Am 1. Oktober 2025 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine interessante Verhandlung statt. Es ging um die Klage einer Bürgerin aus Bayern gegen die 18,36-Euro-Sender. Die Frau kürzte den Rundfunkbeitrag von sich aus, um deutlich zu machen, dass sie das Angebot für politisch einseitig hält, obwohl Rundfunkstaatsverträge und Medienstaatsvertrag Ausgewogenheit, Realitätsnähe und Meinungsvielfalt fordern. Sie wollte und will also die Öffentlich-Rechtlichen nicht beseitigen, obwohl sie vielleicht in letzter Konsequenz dazu beiträgt, sondern erst einmal für ihr zwangsweise abverlangtes Geld ein vertragsgemäßes Programm.
Damit verlor sie vor zwei bayerischen Verwaltungsgerichtsinstanzen, die sich ganz auf die Seite der Öffentlich-Rechtlichen stellten. Denn die meinen seit eh und je, sie würden den Programmauftrag schon dadurch erfüllen, dass sie überhaupt etwas senden. Beispielsweise mit „Monitor“, „Panorama“, „Reschke-Fernsehen“ und beim NDR „Klar“ ohne Ruhs. Wem das nicht passt, so lautet die Empfehlung führender Grinsekatzen in den Anstalten, der kann Programmbeschwerde einlegen.
Der Vorsitzende des 6. Senats in Leipzig machte in der Verhandlung deutlich, dass er dieser Argumentation nicht folgt. Zum einen wies er darauf hin, dass es sich bei der Programmbeschwerde um ein reines Petitionsrecht handelt, das den Beschwerdeführer zu nichts berechtigt und die Anstalten zu nichts verpflichtet. Zweitens deutete er an, was sich später auch im Urteil wiederfand: Das Leipziger Gericht entschied, dass Verwaltungsgerichte ab jetzt prüfen können und müssen, ob ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren Programmauftrag erfüllen. Genau das lehnte die Verwaltungsgerichtsbarkeit bisher mit dem Hinweis auf eine generelle Unzuständigkeit ab.
Zwar steckte das Bundesverwaltungsgericht die Grenzen weit, indem es den Nachweis einer „gröblichen Verletzung“ der Meinungsvielfalt im gesamten Programm über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren forderte. Erst dann könnten die Anstalten ihr Recht auf die Rundfunkgebühr verlieren. Aber bis zur Urteilsverkündung am 15. Oktober gab es noch nicht einmal diese rote Linie. Mit anderen Worten, es ging in Leipzig um die Existenzgrundlage eines Imperiums oder, um im Bild zu bleiben, um die Stromzufuhr für die fröhlichen Katzen.
Zwar noch nicht ganz direkt; andererseits rechneten auch die wenigsten damit, dass eine einzelne Klägerin überhaupt so weit kommen würde. Man hätte also erwarten können, dass sich die Beklagten ein wenig konziliant und selbstkritisch geben. Die drei Anwältinnen der Sender führten im Saal allerdings genau die vollautomatischen Wackeltatzenbewegungen auf, die jeder seit Jahren von den Intendanten kennt. Die Öffentlich-Rechtlichen seien schon ausreichend kontrolliert, auf kritische Einwände gehe man selbstverständlich ein, allenfalls könnte man überlegen, die Verpflichtung zu Vielfalt und Ausgewogenheit in Zukunft noch besser zu erfüllen.
Der Wortführerin rutschte heraus, die Sender würden ja durchaus reagieren, „wenn sie mit Kritik belästigt werden“. Sie wollte eigentlich sagen: mit Kritik konfrontiert. Ein bisschen später meinte sie noch: „Wir wollen niemals jemanden indoktrinieren.“ An beiden Stellen gab es große Heiterkeit im Publikum, beim ersten Mal lachte sogar der Vorsitzende Richter ein bisschen mit. Im Bericht des ZDF hieß es später, die Zuhörer hätten mit „Johlen“ reagiert. Worauf eigentlich, das blieb unerwähnt.
Zum einen zahlen schon jetzt geschätzte drei Millionen Menschen ihren Rundfunkbeitrag gar nicht mehr oder reduziert. Demnächst kann jeder gegen seinen Gebührenbescheid mit dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil im Rücken klagen. Die geforderten Langzeitdaten zur Einseitigkeit von ARD, ZDF und DLF liegen längst vor, nämlich aus der Hand des Schweizer Unternehmens MediaTenor. Trotz aller Versuche schafften es die Sender bis jetzt nicht, sie zu erschüttern, und schon gar nicht, irgendetwas davon zu widerlegen.

Eigentlich könnten Sender erleichtert auf Kläger und Demonstranten reagieren, die nichts mehr als das verlangen, was schon in den Rundfunkstaatsverträgen steht. Revolutionen ereignen sich bekanntlich dann, wenn Inhaber von Machtpositionen gar keine Zugeständnisse machen. In Leipzig passierte das bekanntlich schon einmal. In ihrem Beharrungsvermögen stehen die Grinskatzen der Anstalten idealtypisch für eine technokratische Kaste, die sehr viel mehr als das Rundfunksystem umfasst. Deren Vertreter spüren die Erschütterungen im Fundament. Gleichzeitig glauben sie an ein unbegrenztes Weiterwackeln. Man glaubt dort daran, dass die nächsten Gerichte wieder zu ihren Gunsten urteilen, dass die zurzeit von den Landtagen angehaltene Gebührenerhöhung doch noch kommt, auch daran, dass der Steuerzahler einspringt, wenn die Sender die Pensionslast für ihre Funktionäre nicht mehr allein tragen können. Und generell erwartet man, dass die Brandmauer Mehrheitsverhältnisse verhindert, die das eingespielte System ernstlich stören könnten.
Auf der oberen Ebene dieser Technokratur herrscht außerdem die Überzeugung, die größte Oppositionspartei einfach verbieten, die Debatte über die katastrophale Migrationspolitik durch die Skandalisierung des Wörtchens „Stadtbild“ abwürgen und ein nichtlinkes Medium mit Gewaltandrohung zum Schweigen bringen zu können. Bisher führte die Aufforderung „rechten Medien auf die Tasten treten“ gegen die Redaktion von Apollo in Berlin-Treptow, vorgebracht von Linkspartei und einer Mitarbeiterin der staatsfinanzierten Amadeu Antonio Stiftung, weder zu einer Distanzierung der anderen linken Parteien von der umetikettierten SED noch zum Steuergeldentzug für den VEB Hetzen und Zersetzen. Die Methode funktioniert also immerhin so weit, dass sie denen nicht schadet, die sie anwenden.
Die Frage des Publikums, das sich die Gesamtinszenierung auch nur mit der kleinsten inneren Distanz anschaut, lautet: Glaubt in dieser Kaste tatsächlich jemand, dass die nächsten tausend Windräder den seit 25 Jahren versprochenen Billigstrom bringen, dass Deutschlands Autoindustrie nach dem Verbrennerverbot wieder blüht und Messerverbotszonen Messer verbieten, dass sich toxische Männlichkeit gleichmäßig über alle Männer unter besonderer Berücksichtigung blonder Herrenduttträger verteilt, und dass sich die allgemeine Stimmung nach einem AfD-Verbot wieder hebt? Ein bestimmter Teil der Verantwortungsträger glaubt das natürlich im Leben nicht.
Günter Mittag wusste schließlich auch, wo die DDR-Wirtschaft in Wirklichkeit stand. Für diese Realos unter den Grinsekatzen gilt der immergrüne Satz von Erich Kästner: „Sei dumm, doch sei es mit Verstand“. Ein deutlich größerer Prozentsatz der Kaste scheint es allerdings tatsächlich zu glauben, zumindest unternimmt sie alle Anstrengungen. Dafür spricht schon, dass sie diese Merksätze jeden Tag wie ein Mantra wiederholt, in Talkshowstudios, Tagesthemenkommentaren, Bundestagsreden und sonstigen Festansprachen. Es wirkt so, als wüsste sie immerhin in luziden Momenten, welcher Schacht sich unter ihr auftut, wenn sie auch nur einen Moment mit der Beschwörung aufhören sollte. Also redet sie weiter, so wie die Blechkatzen an ihrer einzigen beweglichen Stelle weiter und weiter wackeln.
Gibt es kein Ende? Die Antwort besteht aus einem relativen und einem grundsätzlichen Teil. Je länger die Abwärtsentwicklung andauert, desto länger braucht die Gegenbewegung, bis sich ein Zustand wieder deutlich bessert. Abwärts geht es außerdem immer schneller als in die andere Richtung. Die bayerische Klägerin gegen den Rundfunkbeitrag begann 2022, die Zahlung teilweise einzustellen und zu prozessieren. Sie verlor wie erwähnt in zwei Instanzen, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ließ auch keine Revision zu. Mit ihrem Anwalt erhob sie Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, und das erfolgreich. Jetzt entschied die Revisionsinstanz – also ebenfalls das Bundesverwaltungsgericht – wie beantragt die Rückverweisung des Verfahrens nach Bayern mit der Auflage, dass dort die Erfüllung des Programmauftrags überprüft werden muss.
Ein Urteil in diesem Prozess fällt voraussichtlich 2026. Falls zugunsten der Klägerin, dann liegt das letzte Wort beim Bundesverfassungsgericht. Natürlich kann niemand voraussagen, wie es ausgeht. Die Resignativen hatten allerdings schon vorher gemeint, nie und nimmer würde die Revision zugelassen. Und dann, dass sie garantiert erfolglos bleiben würde. Auf der Seite der Sender wiederum rechnete wahrscheinlich niemand mit dieser Hartnäckigkeit. Die einzelne Dame bewirkte zusammen mit ihren Unterstützern bisher erstaunlich viel, ähnlich wie ein kleiner Holzkeil im Felsblock.
Diejenigen, die sich in Leipzig mit ihren Protestschildern vor dem Gerichtsgebäude versammelten, lassen sich problemlos fotografieren, sie argumentieren ruhig und in vielen Fällen erstaunlich kenntnisreich. Es macht ihnen nichts aus, dass sie nicht annähernd die gleiche mediale Aufmerksamkeit bekommen wie die „Omas gegen rechts“ mit ihrem „Wir-sind das-Stadtbild“-Aufmarsch vorm Brandenburger Tor. Zum Ausgleich verteilt sich die Relevanz zwischen den beiden Gruppen genau umgekehrt.
In der nicht gesendeten Wirklichkeit herrscht im Komitee der Grinsekatzen eine sehr viel größere Nervosität, als die meisten ahnen. Ein Teil überlegt, ein paar Zugeständnisse zu machen. Der andere warnt: Dann kommt alles erst recht ins Rutschen. Die schwachen Nerven zeigen sich beispielhaft an den Drohungen gegen das eigentlich kleine Medium Apollo und die ganz ähnlich ausgerichtete Unseredemokratie-Agitation gegen die privat organisierte Buchmesse „SeitenWechsel“ in Halle.
Diskurshüter, die wirklich sicher thronen, könnten über diese Ärgernisse hinwegsehen. Oder noch besser: eine kleine nichtlinke Buchmesse zum Beweis echter Diversität erklären. Stattdessen zucken sie beim kleinsten Geräusch zusammen. Von großen gar nicht erst zu reden: Wären ihre Aussagen über ihr selbstverständlich breites Meinungsspektrum wahr, müssten die Sender keine Programmkontrolle durch Gerichte fürchten. Und sie könnten eigentlich auch auf Zwangsgebühren generös verzichten, weil es genügend freiwillige Zahler gäbe. Nicht wahr? Parteien mit überzeugenden Argumenten müssten keine Oppositionskandidaten mit Hilfe des Nachrichtendienstes von Wahllisten kegeln. Sie müssten nicht jeden Tag nach einem Verbot der größten Oppositionskraft rufen.
Für jemanden, der in dieser Lage steckt, lautet die Parole natürlich: Weitergrinsen und Weiterwinken, jetzt erst recht. Solange noch Saft ankommt. Deshalb wäre es nicht schlecht, wenn möglichst viele, die sich andere Verhältnisse wünschen, sich einmal ein Land ohne die goldenen Dauergrüßer vorstellen. Nur probehalber, um sich an den Gedanken zu gewöhnen. Vielleicht machen sie sich nie ganz und gar davon, sondern es bleibt von ihnen wie bei Lewis Carrolls Cheshire Cat das körperlose Grinsen in der Luft hängen. Mit dieser Schwundstufe könnte eine Mehrheit in diesem Wunderland ganz gut dort leben, wo sie leben will, nämlich zwischen den Extremen. Das letzte Grienen von Entmachteten stört das Stadtbild nicht weiter.
Dieser Beitrag erscheint auch auf Tichys Einblick.
Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” –, fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.
Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.
Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.
Publico ist am Ende das, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.
Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto
A. Wendt/Publico
DE88 7004 0045 0890 5366 00
BIC: COBADEFFXXX
Die Redaktion
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.



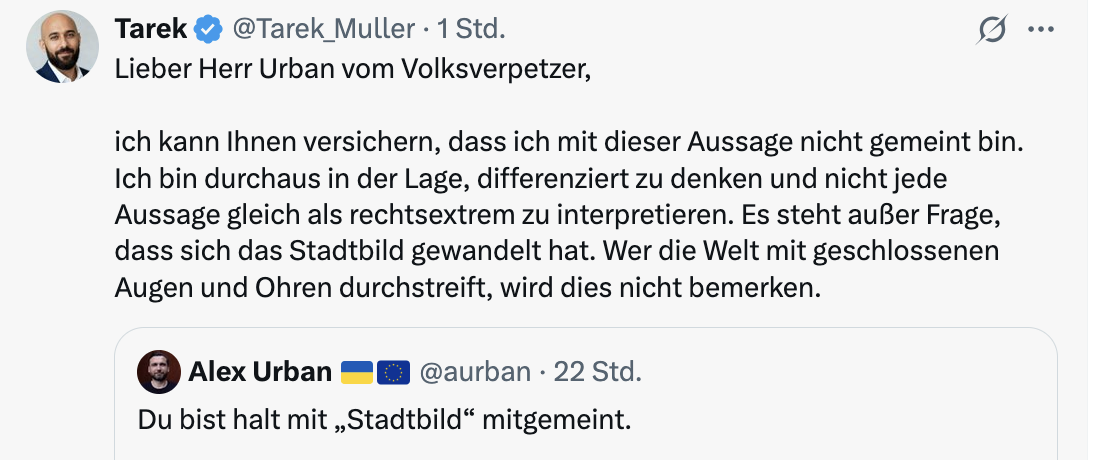



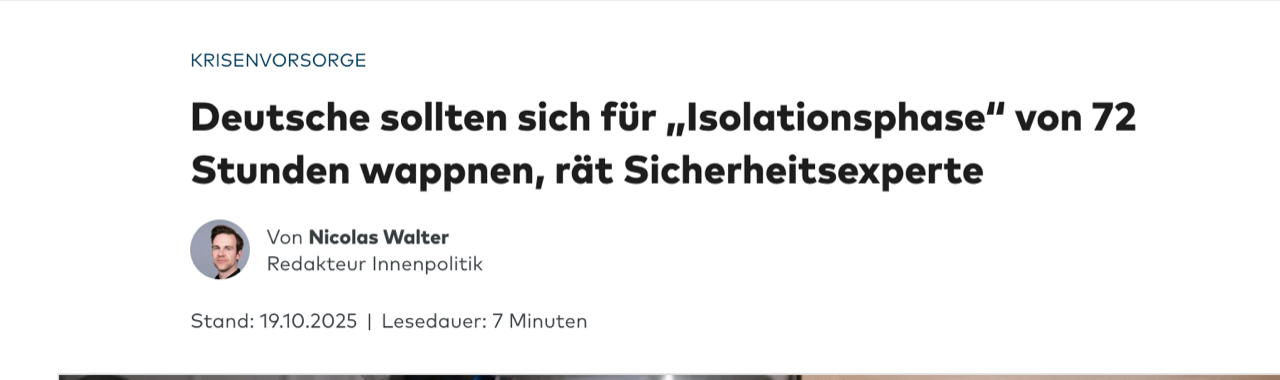




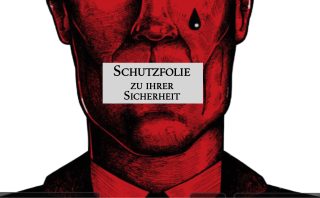





A. Iehsenhain
26.10.2025Die Nerven scheinen so blank zu liegen, dass der Bademantel-Paragraph schon rückwirkend angewandt wird…