Die Verfassungsrichter-Kandidatin Brosius-Gersdorf ist gescheitert, die Begriffsverwirrung um den Menschenwürde-Begriff hält trotzdem an. In diesem Streit geht es nicht nur um das ungeborene Leben – sondern um unseren Wesenskern.
Von Jan Dochhorn
Den entscheidenden Instanzen in unserem Land mangelt es an intellektueller Klarheit. Wir haben einen Kanzler, der es – von allem anderen einmal abgesehen – fertigbringt, über eine fundamentale Frage zur Menschenwürde des ungeborenen Lebens nonchalant hinwegzugehen.Wir erleben eine politisch-juristische Debatte, deren Teilnehmer zumindest partiell den Eindruck erwecken, mit dem Begriff der Menschenwürde nichts Besonderes mehr zu verbinden. Der Hintergrund ist eine tiefergreifende Orientierungskrise: Menschenwürde ist ein metaphysischer Begriff. Das will ein großer Teil der politisch-medialen und wissenschaftlichen Öffentlichkeit nicht wahrhaben. Es täte ihr aber gut, dies zu tun. Wir müssen über Menschenwürde reden.
Die Kandidatur von Frauke Brosius-Gersdorf für das Amt des Verfassungsrichters hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst, die sich vor allem um ihre Standpunkte zur Abtreibungsfrage drehte. In einer Bundestagsdebatte über diese Kandidatur fragte die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch Bundeskanzler Friedrich Merz unter anderem, ob er es mit seinem Gewissen vereinbaren könne, eine Kandidatin zu wählen, die vorgeburtlichem Leben bis unmittelbar vor der Entbindung die Menschenwürde abspreche, wobei er wohl wisse, dass diese Kandidatin als Verfassungsrichterin auch über den Abtreibungsparagraphen, also § 218 StGB, abstimmen werde. Wie Julian Reichelt völlig zu Recht anmerkt, hätte Friedrich Merz auf diese Frage so manches entgegnen können, etwa dass Frau Brosius-Gersdorf hier missverstanden werde. Aber das tat er nicht: Er äußerte sich einfach nur dahingehend, dass die Frage der Abgeordneten von Storch mit einem klaren Ja zu beantworten sei. Damit wurde der Fall Brosius-Gersdorf, sofern mit ihr dennüberhaupt ein Fall verbunden sein sollte, zweifellos zu einem Fall Merz: Unser Land wird von einem Kanzler regiert, der in einem entscheidenden Moment nichts gegen den Eindruck unternimmt, dass ihm die Würde des ungeborenen Lebens gleichgültig sei, dass es ihm nichts ausmache, wenn im Bundesverfassungsgericht „die Tür zur Spätabtreibung entriegelt“ werde (ich übernehme eine geglückte Formulierung von Ralf Bergmann)*. Für konservative Christen dürfte ein solcher Bundeskanzler untragbar sein, für verfassungsbewusste Demokraten ebenfalls. Die Frage der Menschenwürde kann ein Spitzenpolitiker nicht einfach so beiseiteschieben. Der Begriff steht im Zentrum von Artikel 1 des Grundgesetzes. In ihren Urteilen von 1975 und 1993 zum Schutz des ungeborenen Lebens bezogen sich die Verfassungsrichter jeweils ausdrücklich auf den ersten Verfassungsartikel. In seiner Bedeutung reicht der Menschenwürdebegriff allerdings weit über dieses Thema hinaus.
Merz könnte aus seiner selbstverschuldeten Situation herauskommen, indem er zur Abwechslung einmal ein Versprechen einhielte. In der betreffenden Bundestagsdebatte sagte er nämlich auch noch etwas anderes zu Beatrix von Storch: nämlich dass er gerade mit ihr „gerne“ über „die Tragweite und die Reichweite“ der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes diskutieren. Beatrix von Storch sollte ihn beim Wort nehmen. Das Gespräch könnte beispielsweise bei Kontrafunk stattfinden, wo Debatteure nicht ständig von einem parteiischen Moderator unterbrochen werden. Miteinander reden wäre typisch für eine Demokratie, und typisch wäre es auch, wenn ein Vertreter der Regierungsseite und ein führender Oppositionspolitiker eine gemeinsame Wertegrundlage ausloten würden, was im gegebenen Falle gelingen könnte, falls Friedrich Merz eben doch – wie Beatrix von Storch – den gegenwärtig verfassungsrechtlich gebotenen Schutz des ungeborenen Lebens aufrechterhalten wollte.
Immerhin gibt es bei aller Auseinandersetzung um die Nominierung (und den Rückzug) von Brosius-Gersdorf Anlass zur Hoffnung. Eine entscheidende Personalie des demokratischen Lebens wurde nicht in Hinterzimmern vorentschieden und dann parlamentarisch durchgewunken, sondern öffentlich debattiert. Bundestagsabgeordnete führten etwas ins Feld, was man im Berliner Betrieb vor lauter Fraktionsdisziplin gelegentlich vergisst, nämlich dass sie ein Gewissen haben. Die Kandidatin musste sich öffentlich erklären; ihr stand Redezeit zur Verfügung, um Missverständnissen und Unterstellungen entgegenzutreten, ob mit Erfolg oder ohne. So und nicht anders sollte es gehen in einer Demokratie.
Über dreihundert Vertreter „der universitären – insbesondere rechtswissenschaftlichen – Forschung und Lehre“ sehen das allerdings in einem Aufruf auf der Plattform „Verfassungsblog“ anders: Die Debatte um die Kandidatin sei „geeignet […], die gesamte demokratische Ordnung zu beschädigen“; ferner beklagen sie „mangelnde[] interne[] Vorbereitung“ des Abstimmungsvorganges, womit nur gemeint sein kann, dass man die Öffentlichkeit und die Gewissen von Abgeordneten fahrlässig habe zum Zuge kommen lassen. Nach ihrer Logik braucht die Demokratie also dringend Schutz vor offen geführten gesellschaftlichen Debatten. Was Demokratie betrifft, herrscht in Deutschland offenbar Begriffsverwirrung.
Und das verhält sich beim Thema Menschenwürde, wie es scheint, nicht anders. Es sieht so aus, als ob dieser Begriff der Revitalisierung durch konzeptuelle Arbeit bedarf. Und dies ist, wie sich nicht zuletzt an den Thesen von Frauke Brosius-Gersdorf zum Thema Schwangerschaftsabbruch zeigt, auch ein Problem der juristischen Debatte. Was liegt im Einzelnen vor?
Den Hauptansatzpunkt dieser Debatte bildet ein Aufsatz von Frauke Brosius-Gersdorf mit dem Titel „Menschenrechtsgarantie und Lebensrecht für das Ungeborene“ aus dem Jahre 2024. In diesem lässt sie deutlich eine Absicht erkennen, die Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruches auszuweiten: Mindestens in den ersten drei Monaten soll sie nicht bloß vorbehaltlich einer Beratung straffrei sein, sondern unkonditioniert rechtmäßig; hinsichtlich der mittleren und späten Phase der Schwangerschaft erwägt sie Freiräume für den Gesetzgeber, so dass auch hier etwas möglich werden kann. Sie arbeitet mit einem zuerst geringen und dann ansteigenden Schutzrecht des Ungeborenen, womit das Recht der Frau zur Abtreibung also graduell abnimmt. Mit der bisherigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes stimmt diese Sicht nicht überein. Das Gericht konstatiert wie schon erwähnt allem voran aufgrund der Menschenwürdegarantie eine generelle Schutzpflicht des Staates für das ungeborene Leben, lässt aber Abtreibungen ausnahmsweise zu (kriminologische Indikation, medizinische Indikation, straffreie Abtreibung bei einer Beratung, die zum Austragen der Leibesfrucht ermutigen soll).[5] Brosius-Gersdorf konstatiert hier eine Inkonsistenz: Einerseits sei die Menschenwürde unbestrittenermaßen nicht abwägungsfähig, andererseits aber werde abgewogen, indem der Frau gegebenenfalls das Recht zur Tötung des mit Menschenwürde begabten Lebens eingeräumt werde. Diese Konstellation, die ihr Doktorvater Horst Dreier in einem FAZ-Streitgespräch mit dem Juristen Christian Hillgruber als Ergebnis eines rechtsdogmatisch zwar problematischen, politisch aber weisen Kompromisses zwischen Liberalisierern und Konservativen ansieht[6], nimmt Brosius-Gersdorf zum Anlass, die Menschenwürdegarantie für das ungeborene Leben zu hinterfragen. Es gebe gute Gründe, dass diese erst ab Geburt gelte. Es fällt dazu ein Satz, der – vor allem von Gegnern der Kandidatin – vielfach zititert wird: „Die Annahme, dass die Menschenwürde gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss“. – „Menschenwürde und Lebensrecht“, so heißt es dann weiter, „sind rechtlich entkoppelt“. Eine wichtige Begründung, diese Restriktion für das ungeborene Leben anzuwenden, besteht für sie darin, dass „[a]nders als der geborene Mensch […] das Ungeborene bis zur Lebensfähigkeit ex utero existentiell abhängig vom Organismus der Schwangeren [ist]“. Diese Situation gelte nur für das ungeborene Leben, womit sich für sie mit dem „Konzept des pränatal gestuften und kontinuierlich anwachsenden“ (also beträchtlich verminderten) „Lebensschutzes“ „kein Einfallstor für postnatale Lebensrechtsdifferenzierungen“ ergebe; eine schiefe Ebene hin zur Infragestellung auch anderen als des ungeborenen Lebens will sie also explizit ausschließen.
Ganz sicher ist sich Frau Brosius-Gersdorf allerdings nicht, ob die Menschenwürdegarantie nicht doch schon vorgeburtlich gelte (ab der Nidation, der Einnistung der befruchteten Eizelle in den Mutterleib). Aber auch mit diesem Szenario ist für sie möglich, was sie gerne erreichen will: Nach breitem Konsens ergebe sich aus der Menschenwürdegarantie die sogenannte Objektformel, laut welcher der Einzelne nicht zum Objekt staatlichen Handelns herabgewürdigt werden dürfe. Es handele indes bei einer Abtreibung nicht der Staat, sondern die Frau; es sei unklar, inwieweit hier die Objektformel überhaupt gelte. Eine „Objektivierung“ komme auch nur dann „in Betracht“, wenn man die „Subjektqualität des Einzelnen“ infrage stelle, „etwa durch Kategorisierungen als „lebenswert“ oder „lebensunwert“; das sei bei einem Schwangerschaftsabbruch nicht der Fall. Und so heißt es dann: „Die Tötung eines Menschen ohne herabwürdigende Begleitumstände, die ihm seine Subjektqualität absprechen, verletzt Art. 1 I GG nicht“.
Es ergeben sich zu diesem Theoriegebäude Einwände, die hier einmal aus einer außerjuristischen Perspektive geäußert werden sollen. Man kann Fachwissenschaftliches nicht einfach nur Fachwissenschaftlern überlassen, auch weil in den Fachwissenschaften oft seltsame Binnenklimate entstehen. Im gegebenen Falle kommt hinzu, dass die Rechtswissenschaft bei diesem Thema auf sich selbst gestellt kaum Gescheites ausrichten kann, denn Menschenwürde als normsetzender Begriff ist ein außerjuristisches Thema; sie gehört zur Metaphysik und zur Theologie. Was kann und muss man aus dieser Perspektive gegen den Umgang mit dem Begriff Menschenwürde bei Frauke Brosius-Gersdorf einwenden, mit dem sie in der Rechtswissenschaft übrigens auch nicht allein steht?
Brosius-Gersdorf lässt Tendenzen zu einem anwaltschaftlichen Wissenschaftsverständnis erkennen: Sie will etwas Bestimmtes erreichen nach Maßgabe einer „Egal Wie-Strategie“: Egal ob mit oder ohne Menschenwürdegarantie für das ungeborene Leben soll der Frau ein Schwangerschaftsabbruch leichter möglich sein als bislang gehabt (Dieses Ziel findet sich übrigens auch in dem Koalitionsvertrag von Union und SPD). Von einem anwaltschaftlichen Wissenschaftsverständnis ist wohl kein Wissenschaftler ganz frei. Doch wenngleich damit die Temperatur einer Debatte angenehm erhöht werden kann (Streit ist schön), so bleibt doch festzustellen: Zur Wissenschaft passt das Anwaltschaftliche eigentlich nicht: Wissenschaft soll nicht die (mitunter) schwächere Sache zur stärkeren machen, sondern sine ira et studio herausfinden, welche die stärkere ist. Dasselbe gilt auch für einen Richter. Insofern passt es gut, dass Frau Brosius-Gersdorf nicht Verfassungsrichterin wird.
Zweitens lässt sich aus den Inkonsistenzen im Gebrauch des Menschenwürdebegriffs durch die gegenwärtig gültigen Urteile des Verfassungsgerichts nicht zwingend etwas über den Gehalt dieses Begriffes ableiten, und zwar aus zwei Gründen. Der Gebrauch von etwas ist zu unterscheiden von dessen Washeit, also seiner Wesenheit. Wo-Sein und Washeit sind kategorial unterschieden; ersteres ist akzidentiell, letztere ist substantiell. Die Menschenwürdegarantie ist grundlegend für das Recht; ihre Verwendung im Recht, zumal wenn auch noch unstimmig, ist dem nachgeordnet.
Die Aussage, dass Menschenwürde nicht notwendigerweise für jedes menschliche Leben gelte, verletzt zarte Gemüter, mit oder ohne Kontext, und dies nicht ohne Grund: Wenn es um Menschenwürde geht, ist ein zartes Gemüt angebracht. Brosius-Gersdorf lässt eine Härte der Sprache erkennen, die bei ihr auch sonst vorkommt, etwa in ihrer viel zitierten Einlassung, dass die AfD-Anhängerschaft auch nach einem Verbot der Partei „nicht beseitigt“ sei. Gedankliche Unschärfen kommen hinzu: Menschenwürde für jegliches menschliche Leben zu konstatieren, ist ein Urteil, nicht ein Schluss. Dazu bleibt ungeklärt, was an einem solchen Standpunkt naturalistisch sein soll. Erst recht der Biologismusvorwurf hat kaum mehr als eine polemische Valenz: Biologismus attestiert man gewöhnlich (Rechts-)Extremisten, die menschlichem Leben Würde verweigern; hier soll er diejenigen kennzeichnen, die eine solche Würde jedem menschlichen Leben zusprechen. Das kommt orwellscher Sprachverdrehung nahe.
Dass Menschenwürde und Lebensrecht entkoppelt seien, mögen auch andere Juristen behaupten. Es ist aber falsch: Im Grundgesetz ist die Menschenwürde eindeutig nicht Glied in einer Reihe von Grundrechten, sondern ein Zentralbegriff, von dem die Menschenrechte abgeleitet werden und damit auch das Recht auf Leben. In der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1948 verhält es sich nicht anders. Einmal wieder wird die fundamentale Bedeutung der Menschenwürdegarantie verkannt.
Dass dem Embryo Menschenwürde nicht zukommen solle, weil er auf den Organismus der Schwangeren angewiesen sei, leuchtet nun überhaupt nicht ein. Abgesehen davon, dass auch ein Kind nach seiner Geburt völlig von der mütterlichen beziehungsweise elterlichen Fürsorge abhängt: Angewiesenheit ist vielmehr gerade die Situation eines Menschen, in der von seiner Menschenwürde zu reden am notwendigsten ist: Ein Milliardär mit Bodyguards kann sich mühelos durchsetzen, ein ökonomisch erpressbarer Arbeitnehmer, ein machtloser Dissident kaum, ein Dementer schon gar nicht. Gerade der Schutzbedürftige und Abhängige hat es dringend nötig, dass im Bedrohungsfalle jemand seine Menschenwürde namhaft macht. Dass dieser Zusammenhang nicht auch gelten sollte bei Angewiesenheit auf einen Organismus, wird man kaum schlüssig behaupten können. Und wenn man es behauptete, würde man eine Katastrophe anrichten, denn gewiss ließen sich in anderen Menschenwürde-Problemsituationen (bei Dementen etwa) analoge Begleitumstände zwecks Neutralisierung der Menschenwürdegarantie ausmachen, wenn man erst einmal anfängt, Menschenwürde derart zu konditionieren. Frau Brosius-Gersdorf will das zwar erklärtermaßen nicht, siehe oben, aber ihre findigen Kollegen wären wohl kaum daran zu hindern, wenn das geistige Fundament dafür erst einmal steht.
Die Überschrift in dem erwähnten FAZ-Streitgespräch stammt übrigens nicht von einem der Diskutanten, sondern von der Redaktion, und sie lautet: „Was hat der Embryo von seiner Würde?“ Das war möglicherweise nur als rhetorische Provokation gemeint, um Widerspruch anzustacheln. Dahinter scheint aber auch ein Denken auf, das leicht auf gefährliche Bahnen gerät. Wenn wesentliche Teile von Politik, Rechtswissenschaften und Medien erst einmal anfangen zu fragen, ob ein menschliches Wesen die Menschenwürde überhaupt braucht, kommen sie von der schiefen Ebene nicht mehr herunter. Denn eigentlich bedeutet diese Frage: Was hat die Gesellschaft von diesem oder jenem Wesen, etwa dem Embryo oder einem Dementen? Ist das ein Mensch, oder kann das weg?
Die Reduktion der Menschenwürdegarantie auf die Objektformel zeigt unmittelbar ihre Grenzen: Werde ich getötet, ohne dabei geringgeschätzt zu werden, ohne dass auch jemand meine Organe verwertet, fehlt mir doch etwas, auf das ich ungerne verzichte: mein Leben. Dass Nichtobjektivierung menschlichen Lebens bei einem Schwangerschaftsabbruch vorausgesetzt werden könne, ist zudem weder apriorisch noch empirisch gesichert: „Ist es schon ein Mensch? Oder nur Zellgewebe? Elke ist es einerlei. Sie will dieses Es in ihrem Bauch nur loswerden.“ So setzt in der Süddeutschen Zeitung vom 2. Dezember 2019 ein Bericht über ein Theaterstück zum Thema Abtreibung ein, das sich gegen „Neue Rechte“ wendet. Despektierliches über das Ungeborene ist mindestens literarisch möglich. Es müsste auch erst einmal nachgewiesen werden, dass embryonales Gewebe aus Abtreibungen nie und nirgends Verwendung findet. Die Objektformel reicht also kaum aus für eine Bestimmung dessen, was Menschenwürde ist. Eher ist sie eine von mehreren Folgerungen aus der Menschenwürde, nicht aber deren Sache selbst.
Eben diese Sache selbst scheint merkwürdig ungeklärt, und dies gilt nicht nur im gegebenen Falle, sondern auch sonst in der juristischen Debatte, die gelegentlich so aussieht, als sei der Begriff Menschenwürde ein Ding aus fremder Zeit, den man wohl eher nicht verwenden würde, wenn man für Bodo Ramelow, wie von ihm gefordert, eine neue Verfassung schreiben müsste. Eindrucksvoll bringt es ein Nachwuchswissenschaftler auf dem Verfassungsblog in einem Text mit dem Titel „Die Sache mit der Menschenwürde“ zur Sprache: Bei der Moral und der Theologie sei man mit dem Begriff Menschenwürde, nie aber bei dem Juristischen. Nicht ganz zufällig kann der Betreffende dann sogar dem vielgeschmähten Rechtspositivisten Carl Schmitt etwas abgewinnen. Und es wird damit klar, wo das Problem liegt: Dem Begriff Menschenwürde scheint etwas Naturrechtliches zu eignen, mit dem man schnell bei Metaphysik und Religion landet, und das darf nicht sein.
Warum eigentlich nicht?
Es liegt nahe, es einmal andersherum zu probieren und das scheinbare Problem als Chance zu nehmen. Zumindest in Ansätzen ist nun Menschenwürde als ein metaphysischer Begriff und dann als ein Ausgangspunkt erneuten metaphysischen Denkens zu konzeptualisieren, abschließend unter Einbeziehung des Religiösen. Dies geschieht in sieben Schritten, basierend zu einem guten Teil auf kantianischen Gedankengängen.
1. Als Voraussetzung für alles Folgende ist festzustellen: Wohl nahezu alle Menschen, die bei Trost sind, werden der Aussage zustimmen, dass es ein Frevel sei, sich an einem Menschen zu vergreifen. Mit dem Wort Frevel klingt eine religiöse Dimension an, die nicht jeder realisieren, auch nicht jeder akzeptieren wird. Sie ist aber da – und soll hier entfaltet werden. Menschen können gut handeln ohne diese Bewusstmachung des Religiösen, wie man ja auch Technik nutzen kann, ohne zu ahnen, was dabei passiert. Mit der Bewusstmachung ist gleichwohl ein Gewinn verbunden.
2. Jeder Mensch ist schlicht, indem er vorhanden ist, unterschieden von anderen Menschen und zugleich mit ihnen analog. Damit ist ihm – als Mensch – Eigenheit gesichert, mit der eine Abgrenzung stattfindet gegen andere Menschen und speziell den Staat als Inhaber des Gewaltmonopols. Diese Feststellung ist nicht juristischer Natur, sondern gehört zur Ontologie und schon damit zur Metaphysik.
3. Mit der Eigenheit des je einzelnen Menschen geht einher Selbersein und – ruhend darauf – Ichheit, zusammengenommen: Personalität. Mit dieser wiederum ist der Mensch zu bestimmen als in Freiheit sittlich handelnd, und er hat darin mit Kant seine Würde. Er sagt zu dieser unter anderem: „Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde“.
Diese Bestimmung des Menschen gilt nicht empirisch, sondern apriorisch; sie gilt unabhängig davon, wie sehr sich der je Einzelne seiner Freiheit als einer sittlichen Persönlichkeit bewusst ist und wie weit dergleichen sichtbar ist. Sie gilt auch unabhängig davon, wie weit der Einzelne und der Mensch überhaupt in seinem Handeln kausal durch materielle, psychologische oder gesellschaftliche Prozesse vorbestimmt ist. Jeder Einzelne ist als personal freies Wesen zu achten (und haftbar zu machen).
4. Aus dieser Konstellation folgt: Der Mensch und so auch jeder Einzelne ist doppelaspektig: einerseits Phainomenon (also der Erfahrungs- und Erscheinungswelt angehörig, von dieser bedingt, inwieweit auch immer), andererseits Noûmenon (der Welt des freien sittlichen Entscheidens zugehörig und somit Geistwesen). Als ein Noûmenon ist er naturunabhängig und in seiner Eigentlichkeit begriffen; was immer man über eine materielle Bedingtheit des Menschen zu sagen vermöchte, wesensmäßig verstanden ist er nur als ein Noûmenon. Eine materialistische Wesensbestimmung des Menschen ist auf jeden Fall unzutreffend und wird seiner Würde nicht gerecht.
5. Bei der Würde des je Einzelnen als eines Geistwesens kann man, sollte man aber nicht stehen bleiben, denn dahinter ist ein Größeres zu ahnen, was diese Würde garantiert und sichert, dass es ein Frevel ist, sie nicht zu achten: Der Mensch als sittliche Person soll zwar sittlich handeln um der Sittlichkeit willen, aber ein Sinnzusammenhang ergibt sich damit erst, wenn es einen Richter gibt, der belohnt (und straft), und wenn Lohn (und Strafe) real werden, und zwar außergeschichtlich und weltjenseitig, da in Welt und Geschichte das Gute kaum gerecht belohnt wird. Wir sind damit bei den metaphysischen Postulaten Gott, Freiheit und Unsterblichkeit angelangt – mit der Freiheit als gnoseologischem Ausgangspunkt. Sie haben ihren Wert nicht als ein verstandesmäßig Greifbares und vordergründig Nützliches, sondern als ein der Vernunft Erahnbares, als Perspektivpunkt der Sehnsucht. Die Menschheit tut sich nichts Gutes, wenn sie diese Sehnsucht verdrängt. Die Herrschaft destruktiver Ideologien dürfte eine der Folgen sein.
6. Die in den großen Kulturen bestimmenden philosophischen Systeme wie die Religionen setzen für die metaphysischen Postulate in je unterschiedlicher Form weltjenseitige Realitäten. Bei Plotin gibt es die von Gott und nach ihm dem Geist derivierende Seele, die in die materielle Welt eingegangen ist und zugleich unbewusst immer bei Gott ist; im hermetischen Traktat Poimandres, der sich in der Renaissancephilosophie großer Beliebtheit erfreute, ist der „Wesenhafte Mensch“ bekannt: Der Mensch, in der materiellen Welt lebend, muss sich seines inneren Wesenskerns, des wesenhaften Menschen bewusst werden, der aus dem Überhimmlischen stammt und dahin zurückkehren wird. In der jüdischen wie christlichen Tradition entsprechen den metaphysischen Postulaten Gott, die Seele und das ewige Leben. Zu beachten ist dabei, dass speziell die Seelenlehre auf einem Zusammenwirken des Judentums sowohl mit iranischen wie auch griechischen (platonischen) Überlieferungen beruht; wir haben es mit einem altüberkommenen Erbe zu tun, das sich kulturübergreifenden Wissensdimensionen verdankt.
7. Eine bleibende Aufgabe einer unbefangenen, metaphysik- und theologieoffenen Wissenschaft besteht darin, dem Wirklichkeitskorrelat der angedeuteten Traditionsbestände nachzugehen. Nahtoderfahrungen, religiös-ekstatische Erfahrungen in Geschichte und Gegenwart, die parapsychologischen und paraphysischen Befunde, die einem im Grunde dem neunzehnten Jahrhundert verhafteten Denken atheistischer oder materialistischer Bequemdenker diametral widersprechen, deuten für Unbefangene an: Es ist etwas dran an alledem; Menschendasein und Welt haben einen unausgelotet geheimnisvollen Hintergrund, der auf etwas Größeres hinweist. Hinter der Würde des Menschen eröffnet sich ein Raum von höherem Licht. Es ist ein Frevel, sie anzutasten.
Christen und Kirchen bringen oftmals die Menschenwürde mit der Gottesebenbildlichkeit zusammen, wie sie in der biblischen Schöpfungsgeschichte bezeugt wird. Ich habe den Eindruck, dass dies etwas voreilig geschieht. Im Neuen Testament als dem für christliche Theologie entscheidenden Dokument ist nämlich die Gottesebenbildlichkeit vornehmlich eine Eigenschaft Christi. Man kommt von da auf eine Konzeption zur Würde des Menschen, die erheblich reichhaltiger sein wird als das hier Skizzierte. Aber das muss anderswo dargestellt werden.
Und wie verhält es sich nun konkret mit dem Schutz des ungeborenen Lebens? Warum nur bleiben diese Theologen so unkonkret? Eine Antwort: Materiale Ethik und erst recht eine weitreichende Regelung von Lebenspraktiken ist für Theologen und religiöse Menschen weniger interessant, als man vermuten mag; dergleichen widerspricht der Freiheit eines Christenmenschen. Eine andere Antwort: Man wird dem vorhergehend Mitgeteilten entnehmen können, dass vom Staat aus meiner Sicht mehr an Schutz des ungeborenen Lebens abzufordern ist, als er gegenwärtig leistet. Ohne Empathie mit den betroffenen Frauen wird dies aber nicht zu denken sein. Es bleibt der moralische Appell an jeden Einzelnen, sich des unabgetriebenen menschlichen Lebens mehr zu freuen als oftmals üblich. Als ein guter Staatsbürger sollte man mit gutem Beispiel vorangehen und bei sich anfangen: Ich danke meiner Mutter, dass sie mich nicht als ein Es im Bauch, sondern als geliebtes Kind gesehen hat. Sie verwirklichte damit lebensbejahend, was nur eine Frau vermag, nämlich Mutterschaft – mit mir selbst als einem Ergebnis, zu dem ich uneingeschränkt stehen kann.
Der Theologe Jan Dochhorn, geboren 1968 in Hannover, lehrt seit 2014 als Senior Lecturer for New Testament Studies an der University of Durham, England und forscht unter anderem zur Theologie des Paulus sowie zur antik-jüdischen Literatur. Er initiierte 2012 einen von über 50 Akademikern unterstützten offenen Brief an den damaligen Bundespräsidenten, in dem er sich für die Freiheit von Lehre und Forschung aussprach, die er von Konformismus und Niveauabsenkung bedroht sieht. Im Jahr 2022 sprach sich Dochhorn zusammen mit anderen Professoren in einer öffentlichen Stellungnahme gegen eine Impfpflicht aus.
Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” – fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt –, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.
Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.
Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.
Publico ist am Ende, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.
Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto
A. Wendt/Publico
DE88 7004 0045 0890 5366 00
BIC: COBADEFFXXX
Die Redaktion
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.

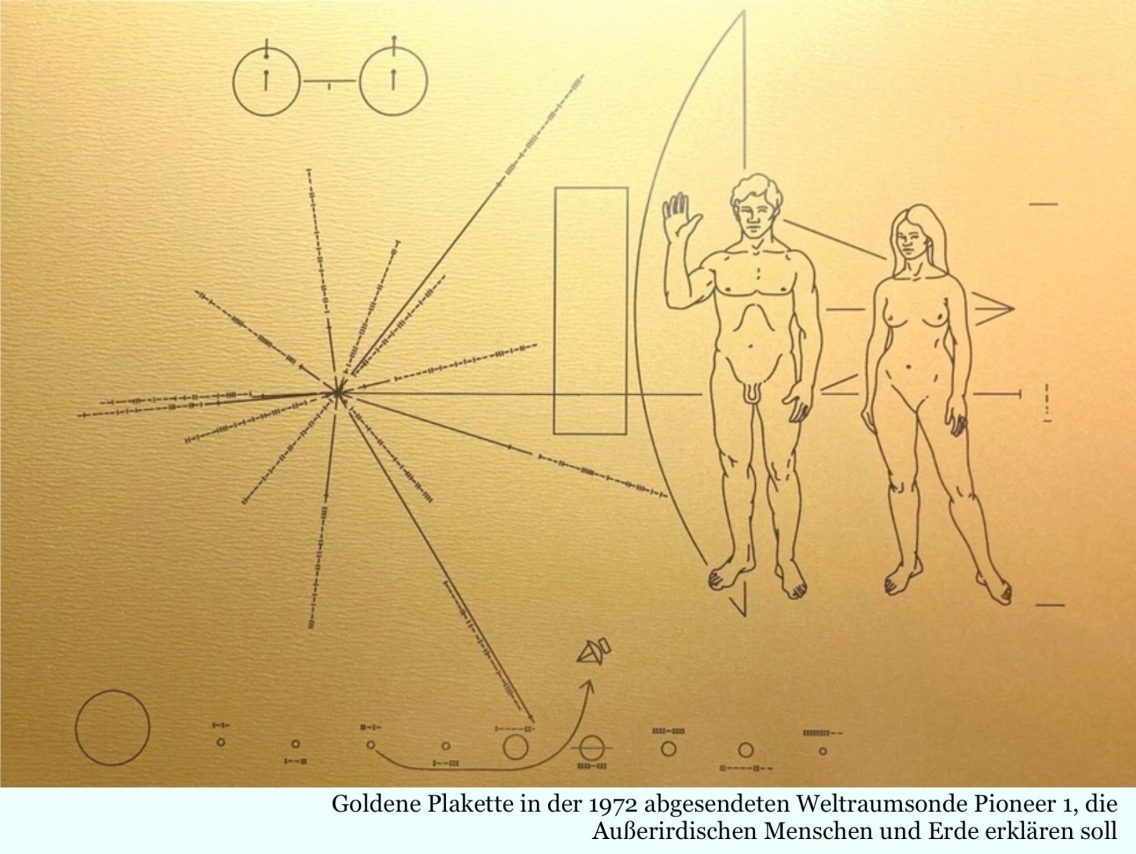



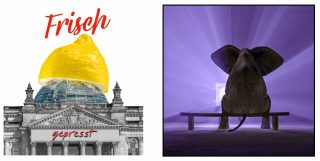

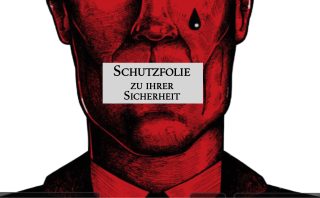



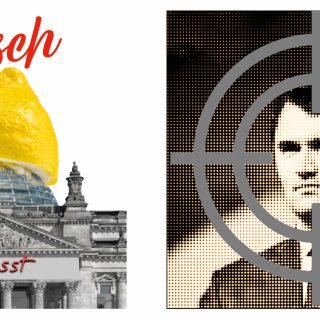
Isabel Kocsis
11.09.2025Als einundachtzigjährige Oberstudienrätin i.R. bin ich in den Endwirren des Krieges 1944 unehelich geboren, ebenso wie meine beiden Schwestern 1947( Ballettschulpädagogin, dieses Jahr verstorben) und 1948 (Zahnärztin i.R.). Wir danken (dankte) unserer unverheirateten Mutter (Geigerin im Symphonieorchester des BR), dass wir mit der Unterstützung unseres mütterlichen, nicht christlichen, aber lebensschützenden Großvaters (Kunstmaler) und der tätigen Hilfe unserer Großmutter nicht als ES betrachtet wurden, sondern als geliebte Kinder, die mit Würde zur Welt kommen durften, sich entfalten durften und ein erfülltes Leben führten. Dass trotz heutiger Verhütungsmöglichkeit eine Unzahl kindlichen Lebens im Mutterleib von Frauen vernichtet wird, halten wir für abscheulich, unserer Meinung nach sollte Abtreibung nur unter extremen Umständen (Lebensrettung der Mutter, Vergewaltigung u.ä.) und dann möglichst frühzeitig vorgenommen werden.
Werner Bläser
11.09.2025Friedrich Merz und anderen ist die Menschenwürde keineswegs egal. Da muss ich dem Autor vehement widersprechen. Er geht auch nicht nonchalant darüber hinweg. Man kann dies beweisen, indem man seine Haltung zur einzigen Oppositionspartei betrachtet. Deren moralische Unberührbarkeit gründet er auf die Behauptung, sie respektiere die Menschenwürde nicht, weil sie illegale Migranten diskriminiere – was natürlich rassistisch sei. Wer nicht jeden, der nach Deutschland kommt, mit offenen Armen aufnimmt und durchfüttern will, muss ein Feind der Menschenwürde sein. In dieser Argumentationsspur laufen ja auch die Äusserungen der Verfassungsschutzämter.
Merz hat also durchaus ein Herz für die Menschenwürde bestimmter Gruppen. Nur eben nicht so viel für die von ungeborenen Kindern. Er unterscheidet da ganz strikt. Er diskriminiert, sozusagen, denn eigentlich bedeutet „diskriminieren“ unterscheiden.
Johanna
12.09.2025Meine Ablehnung von Abtreibungen basiert auf einer persönlichen Erfahrung. In den 1980 ger Jahren hospitierte ich einen Tag lang bei Pro Familia bei Abtreibungen. Sie erfolgten mit der Absaugmethode und ergänzender Kürettage. Etwa ab der 10. Entwicklungswoche sah das abgetriebene Kind wie ein menschliches Püppchen aus. Es lag nun tot in der Nierenschale, hatte aber vor wenigen Momenten noch gelebt und sich gegen das Herausreißen aus der Gebärmutter heftig zur Wehr gesetzt. Was wäre gewesen, wenn es noch lebend und zappelnd in der Nierenschale gelegen hätte? Wer hätte es fertig gebracht, dieses Kind zu töten? Ich denke, nur die „blinde Tötung“ war verkraftbar für Arzt und Krankenschwestern. Damit aber belügt man sich selbst. Es gibt aus meiner Sicht keine zufriedenstellende Lösung für unerwünschte Schwangerschaften, auch die Fristenlösung ist es nicht – das Kind verliert sein Leben. Aber es ist eine halbwegs vertretbare Lösung. Doch bitte nur bis hierhin und keinesfalls weiter. Es gibt nicht wenige Frauen, die im Nachhinein den Schwangerschaftsabbruch bedauern. Ein Plädoyer für das Ungeborene kann Menschen zum Umdenken bringen. Dieser Artikel ist ein solches Plädoyer. Danke.
Leonore
25.09.2025Danke für diesen Kommentar!
Mir geht es ähnlich: Ich habe als junge Frau in einem Pathologie-Labor gearbeitet. Es waren wenige Tage, an denen keine von diesen auf die Handfläche passenden „Püppchen“, in Formalin schwimmend, eingesendet wurden. Die in einem früheren Stadium abgetriebenen Kinder kamen meist als „Ausschabungsmaterial“, also zerstückelt inmitten von viel geronnenem (mütterlichen) Blut und Dezidua, der Auskleidung der Gebärmutter, an. Dieses „Material“ mußte zur weiteren Bearbeitung in kleine Körbchen verteilt werden – und es macht etwas mit einem, wenn man dabei plötzlich ein winziges Füßchen oder Ärmchen sieht… Ein Köpfchen oder Teile davon habe ich dagegen in keinem einzigen Fall gesehen. Das läßt mich stark daran zweifeln, daß Foeten oder Teile von ihnen nicht verwertet werden.
Übrigens beweisen ja auch Impfstoffe, die mittels Nieren-Zellen abgetriebener Foeten produziert werden, daß es diese Verwertung gibt.
Albert Schultheis
15.09.2025Trotz allem Elend und dem Leid, das uns dystopische Zeiten und verblödete Zeitgenosse – insbesondere wenn sie überzeugt sind, begabt zu sein, uns Einfältigere aus dem Körbchen der Bedauernswürdigen – aufzeigen, sind dies Zeiten, in denen sich auf erstaunenswerte Weise die Schund- und Bullschit-Journaille von echtem, humanistischen, der menschlichen Lebenswelt entsprechendem Journalismus differenziert! Wie diese Platform Alexander Wendts und insbesondere dieser tiefergründige Beitrag über die viel besungen „Würde des Menschen“ bezeugt.
Er bezeugt auch im Übrigen, dass es heute ausschließlich und ausgerechnet die „Nazi-„Partei der AfD ist, die mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes – unserer Verfassung, so wie sie von seinen Verfassern einmal gemeint war – steht.
Ein Merzel hat diesen gemeinsamen Boden längst und ausdrücklich verlassen – eine Brosius-Gersdorf hatte diesen Boden wahrscheinlich nie betreten bzw niemals begriffen! Nur so erklärt sich ihr unerbittlicher, menschenfeindlicher Gestus in Sprache und Gestik.
Albert Schultheis
16.09.2025aufzeigen – aufnötigen war gemeint