Ist die Islamdebatte tatsächlich fehlgeleitet? Wozu braucht die „liberale Demokratie“ die Dauerkrise? Was sucht ein junger Berliner in Paris? Publico-Autoren besprechen neue Bücher von Teseo La Marca, Markus Vahlefeld und Sebastian Haffner
Zu vielem fähig, nur nicht zur Selbstaufklärung
Teseo La Marca beschwört den „schönen Islam“, den es zwar nirgends gibt, aber seiner Meinung nach geben könnte – wenn sich die Europäer nur etwas mehr Mühe geben würden
Von Beate Broßmann
Klingt doch erst einmal gut, dieser Buchtitel. Dass der offizielle Islam-Diskurs wenig sachgerecht und -dienlich ist, weiß eine kritische Öffentlichkeit seit zehn Jahren und länger. Nun hat es offenbar auch ein junger Journalist der linken und Mainstream-Medien namens Teseo La Marca bemerkt. Und stellt die richtigen Fragen, frohlockt man mit Blick auf das Cover und freut sich auf radikale Erkenntnisse. Ein junger Poschardt vielleicht?
Dreht man das Buch auf den Rücken, ergreift einen der erste Zweifel: „Welcher Islam gehört zu Deutschland?“ lautet der erste Satz auf dem Cover. Dass der Islam zur Demokratie gehört, ist also für den Autor schon eine ausgemachte Sache.
Im Gespräch mit Muslimen, linken Apologeten und Islamkritikern offenbarten sich Missverständnisse, Verharmlosungen und Vorurteile. Denen will der Autor ein Ende bereiten, um einem Islam zum Durchbruch zu verhelfen, der zeitgemäß sein und im Einklang mit pluralistischen Gesellschaften stehen soll. Nicht nur ultrakonservative Kräfte in der islamischen Welt, sondern auch die Öffentlichkeit, die immer wieder Muslime unter Generalverdacht stelle, verhinderten heute angeblich eine solche Reform im europäischen Islam. Aha. Nun weiß man, woher der Wind weht, und kann ohne große Illusion rezipieren, wie sich dem Journalisten, der nach eigenem Bekunden zum Islam konvertierte, um seine muslimische Frau heiraten zu dürfen, die Welt darstellt, besonders unter dem Aspekt der Ausbreitung seiner frisch erworbenen Religion.
Marca bezeichnet seine Herangehensweise als getrieben von der „Neugier eines Skeptikers“. Damit meint er, dass weder der islamische Fundamentalismus noch die rechte Verteufelung der islamischen Religion zielführend seien für eine friedliche multikulturelle europäische Gesellschaft. Es gebe Chancen für einen Reformislam in Europa, die „zwischen pauschalen Anfeindungen von rechts und naiven Verharmlosungen von links“ zunichte gemacht würden. Extremisten auf beiden Seiten des politischen Spektrums sorgten dafür, daß aufgeklärte und aufklärende Moslems wie Seyran Ateş, Hamed Abdel-Samad oder Necla Kelek allein blieben. Immerhin argumentiert er gegen die linke Überzeugung an, derzufolge Gewalt im Namen des Islams nicht mit der Religion im Zusammenhang stünde, indem er sogar die ehemalige Außenministerin Baerbock zitiert und auch die Universitäten dahingehend kritisiert. Bassam Tibis von Desillusionierung zeugendes Statement „Den Euro-Islam wird es nicht geben. Ich kapituliere“ von 2016 aber findet er defätistisch. Die Begründung dafür fällt spekulativ und vage aus.
Für den Autor hat der Islam viele Gesichter: ein „schönes und tolerantes Antlitz“ und eine „hässliche gewalttätige Fratze“. Eine differenzierte Sicht auf diese Religion sei notwendig. Der Islam sei komplex und „zu vielem fähig“. Allerdings schreibt er die Verantwortung dafür, dass sich der schöne, tolerante Islam entfaltet, bemerkenswerterweise nicht den Muslimen selbst zu, sondern den westlichen Einwanderungsgesellschaften.
„Die offene Gesellschaft ist die ethische Messlatte, woran wir …auch Religionen messen müssen.“ Marcas Ausgangsfragen für sein Buch lauten demzufolge: Inwiefern ist der Islam mit einer offenen Gesellschaft vereinbar? Und was kann eine Gesellschaft tun, um den Reformislam zu unterstützen? Diese seien die richtigen Fragen – im Gegensatz zu denen, die in der Öffentlichkeit gestellt würden. „Gerade die europäischen Gesellschaften bieten mit ihrer offenen Streitkultur und einem pluralistischen Umfeld ideale Bedingungen für eine solche Reformierung des Islam.“ – „Statt der Islamisierung Europas sollte also eine Europäisierung des Islam stattfinden.“
Marca und seine Ehefrau genössen die europäische Freiheit. „Allein zu wissen, dass wir hier denken, sagen und tun durften, was sie wir wollen, veränderte das Lebensgefühl. Wir spürten die Freiheit in jedem Atemzug.“
Dazu gibt es Einiges anzumerken. Zum einen geht Marca von einer längst überholten Prämisse aus. Er und seine Frau mögen bei uns offen sagen können, was sie denken. Doch Pluralismus und Streitkultur sind seit der Jahrhundertwende peu à peu abgeräumt worden. Jemand mit dem richtigen „Klassenstandpunkt“ scheint dies nicht bemerken zu müssen oder zu können. Der Verfall der Demokratie und der offenen Gesellschaft von Staats wegen – Stichwort „Meldestelle für antimuslimischen Rassismus“ – ist Marca keine Zeile wert. Genauso wenig wie der Umstand, dass sich Personen wie Seyran Ateş und Abdel-Samad nur mit Personenschützern zu öffentlichen Veranstaltungen begeben können. Sieht Marca beides – Demokratie und plurale Gesellschaft – in Gefahr, macht er den Islamismus und den „rechten Rand“ mit seinem Autoritarismus verantwortlich. Die erste Gefahr wird seiner Auffassung nach begünstigt durch die zweite. Das heißt, hätte die Willkommenskultur der Teddyverteiler von 2015 das ganze Land erfasst und bis heute wirken können, wäre der entscheidende Grund für die Entwicklung fundamental-islamistischer Gemeinden und für die Verbreitung des hässlichen Islams entfallen. Obwohl er Ruud Koopmans‘ Soziologie des Islamismus folgt und wirtschaftliche Stagnation, politische Unfreiheit und gewalttätige Konflikte als Verstärker von fundamentalistischen Einstellungen anerkennt, scheint er zu glauben, dass eine die Menschenwürde achtende freiheitsliebende Gesellschaft sozusagen als Abklingbecken für religiöses Eiferertum und gewaltgeneigte Überlegenheitsideologie fungieren würde oder könnte. Sind „sie“ erst einmal „hier“, würden sie dankbar die Kultur der Freiheit annehmen, sie würden ihre Ehefrauen laufen, also arbeiten und westlich leben lassen, und selbst ihre Kinderzahl würde sich der hiesigen anpassen. Marca unternimmt einen kurzen historischen Exkurs, um einen Islam des Fortschritts, der Wissenschaft und der Toleranz in Erinnerung zu rufen. Er schlussfolgert: „Auch der Fundamentalismus, die Krankheit des heutigen Islam, ist nichts, wovon sich die islamische Welt nicht befreien könnte.“ Dass diese Möglichkeit sich in absehbarer Zeit allerdings nicht realisieren wird, räumt er ein: Ein „goldenes Zeitalter“ bedürfe einer freien innerislamischen Debatte, „in der auch Religionskritik und unorthodoxe Stimmen ihren Platz haben“. An dieser fehlt es – überall in der islamischen Welt. Dort mag es verschiedene Spielarten des Islam geben. Ein aufgeklärter, der andere Religionen gleichberechtigt neben sich respektiert, findet sich nicht darunter.
Ja, der Islam ist – wie Christentum und andere Religionen – „zu vielem fähig“. Nur geht es bei einem Narrativ am wenigsten darum, was schwarz auf weiß geschrieben steht, sondern darum, was man aus einem Text zu einer bestimmten Zeit heraus- oder in ihn hineinliest. Die Art der Aneignung eines Textes wiederum ist zeit-, umstände- und sozialpsychologisch bedingt. Und hier operiert La Marca mit zwei verschiedenen Maßstäben: Während der islamische Extremismus eine Reaktion auf die – europäischen – gesellschaftlichen Umstände sein soll, also in diesem Sinne fluid, diene der Islam rechten Kreisen als Feindbild. „Für diejenigen, die von einem ethnisch-kulturell homogenen Deutschland träumen, sind islamistische Vorfälle eine Bestätigung ihres Hasses.“ Ihr angeblicher Hass besteht für den Autor also gewissermaßen a priori, denn: „Rechtsextreme brauchen für ihre Erzählung einen Feind, gegen den sie sich als einzige Schutzmacht des deutschen Volkes inszenieren können. Mal waren es die Juden, mal die Kommunisten. Muslime als Angehörige einer ,kulturfremden‘, ,unzivilisierten‘ Religion kamen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als neues Feindbild gerade recht.“
Dass Islamisten seit langem den gesamten Westen als Feindbild kultivieren – und zwar unabhängig davon, ob seine Gesellschaften vorbildlich demokratisch, liberal und sozial sind oder diese für das Selbstbild entscheidenden Qualitäten gerade den Bach hinuntergehen – findet keine Erwähnung bei Marca. Und er wagt es immer noch, von „Vorurteilen“ gegenüber Muslimen in weiten Teilen der Bevölkerung Deutschlands zu sprechen, als ob es nicht gerade andersherum gewesen ist: Mit linksliberalem, menschheitsumschlingenden Gutwillen wurden die „Geflüchteten“ empfangen. Die Masse nahm es mit Gleichmut hin: Weltoffenheit hat eben ihren Preis. Sie werden sich schon integrieren. Wir schaffen das. Erst als mit den Jahren deutlich wurde, dass bei der Mehrheit der Migranten aus muslimischen Ländern keinerlei Interesse an Assimilation bestand und besteht, und man sich von den aus muslimischer Sicht dekadenten und verlachten Deutschen lediglich ein gutes Leben schenken lassen wollte, als die Gewalttätigkeit und Brutalität der jungen Muslime täglich deutsche Opfer produzierte und die Kampflinien der Heimat im Zielland auf Kosten der Einheimischen reproduziert wurden, verwandelten sich Gutmütigkeit und-willigkeit in Desillusionierung und Verdruss – und in Urteile, aber Urteile a posteriori.
Marca zitiert das Wahlprogramm der AfD für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt: „Der Islam hat unsere Geschichte und Kultur nicht geprägt und ist als politische Religion mit seinem Scharia-System und den darin enthaltenen Rechtsregeln mit unserem abendländischen Staatsverständnis nicht vereinbar.“ Diese der Realität Rechnung tragende Feststellung gefällt Marca natürlich ganz und gar nicht. Er hält dagegen: Die Parteien am rechten Rand benötigten „muslimische Gewaltakte und Herrschaftsphantasien, um größere Teile der Bevölkerung zu überzeugen“.
Rechtsextreme würden „muslimisch gelesene Menschen“ ausgrenzen. Diese fühlten sich von Jahr zu Jahr weniger der deutschen Bevölkerung zugehörig und von ihr angenommen und erlebten die offene Gesellschaft zunehmend als Farce – aber aus anderen Gründen als „unsereins“. Deutsche Muslime würden beständig mit „Diskriminierungserfahrungen, Unsichtbarkeit in den Medien und in der Politik, Rechtfertigungsdruck und dem Gefühl, nie dazuzugehören, egal wie sehr man sich bemüht“ zu kämpfen haben. Sie blieben immer „Deutsche auf Bewährung“. Und wer „einmal anfängt, bestimmte Menschengruppen auszuschließen, wird die Ausschlusskriterien immer mehr ausweiten – eine Dynamik, die man auch Faschismus nennt“. Marca imaginiert die Muslime in Deutschland nicht nur als die „neuen Juden“ – obszön angesichts der antisemitischen Hassdemonstration mit Hamas- und IS-Flaggen in Berlin und anderswo – , sondern spult auch das bekannte Diktum ab: AfD gleich NSDAP.
Zugehörigkeit und Angenommen-Werden: Die das Stadtbild vielerorts prägenden beziehungsweise dominierenden muslimischen und afrikanischen Jungmänner und Großfamilien feiern ihre gute Laune ausschließlich miteinander und erwecken nicht den Eindruck, als würden sie sich wünschen, Biodeutsche wären dabei. Im Gegenteil: „Wir“ wirken eher wie eine Störung ihrer Kreise. Als Kunden brauchen sie „unsereinen“– aber an Gesprächen mit uns sind nur die wenigsten interessiert. Minimaler Austausch. Keine Neugier. Keine Abstraktionsfähigkeit. Eine befreundete Lehrerin für Englisch und Deutsch teilte mir mit, dass mindestens 65 Prozent der aus Afrika emigrierten Schüler, auch die hier geborenen, nicht das durchschnittliche Bildungsniveau des deutschen Nachwuchses erreichen – und mit diesem geht es ja auch schon seit geraumer Zeit kontinuierlich abwärts. Wir leben unter den gleichen materiellen Umständen, aber unsere Kulturen, unser Verhältnis zu Menschen und zum Sein im Allgemeinen trennen Welten. Und nicht nur der fehlenden gemeinsamen Sprache ist es geschuldet, dass wir auf parallelen Bahnen unterwegs sind. Die treffen sich bekanntermaßen im Unendlichen.
Und ein weiterer Punkt zum Thema „Zugehörigkeit und Angenommen-Werden“: Wie kann man ernsthaft erwarten, von einer Bevölkerung angenommen zu werden, wenn man diese ausnutzt und dennoch bekämpft – bis hin zur Tötung – und meist nur mit Negativverhalten auffällt? Keine andere Migrantengruppe flößt den Eingeborenen soviel Furcht ein und bestimmt dermaßen den öffentlichen Raum – selten auf positive Weise. Von den muslimischen Messermännern, Terroristen und raumgreifend auftretenden Talahons kein Wort von Marca. Von der Wirklichkeit lässt sich der Konvertit nicht beirren. Theoretisch ist der Islam genauso friedlich wie das Christentum heute. Praktisch ist er es in der Gegenwart leider nicht – aber das kriegen wir nach Ansicht des Autors schon noch hin, jedenfalls dann, wenn sich sie Autochthonen mehr bemühen würden.
Auch etwas anderes, derzeit gerade wieder Virulentes, sollten wir Marcas Auffassung nach hinbekommen: Der Autor beschreibt seine erste Pilgerreise als Muslim, die ihn nach Kerbala führt. Von der Hitze abgesehen empfindet er die Wallfahrt als eine optische, akustische und olfaktorische Zumutung. Das versprochene „Wunder von Kerbela“ sieht der Leidende in der Betreuung Freiwilliger am Wegesrand und dem Credo: „Es ist egal, wie reich oder arm du bist. Die Iraker füttern dich durch.“ Zudem beeindruckt ihn der Wille der Alten, Kranken und Kinder, diese Völkerwanderung durchzustehen. Doch dann erblickt er am Straßenrand Mülleimer mit aufgemalten Zionismus-Sternen und schreibt dazu: „Ich bin zunächst naiv und glaube noch, dass sich die Feindseligkeit in Luft auflösen würde, wenn nur Israel aufhören würde, die Palästinenser im Westjordanland zu unterdrücken und Gaza zu zerbomben.“ Ein Iraker auf dem Pilgerweg lacht ihn aus: „Israel ist unser Erbfeind…Der Glaubenskrieg zwischen Juden und Muslimen ist so alt wie der Islam.“
Marcas Fazit seines Kreuzweges der anderen Art überrascht dann aber doch. Er benötigte wohl ein Distinktionsmerkmal, um seinen „notwendigen Realitäts-Check“ ansatzweise glaubwürdig zu machen: „Am Ende der Reise bin ich zwiegespalten. Erfüllt von all der Solidarität, die wir als Pilger erlebt haben. Aber auch ernüchtert. Die Spiritualität des Islam, das, wonach ich suchte, habe ich in Kerbala nicht gefunden. Stattdessen oberflächlichen Fanatismus, Machtpolitik, selbstverschuldete Unmündigkeit.“ Er ist so zwiegespalten, wie der Islam es in seinen Augen ist: Hie Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Toleranz und Nächstenliebe, hie Fanatismus, religiös geleitete Politik, Misogynie und Antirationalismus.
Und was die „Ausgrenzung“ und „Unsichtbarkeit in Medien und Politik“ betrifft: Gerade in Medien, Werbung, Bildung und Kunst scheint es einen Wettbewerb darum zu geben, wer wie viele Muslime zeigt und – natürlich positiv oder als Opfer – darstellt, fördert und zu Wort kommen lässt, auf dass sich die Bevölkerung an ihre Dauerpräsenz und ihre angeblich berechtigten Forderungen gewöhne. Dies trifft ebenso auf die Politiker zu. Ständig wird der Bürger mit Quotenmuslimen konfrontiert. In Frankfurt gibt es eine Ramadan-Beleuchtung, demnächst auch in München. Gewaltsame Übergriffe gegen Islamgläubige, von welcher Seite auch immer, sind selten. Die Gewaltausübungen von Moslems gegen die deutsche Bevölkerung fallen dagegen unverhältnismäßig hoch und brutal aus im Vergleich mit anderen Migrantengruppen und mit Deutschen. Die meisten Medien suggerieren das Gegenteil.
Das ficht die Religionswissenschaftler Monika und Udo Tworuschka nicht an: „Der Islam besticht insbesondere durch seine große Sozialverantwortung. Islamische Werte wie Brüderlichkeit, Solidarität, Respekt gegenüber älteren und kranken Menschen bereichern unsere teilweise recht ‚kalte` Gesellschaft.“, zitiert Marca zustimmend. Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel können das eher nicht bestätigen.
Der Autor unternimmt noch den ehrenvollen Versuch, eine interessante Frage zu beantworten. „Inwieweit bietet sich die traditionelle islamische Glaubenspraxis – auch im Vergleich zum Christentum – besonders für radikale Auslegungen an?…Was macht den Islam anfällig für Interpretationen, die mit Demokratie und Säkularismus nicht kompatibel sind?“ Marca wartet mit einer Vielzahl von Informationen auf, die sich streckenweise spannend lesen und Wissenswertes enthalten. Er wünscht sich eine breitere und tiefere Verankerung einer Allgemeinbildung zum Islam. Möge er dies doch einmal umgekehrt von den Moslems erwarten, die trotz einer in ihren Augen falschen und gefährlichen Religion, die seine Bürger in ihren Augen zu Ungläubigen macht, ins Land ihrer Wahl gezogen sind. Und was hilft es den Bürgern zu wissen, dass das Wort „Scharia“ mit „Weg zu Gott“ zu übersetzen ist? „Grau… ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum“, befand einst Goethe. Bezüglich des Islams scheint es umgekehrt zu sein.
Dieses Buch ist wohl zum größten Teil als Selbstvergewisserung und -rechtfertigung zu lesen. Und im Grunde ist bereits der Buchtitel irreführend, denn es existiert gar keine wirklich öffentliche, also restriktionsfreie Debatte zum Islam. Es gibt einen Diskurs bei denen, die der Autor als „rechten Rand“ bezeichnet – und ein kanonisiertes links-liberales Narrativ, das die Leitmedien verbreiten und als das „Öffentliche“ verkaufen, obwohl es sich um das offizielle handelt. Dieses Kunstprodukt verträgt keinen Sauerstoff der freien Rede. Es gedeiht nur unter Luftabschluss. Trotz einzelner positiver Ausreißer kann man deshalb das Buch als Ganzes nur als scheinkritisch bezeichnen.
Teseo La Marca, „Die fehlgeleitete Islam-Debatte und ihre Folgen: Ein notwendiger Realitäts-Check“ , Westend Verlag, 2025, 256 Seiten, 24 Euro
Souverän ist nicht, wer den Ausnahmezustand beschwört
Markus Vahlefeld zerlegt in seinem Buch „Die Krisenmaschine“ den politisch-medialen Apparat, der permanent Angst produziert, um die Gesellschaft nach Belieben lenken zu können
Von Alexander Wendt
Gleich zu Beginn erfährt der Leser von Markus Vahlefelds „Krisenmaschine“, dass das Buch ursprünglich anders heißen sollte, nämlich: „Der Hitzetod ist nur die Spitze des Eisbergs“. Bei dem Zitat handelt es sich um einen völlig ernst gemeinten Satz des SPD-Politikers Karl Lauterbach, der für zweierlei steht: Zum einen die Lächerlichkeit, die heute Äußerungen und Auftritte der politischen Klasse durchzieht, zum anderen die unentwegte Beschwörung unmittelbar bevorstehender Katastrophen. Weder das eine noch das andere stößt in den meisten Medien auf Spott und Kritik. Denn auf beiden Feldern herrscht längst ein unauflösliches politisch-mediales Einverständnis, weshalb Lauterbach auch nicht als neuer Heinrich Lübke gilt, sondern als verantwortungsvoller Mahner vor der jeweils nächsten gesellschaftlichen Maximalbedrohung.
Der Autor entschied sich dann doch für einen Titel, der das alles in allem nicht komische Thema griffiger zusammenfasst. Vahlefeld befasst sich – soweit ersichtlich, als erster Autor überhaupt – mit dem Begriff „liberale Demokratie“, zu deren Merkmalen der politisch-mediale Gleichschritt gehört, aber noch Einiges mehr.
„Liberale Demokratie“ gilt denjenigen, die diese Formel affirmativ gebrauchen, erstens als notwendige Weiter- und vor allem Höherentwicklung des hergebrachten Verfassungsstaates – und zweitens als Gegenentwurf zur „autoritären Demokratie“, also zu Staaten, in denen rechte Politiker Wahlen gewinnen. Diese „liberale Demokratie“, so lautet die zentrale These des Autors, benötigt eine permanente Krisenrhetorik, mit der sich der politisch-mediale Komplex legitimiert, da er die Legitimation durch Wahlen ja gerade ablehnt und Mehrheitsentscheidungen nur dann akzeptiert, wenn sie die aus seiner Sicht richtigen Ergebnisse hervorbringen.
Vahlefeld beschreibt also „die Krisenmaschine, zu der sich die liberale Demokratie entwickelt hat“. In seiner Analyse präpariert er den Kern dieser Herrschaftstechnik heraus, die sich in Deutschland die Bezeichnung „unsere Demokratie“ gibt: den selbstverordneten Rollenwechsel der angestammten Medien von der Regierungskritik zur Kritik an Bürger und nichtlinker Opposition. Denn daraus ergeben sich zwangsläufig Konsequenzen für fast alle anderen gesellschaftlichen Bereiche. „Der Zustand der Medienlandschaft“, so Vahlefeld, „ist ein Frühindikator für den Zustand der Gewaltenteilung, die in den Medien als vierter Gewalt ihren überbauten Hüter haben sollte. Der Theorie nach. Nehmen die real existierenden Medien – aus welchen Gründen auch immer – ihre oppositionell-gehässige Aufgabe nicht mehr wahr, sondern verstehen sich als verlängerter Arm eines staatlichen Verantwortungspathos, ist auch die Trennung in Exekutive, Legislative und Judikative in Gefahr […]. Es ist eines der auszeichnenden Merkmale aller sogenannter liberaler Demokratien, die Medien für den Fortbestand des Systems vereinnahmt zu haben.“
Mit seiner analytischen Methode, Strukturen kenntlich zu machen und Wertungen nur sparsam einzustreuen (was übrigens das Gewicht der Wertungen steigert), arbeitet Vahlefeld Kapitel für Kapitel das Wesentliche heraus, für das er den Blick seiner Leser scharfstellen will. Beispielsweise, dass die Krisenmaschine nicht zur Bekämpfung echter Krisen dient, sondern zur Aufrechterhaltung eines permanenten Krisengefühls und damit eines Ausnahmezustandes, der wiederum alte demokratische Praktiken wie Rede und Gegenrede suspendiert. Das führt er exemplarisch an der Klimakatastrophenrhetorik vor: „Sollten die Treibhausemissionen wirklich für den Klimawandel verantwortlich sein, dann dünkt es töricht, aus der CO2-ärmsten Energieerzeugung willentlich auszusteigen, während dann die Emissionen bei der Stromerzeugung in Deutschland zu den höchsten der industrialisierten Welt werden. Der Verdacht liegt also nahe, dass die Politik an den Hitzetod nur bedingt glaubt. Nichtsdestotrotz benötigt sie diesen Glauben von ihren Untertanen.“
Das Beispiel ließe sich mühelos auf andere Felder der Auseinandersetzung erweitern: Obwohl Politik und Medien in Deutschland während der Corona-Zeit die Virusbekämpfung zum überragenden Staatsziel erklärten, das sogar über den Grundrechten stand, gab es anders als in anderen Ländern niemals eine größere Stichprobe zur Ausbildung von Antikörpern, um zu beurteilen, wie weit die symptomlose Durchseuchung schon fortgeschritten war. Überhaupt existierten selbst am Ende der Covidjahre in der sonst so aufschreibbesessenen Bundesrepublik erstaunlich wenige Daten, es fand praktisch auch keine Evaluierung der staatlichen Maßnahmen statt. Angesichts der Härte, mit der sie damals gegen Bürger vorgingen, mutet es bemerkenswert an, dass Politik, Exekutive (und viele Medien) gar nicht so genau Bescheid wissen wollten, obwohl es sich doch angeblich um eine neue „Pest“ (Markus Söder) handelte. Und es wirkt genauso seltsam, dass die Bundeswehr trotz der beschworenen Bedrohung durch Russland bis heute ohne nennenswerte Drohnenabwehr dasteht.
Die Krisen- und Bedrohungsbeschallung stellt den Ausnahmezustand auf Dauer. Weder Klimarettung noch der Kampf gegen rechts kennen konkrete Ziele und irgendwelche Eingrenzungen. „Der politische Vorteil von derartigen planetarischen Todesängsten liegt in der […] nicht zu unterschätzenden Tatsache begründet“, meint der Autor, „dass sich die Zeitachse der Problemlösungen ins Unendliche erweitert. Politiker und Medien, die das Klima, das in 50 Jahren herrschen wird, meinen beeinflussen zu können, legen den Maßstab der Überprüfung, ob ihre Handlungen wirklich von Erfolg gekrönt waren, so weit in die Zukunft, dass sie sich nie an ihm werden messen lassen müssen.“
Er weist auch darauf hin, dass das Rhetorikfeld „Krieg“ weit mehr umfasst als Rüstung und militärische Bedrohungslage: Die taz-Journalistin Ulrike Herrmann, ständiger Gast auf allen möglichen Podien und eine der prominentesten Krisenmaschinisten, fordert die Umstellung der gesamten Ökonomie auf Kriegswirtschaft nach dem Vorbild von England in den Jahren 1940 bis 1945. Nur so, argumentiert sie, ließe sich die Menschheit noch vor dem Klimatod retten. Mit solchen Überlegungen steht sie zwar gegen eine absolute Mehrheit in der Bevölkerung, aber mitten im politisch-medialen Apparat.
„Sich im Kriegszustand zu befinden“, heißt es in der „Krisenmaschine“, „ist für die Politik und die Medien ein kommoder Zustand. Der Kriegsfall als größtmöglicher Ausnahmezustand verlangt nach Sondergesetzen und Ungleichbehandlung, verlangt nach Wohlstandsverzicht und nach Unterordnung unter die alternativlose Verteidigung der Werte.“
Wie kommt es ausgerechnet zu der Selbstetikettierung als „liberal“, laut Vahlefeld mittlerweile die „staatstragende Eigendefinition“ schlechthin? „Liberal“ und „Staat“ passen besonders gut zueinander. Dieses Paradox löst er mit dem Hinweis auf, dass sich das Adjektiv hervorragend eignet, um das notorisch konfliktscheue Neobürgertum anzusprechen: „Sie machen alles mit, solange ihnen der mentale Überbau vermittelt wird, sich im Widerstand gegen das Böse zu befinden. Und dieses Böse ist im Deutschland der Jahre 1968 ff. natürlich alles, was der deutschen Nation auch nur den Hauch einer Rechtfertigung geben könnte. Die Angst, jemals wieder einem totalitären Regime auf den Leim zu gehen, hat in Deutschland beileibe nicht zu einem grundsätzlichen Misstrauen gegen jede Form der staatlichen Machtausdehnung geführt […]. Die große Angst der Deutschen besteht also mitnichten darin, erneut staatlichen Dekreten zu folgen, sondern die große Mehrheit hat schlicht nur Riesenangst, dass es nochmals die falschen staatlichen Dekrete sein könnten. Alle Menschen müssen der nun herrschenden Staatsideologie folgen, damit sich niemals wiederholen kann, was vor 80 Jahren geschah, als alle Menschen der herrschenden Staatsideologie gefolgt sind.“
Wer so denkt, dem fällt der performative Widerspruch gar nicht auf, dass der Staat angebliche Nichtregierungsorganisationen, die für die angeblich liberale Demokratie kämpfen, systematisch durchfinanziert.
Ein ganz wesentliches Verdienst dieses Buchs besteht darin, dass es nicht nur propagandistischen Begriffen der Gegenwart ihre Hüllen abnimmt und nachsieht, was darunter steckt, sondern sich auch dafür interessiert, wie bestimmte Formeln überhaupt erst entstanden. Er macht den Urschöpfer der Marke „liberale Demokratie“ zielsicher in der „Weltmacht Habermas“ (Zeit) aus, der erstens die EU für ein „höherstufiges politisches Gemeinwesen“ hält, das einen „entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einer politisch verfassten Weltgesellschaft“ darstelle und zweitens schon frühzeitig eine Idee davon entwickelte, wie der Meinungsbildungsprozess in einer Gesellschaft vor sich gehen sollte.
Nach Jürgen Habermas „entscheiden nicht private Einsichten, sondern die im rational motivierten Einverständnis gebündelten Stellungnahmen aller, die an der öffentlichen Praxis des Austauschs von Gründen teilnehmen.“ Von dem Großdenker stammt bekanntlich auch die Formulierung „räsonierende Öffentlichkeit“, deren Witz darin besteht, dass eben nicht jeder miträsonieren darf, sondern nur ein von vornherein begrenzter Kreis.
Vahlefeld übersetzt das aus dem Habermas’schen folgendermaßen ins Deutsche: „Die Einsichten des Individuums sind nebensächlich, entscheidend ist, was von ihnen im Durchlauf durch das mediale Kollektiv übrig bleibt.“ Normativ findet diese Gesellschaftsformel im Grundgesetz keine Stütze. Deskriptiv lag und liegt Habermas allerdings richtig: So funktionierte die „räsonierende Öffentlichkeit“ der Bundesrepublik, in der eben nur zertifizierte Stellungnehmer miträsonieren durften, über lange Zeit tatsächlich. Dieser für die Eliten paradiesische Zustand änderte sich nicht nur in Deutschland radikal durch das Aufkommen der Neuen Medien. Die Türhüter und Themenlenker büßten ihre Macht ein, seit wirklich jeder miträsoniert. Bei X übernimmt zum gewaltigen Zorn des tonangebenden Milieus das breite Publikum mit den community notes auch noch die Faktenüberprüfung, und entmachtet damit die Faktenchecker der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Diese Sender ziehen sich unter anderem deshalb von der Plattform zurück, weil dort an ihren Verlautbarungen ziemlich oft eine Korrekturnote klebt. Die „liberale Demokratie“ stellt den ziemlich verzweifelten Versuch dar, die gefallene Deutungshoheit der Priesterkaste wieder aufzurichten: Mit dem Digital Service Act der EU, der die Tür zur Internetzensur öffnet, mit Forderungen von links, nach einer „Zerschlagung“ von X und Facebook, mit dem Aufbau einer „Zivilgesellschaft“, die den Wohlgesinnten als einzige legitime Größe beim Meinen und Kritisieren gilt – und mit der Verlagerung von immer mehr politischen Entscheidungen auf die EU, die WHO und andere Organisationen, die sich nicht um den Wählerwillen kümmern müssen.
Die „Krisenmaschine“ erwähnt auch das Manifest dieser autoritären Gesellschaftslenker: das Buch des Zeit-Redakteurs Mark Schieritz mit dem Titel „Zu dumm für die Demokratie. Wie wir die liberale Ordnung schützen, wenn der Wille des Volkes gefährlich wird“. Es bildet gewissermaßen den tiefliegenden Endpunkt einer geistigen Entwicklung, die mit Habermas ihren Lauf nahm.
Die im Wortsinn freiheitliche Hoffnung ruht darauf, dass selbst noch so viele Milliarden für NGOs und noch so viel Angstszenarien die alte Türsteherwelt nicht zurückbringen. Wer sich mit dieser zentralen Frage auseinandersetzen will, findet in Markus Vahlefelds nüchtern-sachlichem und zugleich elegant geschriebenen Buch anregenden Stoff, der auch in den kommenden Jahren aktuell bleibt. Den Versuch zur autoritären Gesellschaftslenkung mit dem Schutzbegriff „liberal“ zu tarnen, urteilt der Autor, wird „als eine der größten Lügen des Westens in die Geschichte eingehen“.
„Ich musste fort nach dem kalten Berlin“
Eine kleine literarische Sensation: Erst jetzt erscheint der nachgelassene erste Roman Sebastian Haffners – eine Geschichte von Eifersucht und Epochenbruch
Von Pascal Morché
Was, wenn auf diesem Buch ein anderer Autorenname stünde? „Raimund Pretzel“ zum Beispiel. Würde es gekauft, rezensiert, gelesen? Ja, wäre es überhaupt gedruckt worden? Ziemlich sicher: nein. Der Name jedoch, der auf dem Buch steht, Sebastian Haffner, er bürgt zweifellos für einen der hellsichtigsten und klügsten Autoren während der Zeit des heraufziehenden Nationalsozialismus. Haffners 1939 im Londoner Exil verfasste, aber erst ein Jahr nach seinem Tod im Jahr 2000 erschienene Erinnerungen „Geschichte eines Deutschen“ erleben bis heute einen gigantischen Verkaufserfolg; außerdem fallen einem zum Namen Sebastian Haffner sofort dessen „Anmerkungen zu Hitler“ (1978) ein. Der Name Haffner ist ein Köder – und es ist legitim für einen Verlag, Leser zu ködern, dass sie den kleinen, charmanten Roman von Sebastian Haffner kaufen mögen.
Sebastian Haffner schrieb „Abschied“, dieses autobiografische Buch, 1932 im Alter von 24 Jahren als Raimund Pretzel; auch der Held des Buches heißt so. Dass die Familie Haffner/Pretzel den Text erst jetzt zum Abdruck freigab, mag der Familienbande geschuldet sein – und erinnert auch ein wenig an den Sohn von Lee Miller, der Fotografin in Hitlers Badewanne. Wenn man Werke solcher Ahnen in der Schublade hat…
Worum geht’s in „Abschied“? Der 24-jährige Raimund, „Referendar am kleinen Amtsgericht in Rheinsberg“ bei Berlin, fährt im Herbst 1932 für vierzehn Tage nach Paris, um seine heiß geliebte Teddy zu besuchen. Teddy, wohl voller Vorahnung des kommenden politischen Unheils, ist aus dem dumpfen Deutschland nach Paris emigriert und lebt hier als Studentin ein leichtes, unbeschwertes Bohèmeleben. Raimund lernt es kennen: „Ich lebte hier mit ihr in einem Netz von kurzfristigen Verabredungen, und den größten Teil der Zeit verbrachte ich damit, mich über die vertane vorige zu ärgern und mich auf die nächste zu freuen – dies, obwohl ich wusste, dass es auch wieder nichts Rechtes werden würde.“ Teddys Freunde sind ebenfalls erste Exilanten, gestrandete Künstler, „Smokingproleten“; der linkische Horrwitz, die kapriziöse Mademoiselle Gauld (mit einer ebenso kapriziösen Armbanduhr, die sie Raimund leiht), oder auch Franz Frischauer „von Beruf verlorener Sohn…groß, blond und sehr schön…er war sehr befreundet mit Teddy und ich war sehr eifersüchtig auf ihn.“ Franz hatte man nächtens überfallen, übel zugerichtet und ihm auch seine Hose, „die noch nicht spiegelte“, gestohlen. Er ist nicht gut auf die Franzosen zu sprechen: „Wenn‘s einen Krieg gäbe, da würden wir uns sogar vielleicht wiedersehen, Herr Pretzel, was? Da könnten wir in derselben Flammenwerferbatterie stehen. Da würden wir Paris zerschießen. Das gäb ein Leben, was?“. Raimund entgegnet: „Na, ich hab ja kein so sehr großes Kriegsbedürfnis“ und leiht Franz eine seiner Hosen.
Unerbittlich naht der Abschied für Raimund von „der kleinen Bohèmestudentin“ Teddy am Gare du Nord. Abends um zehn geht der Zug. Der Leser erlebt die letzten Stunden des Abschieds: „Ich musste fort nach dem kalten Berlin“. Teddy wird dorthin nicht zurückkehren. Raimund: „Du hast Angst vor Berlin“. Teddy antwortet: „Ja“. In der Nacht vor diesem Abschiedstag ist man auf einem „Ball“ an der Sorbonne gewesen, was Raimunds Eifersucht auf Teddys Freunde nochmals extrem steigert. Die Geliebte ist zumeist erschöpft, man hat sich verkracht und versöhnt in dem kleinen, schäbigen Hotelzimmer und eilt, rast, „saust“ nun atemlos durch Paris. So viel will Teddy ihrem Raimund noch zeigen: Die Venus von Milo im Louvre, und auf dem Eiffelturm sollte er auch gewesen sein. Der Leser erlebt ein Paris, in dem man solche Unternehmungen noch spontan entscheiden konnte; in dem die Menschen „feierlich“ durch den Louvre schritten.
Teddy ist misstrauisch gegenüber dem ihr an Bildung überlegenen Raimund, obwohl dieser mitunter ein ziemlich schlechtes Deutsch schreibt, wenn er beispielsweise Teddy einen Stiefel „über ihr eines Bein“ stülpt. Mögen diese sprachlichen Unzulänglichkeiten, die durchaus ihren Charme haben (und die schönerweise weder der Autor selbst noch ein Lektor korrigierte), Teil des atemlosen Schreibens eines sehr jungen, begabten Autors sein, der dadurch authentisch „eine Euphorie des Abschieds“ wiedergibt. In dieser Flüchtigkeit (des Schreibens) inklusive seiner Flüchtigkeitsfehler schwingt eine wunderbare Leichtigkeit und Sehnsucht junger Menschen von 1932 mit, wie es sie heute nicht mehr gibt.
Kurz bevor Raimunds Zug am Gare du Nord abfährt, findet sich die schönste Metapher des ganzen Buches: „Allmählich hatte ich Angst, nach den Uhren zu sehen, es war, als wären die Zeiger um meinen Hals gelegt, um mich zusammenrückend, langsam zu erwürgen,“ schreibt Raimund Pretzel, alias Sebastian Haffner, auf dessen Grabstein in Berlin-Lichterfelde übrigens Raimund Pretzel steht.
Diese Rezension erschien unter einem anderen Titel bereits in der Weltwoche.
Sebastian Haffner, „Abschied“, Hanser Verlag München, 2025, 192 Seiten, 24 Euro
Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” – fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt –, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.
Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.
Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.
Publico ist am Ende, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.
Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto
A. Wendt/Publico
DE88 7004 0045 0890 5366 00
BIC: COBADEFFXXX
Die Redaktion
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.


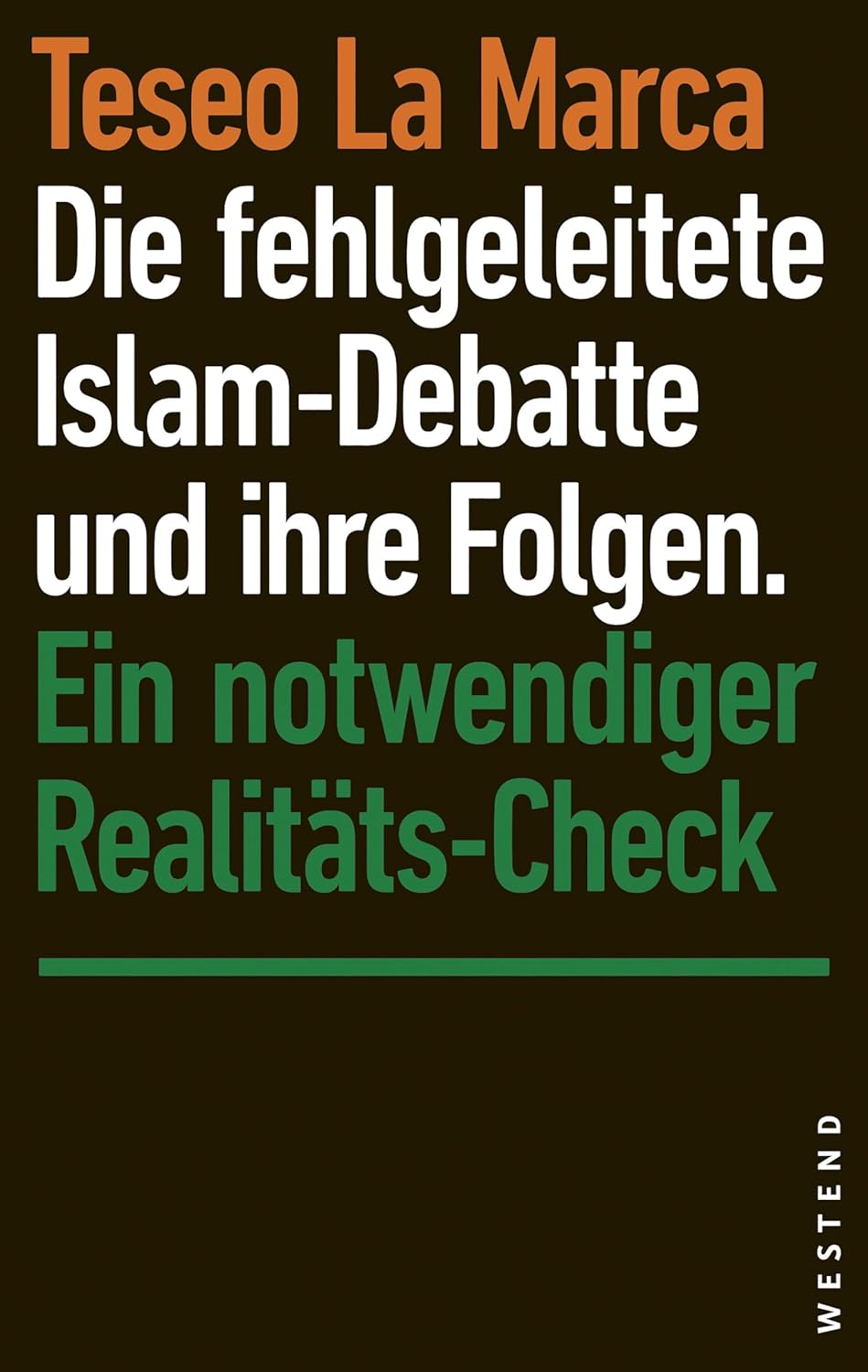
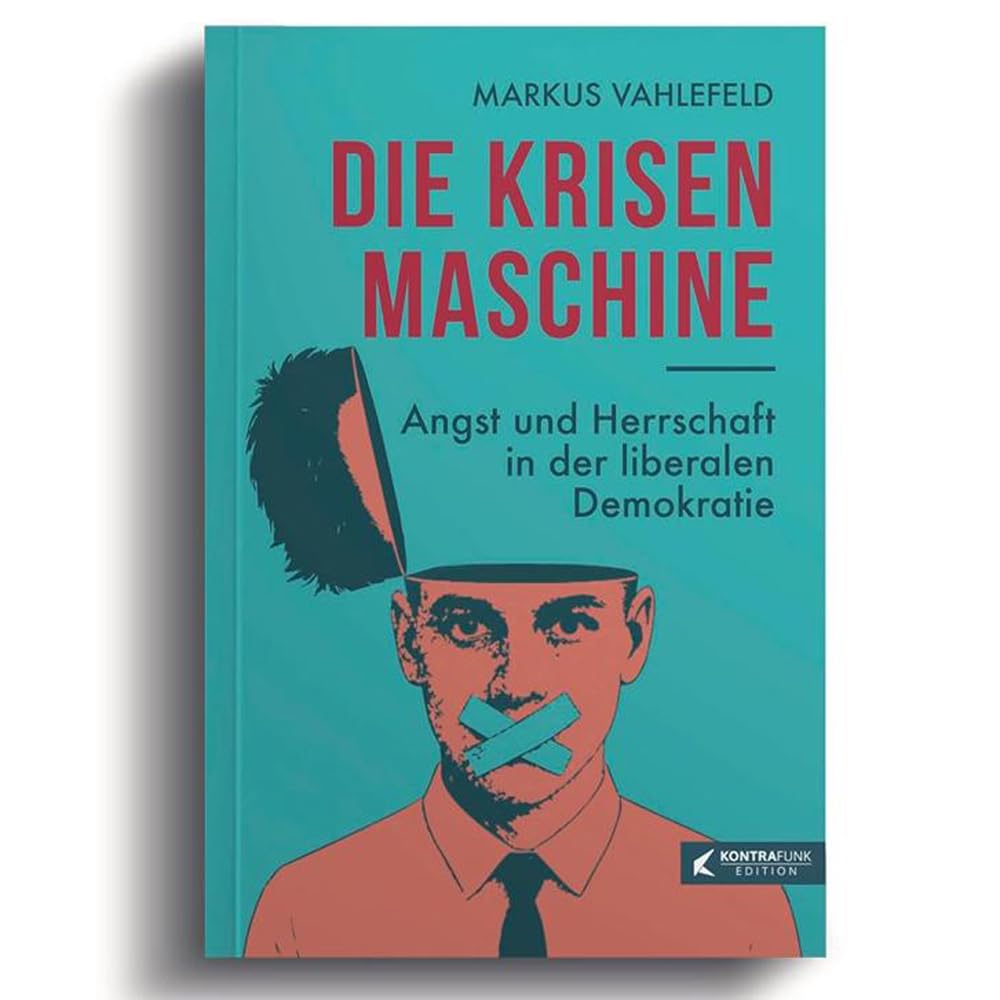
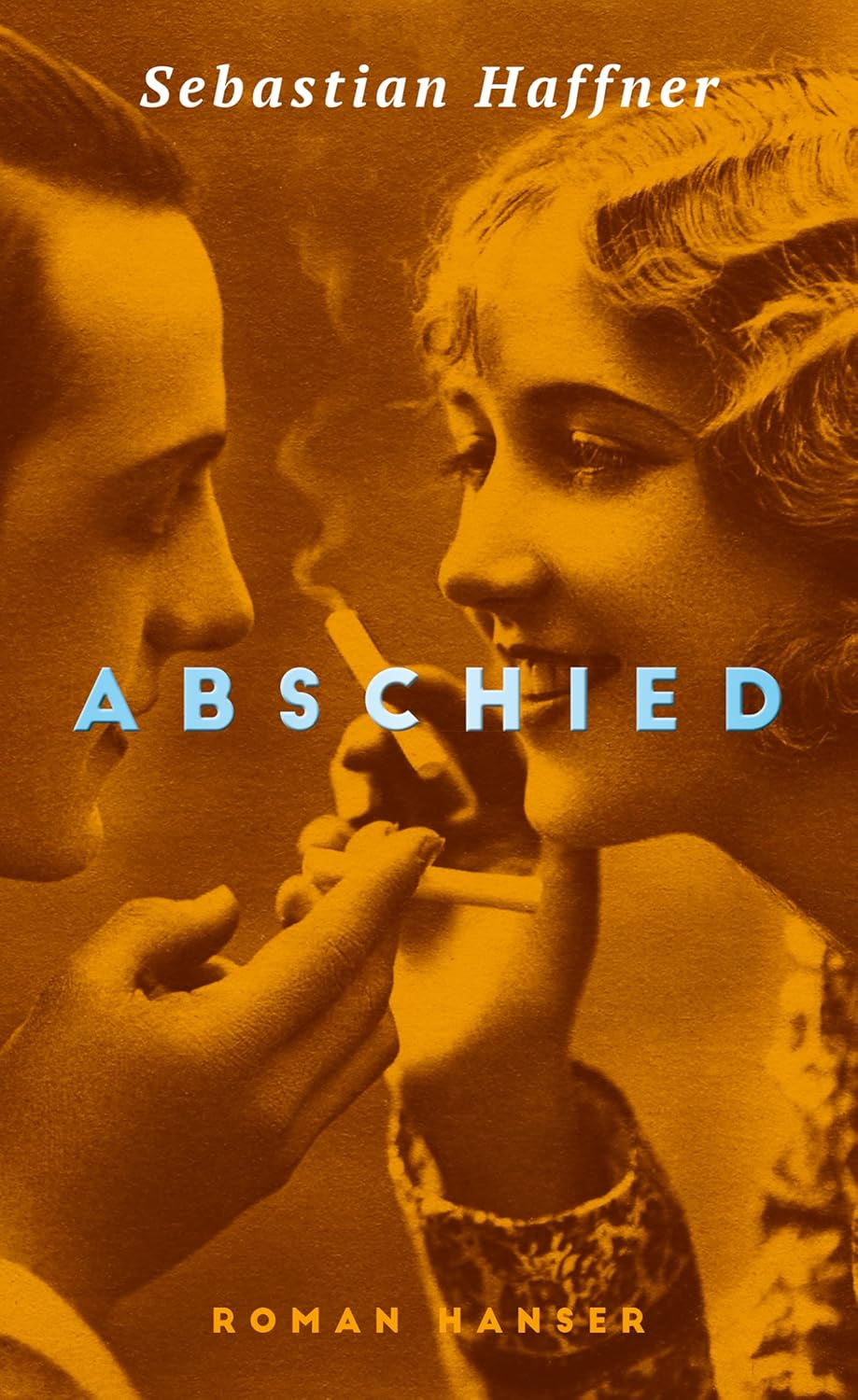



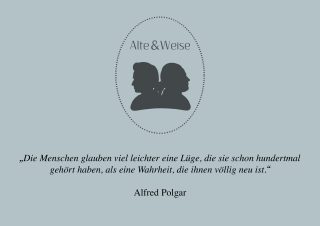

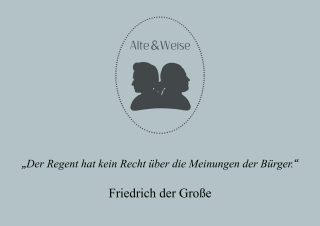

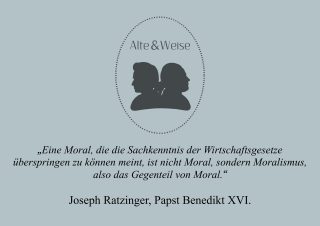


Isabel Kocsis
23.09.2025Teseo La Marca sollte erst mal den Koran und das Hadith lesen, sich mit der Biographie Mohammeds (Vorbild) beschäftigen und etwas Geschichtswissen bezüglich der Ausbreitung des Islams recherchieren. Zum Beispiel taucht im Koran des öfteren die Bezeichnung auf, die Ungläubigen seien törichter als das Vieh. Ob das ein Ansporn ist obige, vom Westen ausgehende Argumente zu hören?
Werner Bläser
24.09.2025Ich finde die Mohammed betreffenden Kapitel bei dem klassischen persischen Historiker at-Tabari (lebte um das Jahr 900 und war vom frühesten Mohammed-Biographe al-Ishak beeinflusst) besonders aufschlussreich. Seine Weltgeschichte ist in englischer Sprache vollständig im Internet Archive lesbar.
Martin
23.09.2025Bei Aussagen wie denen der „Religionswissenschaftler“ „Der Islam besticht insbesondere durch seine große Sozialverantwortung. Islamische Werte wie Brüderlichkeit, Solidarität, Respekt gegenüber älteren und kranken Menschen bereichern unsere teilweise recht ‚kalte` Gesellschaft.“, kann man sich ja auch ganz praktisch und empirisch anschauen.
Millionen Muslime flüchten vor innermuslimischen Konflikten und Kriegen in nichtmuslimische Gemeinschaften.
Gibt es auch nur ein Beispiel dafür, dass Juden, Christen, Hindus oder Buddhisten in größerer Zahl in muslimische Gemeinschaften flüchten/geflüchtet sind? Nein? Warum?
Werner Bläser
24.09.2025Zu Haffner. Ich habe ihn in meiner Jugend noch häufig im Fernsehen erlebt (Sendungen von solcher Qualität wären heute undenkbar – er würde sofort aus dem Studio geprügelt). Sein Buch „Germany, Jekyll and Hyde“im englischen Exil, meiner Erinnerung nach sogar noch als dort Internierter, konzipiert, gehört zu den politisch wirkmächtigsten von deutschen Autoren geschriebenen – Churchill machte es zur Pflichtlektüre für seine Kabinettsmitglieder und Spitzenbeamten. Haffner beschreibt darin das Umkippen Deutschlands in eine Diktatur. Gerade heute sollte dieses Buch wieder Pflichtlektüre werden. –
In seinen späteren Erinnerungen beschreibt Haffner, der ja wie sein Romanheld selbst ein kleines Rädchen an einem Amtsgericht gewesen war, die Existenzangst gestandener Richter angesichts der ins Justizsystem gehievten jungen Nazirichter. Sie wagten aus Angst um ihre Pensionen nicht, deren teilweise absurde Urteile zu kritisieren.
Haffner würde heute wohl wieder aus Deutschland weg ins Exil gehen – allerdings nicht mehr nach England.