Die Moral der Ewiggrünen, Tagesschau-Kammerflimmern, ein anrührender Migrationsroman ohne Anklage: Alexander Wendt, Beate Broßmann und Artur Abramovych besprechen neuen Lesestoff
Weltrettung in deutschen Heizungskellern
Bernd Stegemann legt mit „In falschen Händen“ eine Mentalitätsstudie zu den Grünen und ihrem Biotop vor. Sein Buch erklärt, wie diese Kraft zur deutschen Überpartei aufsteigen konnte, die auch schwere Niederlagen überlebt. Und warum diese Bewegung nicht so schnell verschwindet
von Alexander Wendt
Sein Buch über die Grünen beendete Bernd Stegemann, wie er in der Einleitung schreibt, elf Tage nach dem Bruch der Ampelkoalition im November 2024. Er nimmt das vorläufige Scheitern der Partei an und in der Regierungsverantwortung noch mit auf, in seinem auf 176 Seiten angelegten Essay setzt er sich vor allem damit auseinander, wie die Grünen mit ihrer einmal eroberten Deutungshoheit das ganze Land prägen. Kommt „In falschen Händen: Wie Grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ also zu spät? Nein, ganz und gar nicht. Denn erstens handelt es sich bei den Grünen um die parteigewordene „Moral des gehobenen Bürgertums“, eine ziemlich abgewirtschaftete, aber noch intakte Doppelmoral, wie Stegemann feststellt. Das Milieu existiert nach wie vor, seine Angehörigen besetzen immer noch außerordentlich viele Positionen im zwar nicht unbedingt wert-, aber sinnschöpfenden Sektor. „Abgewirtschaftet“ bedeutet eben noch längst nicht erledigt. Und zweitens bleibt die sehr tief in der deutschen Mentalitätsgeschichte verankerte Bewegung auch weiter eine realpolitische Macht weit über ihre eigenen Parteigrenzen hinaus, schon deshalb, weil mehrere andere Parteien in einem Wettbewerb stehen, wer ihre Begriffe und Denkmuster am authentischsten kopiert. Es muss also nicht viel bedeuten, dass „die Partei, die jeder gut finden musste“, wie der Autor mit einem maliziösen Anflug schreibt, vorerst nicht mehr am Kabinettstisch sitzt.
Titel und Untertitel wirken etwas zu schmal gewählt für die Breite des Buches, das ganz grundsätzlich danach fragt, wie diese Partei zu einem Einfluss gelangen konnte, der spätestens seit 1998 weit über ihr nominelles Stimmergebnis hinausgeht. Andererseits trifft er mit seiner auf dem Cover verkündeten These mitten ins Selbstbewusstsein des einschlägigen Milieus, wenn er feststellt, dass Ökologie in der vorgeblichen Ökopartei bestenfalls noch eine Fassadenfunktion erfüllt. Vom Notstand der Welt, die in der Klimahölle zu verbrennen droht, leiten Partei und ihre gesellschaftliche Trägerschicht ihre Weltrettungsmission ab, die weder Aufschub noch Fragen duldet, schon gar keinen Zweifel. In diesem Moralpanzer überstand die Partei den Ampelsturz glimpflicher als die anderen beiden Partner. Und er dürfte ihr auch in allen kommenden politischen Auseinandersetzungen nützen, schon deshalb, weil keine andere Kraft über eine auch nur ähnliche Kampfmontur verfügt.
Wäre diese Montur nicht so undurchlässig, dann müsste das, was Stegemann aus dreieinhalb Jahren Ampel bilanziert, eigentlich sämtlichen grünen Kadern und ihren Gefolgsleuten in Kopf und Glieder fahren. Von Robert Habeck, zählt er auf, bleibt vor allem der endgültige Ausstieg aus der Kernkraft und damit der einzigen zuverlässigen, günstigen und CO2-freien Stromquelle, über die Deutschland verfügte. Mit der Konsequenz, dass die angebliche ökologische Musterrepublik zu den europäischen Ländern mit dem höchsten Kohlendioxidausstoß pro Kopf gehört. Unter Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wurde die Borchert-Kommission aufgelöst, die eigentlich Vorschläge für die Verbesserung des Tierwohls liefern sollte. Die Hinterlassenschaft von Umweltministerin Steffi Lemke besteht im Wesentlichen aus der gigantischen Geldversenkung in angebliche chinesische Klimaprojekte, die nur auf dem Papier existierten. Und warum erfand Annalena Baerbock eine feministische Außenpolitik, die dann auch kaum zu greifbaren Resultaten führte (das Einfliegen junger Männer aus Afghanistan lässt sich nun mal schlecht unter diese Überschrift rechnen). „Warum keine ökologische Außenpolitik?“, fragt Stegemann. Ökologie definiert er als schonenden Umgang mit der Natur, mit Ressourcen und der Gesundheit nicht nur der Umwelt, sondern auch der darin lebenden Menschen, also ungefähr so, wie Greenpeace das einmal ganz früher in seiner Gründerphase tat, aber heute ebenso wenig wie Habecks und Baerbocks Partei.
Der Autor, Jahrgang 1967, von Beruf Dramaturg, zählte 2018 zu den Gründern der gescheiterten linken Sammlungsbewegung „Aufstehen“. Heute sieht er sich nicht mehr als Linker, bedient sich aber nach wie vor des Handwerkszeugs der Machtanalyse und Machtkritik, wie sie sich in besseren Zeiten im progressiven Lager von selbst verstand. So, wie er in anderen seiner Bücher soziale Themen vorrangig als Verteilungskonflikte sieht, leitet er auch seinen Ökologiebegriff ab, der ohne jede romantisch-esoterische Überhöhung auskommt.
Durch Stegemanns Ansatz, die Grünen zunächst an ihren eigenen Maßstäben – oder vielmehr ihrer Rhetorik – zu messen, unterscheidet sich „In falschen Händen“ von vielen anderen Büchern zum Thema. Sein Text richtet sich nicht in erster Linie an Leser, die diese Partei ablehnen (obwohl auch sie hier reichlich Argumente und Denkfiguren finden), auch nicht an den ultraharten und unerschütterlichen Kern der Bewegung – sondern hauptsächlich an den ziemlich großen Abschnitt dazwischen. Er wolle sich nicht mit den aufgelisteten Fehlern der Grünen befassen, so der Autor, sondern mit dem „Ursprung der Fehler“ – wobei der Begriff Fehler nicht recht passt, denn es handelt sich schließlich nicht um Versehen. Allerdings muss man ihm die Terminologie an dieser Stelle nicht vorwerfen, denn in mehreren anderen Passagen behandelt er ausführlich zum einen das Verhältnis von realem Inhalt und Fassade der grünen Ideologie, und zum zweiten die Selbstimmunisierung gegen jede Kritik und das, was daraus folgt: Selbstidealisierung und Anmaßung gegenüber dem Rest der Gesellschaft.
„Die Erpressung mit Gefühlen von Angst, Panik und Betroffenheit gehört von Anfang an zum Betriebsprogramm der Grünen“, heißt es bei Stegemann zur Erklärung des phänomenalen Aufstiegs von einer randständigen Kraft zur deutschen Überpartei: „Das neue Gefühlsregime und die Unlogik des Kulturkampfes sind zwei Methoden der Grünen Ideologie: Gefühle gelten als Argumente und Unterscheidungen führen nicht zur Toleranz, sondern fällen moralische Urteile. […] Die Lehre ist, dass die mühevolle Arbeit am rationalen Argument durch eine gezielte Gefühlsexpression zunichte gemacht werden kann.“
So weit zur Kampfmethode nach außen. Den Schutzwall, der keine Kritik mehr nach innen durchlässt, beschreibt das Buch mit einem Rückgriff auf die Systemtheorie Niklas Luhmanns, die davon ausgeht, dass „die blinden Flecken des einen durch die Beobachtung eines anderen aufgeklärt werden können“.
Ideologien zeichnen sich dadurch aus, „dass sie diese Aufklärung verhindern wollen, da sie ihre Einsichten für absolut gültig halten.“ Genau diese Ausrichtung ließ sich mustergültig an Habecks Politik studieren: Die Grünen verschwenden, da sie ihre Einsichten für überlegen halten, keinen Gedanken an die von ihnen selbst nicht gewünschten Rückkopplungen ihrer Politik. Dass Bürger sich fragen, warum sie finanzielle Lasten zur „Rettung des Weltklimas in deutschen Heizungskellern“ (Stegemann) auf sich nehmen sollten, während die Regierung auf der anderen Seite funktionsfähige Kernkraftwerke abwracken lässt, dieser Punkt spielt im Denken des Vizekanzlers keine Rolle. Für ihn führten die negative Medienberichterstattung und das Unverständnis der Bürger ins Wärmepumpendesaster, aber nie und nimmer in die offensichtliche Widersinnigkeit seiner ministeriellen Handlungen. Das gilt im großen Maßstab für das, was der Autor das „Hyperthema Klima“ nennt: „Wenn die Welt untergeht, sind Argumente hinfällig. Es zählt dann allein die Tat, die den Untergang aufhalten kann.“
Das Buch gibt auch eine Antwort darauf, warum das krachende Scheitern selbst an den eigenen Maßstäben, warum also der permanente Selbstwiderspruch die Kernanhängerschaft der Partei überhaupt nicht verunsichert. Dort zählten eben nicht bestimmte Ergebnisse, sondern das Gefühl, auf der moralisch gerechtfertigten Seite zu stehen. Die grüne Weltanschauung, spottet Stegemann, sei in erster Linie „eine Innenweltanschauung“.
Diese Studie zur Mentalität dieses Milieus und ihrer politischen Vertretung legt dem Leser nahe, dass er den Titel „In falschen Händen“ nach zwei Richtungen verstehen kann: Zum einen, dass klassische Ökologie in Wirklichkeit für diese Kampftruppe keine Rolle mehr spielt, im Gegensatz zu Identitätspolitik und Angstbewirtschaftung. Aber auch, mit welchem Geschick und welcher Rücksichtslosigkeit diese Mandatsträger und ihre Anhänger die hochmoralische Aufladung durch grün eingefärbte Notstandsthemen – Waldsterben, Atom und jetzt eben gegen den Klimatod – zur Durchsetzung aller anderen Themen nutzen, die mittlerweile den programmatischen Kern der Grünen bilden. Also Wirtschaftslenkung, schrankenlose Migration, Durchquotierung der Gesellschaft, Islamverklärung. Egal, was ihre Vertreter auf die Agenda setzen: Sie tun es grundsätzlich im schrillstmöglichen Ton. Immer geht es um alles. Und immer gibt sich in ihren Augen jeder, der Widerspruch äußert, als Menschheitsfeind zu erkennen – selbst wenn es nur um den Genderstern geht.
Sicherlich, vieles von dem steht so ähnlich schon in anderen Texten. Bernd Stegemann fasst seine im nüchternen Ton vorgetragene Betrachtung in vier großen Kapiteln zusammen, die in dieser Konzentration ein größeres Bild ergeben: „Grüner Hochmut“, „Grüne Selbstsucht“, „Grüner Zorn“, „Grüne Ignoranz“. Dass der Essay auch in mittlerer Zukunft seine Gültigkeit behalten dürfte, liegt auch daran, dass der Autor mehrere Linien von den grünen Urgründen der achtziger Jahre bis in die Gegenwart zieht. Etwa, indem er daran erinnert, welchen ideellen Schub die 1979 gegründete Partei durch die Endzeitprognosen des „Club of Rome“ erfuhr, die sich später samt und sonders als falsch erwiesen. Auch hier funktionierte die Verbindung aus Apokalypse und vorgeblich wissenschaftlich beglaubigter Alternativlosigkeit schon ausgezeichnet.
Interessant auch der Hinweis, wie sehr die Bekämpfung des Ozonlochs (nicht durch die damals noch unterentwickelten Grünen) diese politische Kraft prägen sollte: Durch das FCKW-Verbot schloss sich das Ozonloch tatsächlich wieder. Hier herrschte ein simples Ursache-Wirkungsprinzip; eine einzige Gegenmaßnahme half deshalb tatsächlich. Dieses Verständnis, so Stegemann, habe die grüne Bewegung einfach auf das unendlich komplexere Klimathema übertragen. Daher die geradezu religiöse Konzentration auf die CO2-Reduzierung als einzig möglichen Welterrettungspfad, dem außerhalb Deutschlands immer weniger Politiker und Wissenschaftler folgen, innerhalb des Landes aber nahezu alle Parteien.
Ein Themenfeld schneidet „In falschen Händen“ gar nicht erst an – einfach deshalb, weil es dafür einen eigenen Band bräuchte: Die nicht nur politische, sondern auch wirtschaftliche Ausbeutung von Katastrophismus und Messianismus. Der Investor Jochen Wermuth, Miteigner eines „grünen“ Kapitalfonds, gehört zu den Großspendern der Grünen. Beim Skandal um den Graichen-Clan hob sich für kurze Zeit der Vorhang, um den Blick auf ein kleines Stück einer umfangreichen politisch-wirtschaftlich-finanziellen Verflechtung freizugeben. Mit der Wind- und Solarbranche entstand durch das Förderregime eine gewaltige Branche und großer individueller Wohlstand, dessen Erhalt allerdings davon abhängt, dass das einmal eingerichtete Umverteilungssystem weiter und weiter läuft. Auch die von deutschen Autofahrern über einen Treibstoffzuschlag zur chinesisch-deutschen Klimaschwindelindustrie transferierten Euromilliarden existieren nach wie vor, nur eben auf anderen Konten. Das gehört zur Wirtschafts-, teils zur Kriminal-, aber eben auch zur grünen Mentalitätsgeschichte, die als umfassendes Werk noch aussteht.
Bernd Stegemann, „
Der Elefant im Raum geht nicht auf Sendung
Mit „Inside Tagesschau“ legt der frühere ARD-Mitarbeiter Alexander Teske ein Buch über die deutsche Hauptnachrichtensendung vor, das ein wenig enthüllt, aber grundsätzliche Fragen vermeidet. Da wurde, so scheint es, jemand Renegat wider Willen
von Beate Broßmann
Der frisch geschlüpfte ostdeutsche Renegat Alexander Teske beschreibt in „Inside Tagesschau“ dem Tagesschau-Publikum, wie er nach einem erwartungsfrohen Beginn seiner beruflichen Tätigkeit als Redakteur bei der ARD-Nachrichtensendung ein- ums andere Mal und immer wieder von Neuem befremdet und überrascht war von der Art und Weise, wie diese tägliche Sendung zustande kommt, und wie die Kollegen und Vorgesetzten sich dabei verhalten. Als Idealist hatte er begonnen. Als Desillusionierter beendete er nach sechs Jahren seine Tätigkeit. Als mittlerweile freier Autor zeichnet er den Prozess seiner Desillusionierung nach, thematisch geordnet.
Das Bedürfnis danach hatten offenbar sein Vater und all die anderen Kritiker der Sendung geweckt, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zwar zu Recht kritisieren – aber für das Falsche, wie der Sohn meint: Diese Leute sähen in ihm „einen Vertreter des Systems“ und seien überzeugt, „dass man bei der Tagesschau seine Meinung nicht frei sagen kann. Wir würden die Menschen in ihrem Wahlverhalten beeinflussen.“ Sie unterstellten den Journalisten des ÖRR, „eine Schere im Kopf zu haben, bestimmte Themen nicht anzufassen, um keinen Karriereknick zu erleiden.“ Mit ihren sicheren und gut dotierten Jobs seien sie Nutznießer des Systems, das sie daher entschlossen verteidigen. „Ich kann dementieren, wie ich will.“ Doch in seiner Darstellung bestätigt er diese Kritik eher, als dass er sie widerlegt.
Wir erfahren eine Menge interessanter Details, die diese Rezension nicht erschöpfend aufzählen kann. Wir erfahren beispielsweise von Chefs vom Dienst, zehn Redakteuren zwischen 45 und 55 Jahren, die nie vor der Kamera stehen und größtenteils auch nie standen, die keiner kennt und die doch den „content“ bestimmen. Sie verfassen die Schlagzeilen beziehungsweise korrigieren sie. Und sie wählen 90 Prozent der Themen aus. Das Ganze für 11 434 € Salär brutto. Teske geißelt ihre Homogenität: kein Chef vom Dienst verfügt über Migrationshintergrund, ist behindert oder Ostdeutscher (die meisten sind Norddeutsche). Keiner hatte je mit Social Media zu tun. (Wie steht es um die Frauenquote, Herr Teske?) Die Tagesschau schmore im eigenen Saft, denn entgegen dem allgemeinen Trend zur Fluktuation sitzt jeder Chef vom Dienst im Schnitt 20 Jahre auf seinem Stuhl. Das Gleichgewicht zwischen Routine und Erfahrung kippt solcherart immer mehr in Richtung: ‚Das haben wir schon immer so gemacht.’ Na und? Die Tagesschau ist kein Start-up. Hier gibt es noch eine echte Hierarchie. Der Chef hat die Verantwortung und daher auch das Sagen. Doch der ostdeutsche Newcomer will eigene Akzente setzen. Beispielsweise hält er es für unangemessen, mehrere Beiträge über den Karneval in Köln und anderswo zu senden. Ihm wird entgegengehalten „Dat is Kölle. Dat is min Welt“ und: Die Mottowagen seien doch politisch. Dazu kommt: Diese zehn Chefs verorten sich, wie die meisten Journalisten, links von der Mitte, sie repräsentieren also nicht die Gesamtbevölkerung. „Sie sind meinungsstark und haben ihre persönlichen Vorlieben. Dies widerspricht dem Selbstbild der Tagesschau vom neutralen, objektiven Beobachter der Nachrichtenwelt […] Nachrichten, die nicht in ihr Weltbild passen, werden von den Chefs vom Dienst kleingeredet und schaffen es nicht in die Sendung.“ Die Themenauswahl richte sich nicht nach ihrer Relevanz, sondern nach den Vorlieben der Bestimmer.
Was in ihren Augen gar nicht existieren sollte, kommt nur zur Sprache, wenn es sich nicht vermeiden läßt. Solche unbeliebten Themen sind – wir ahnen es – die Folgen der Massenmigration und der Pandemie, die AfD und alles, was dazugehört, Gewalt von links, außerdem die Vorgeschichte und damit die Ursachen des Russland-Ukraine-Konflikts. Die ARD-Nachrichten geben in diesen Fragen eins zu eins die Standpunkte der Regierungen beziehungsweise der Parteien links von der Mitte wieder. Generell kann von einer illegitimen Verflechtung von Medien und Politik gesprochen werden, die sich auch darin ausdrückt, dass etliche Führungskader zwischen politischem Amt und journalistischer Tätigkeit hin- und herspringen. Damit hat der ÖRR kein Problem. Von der Kontrolle der Mächtigen durch die Medien kann logischerweise keine Rede mehr sein. Damit schaufele sich der ÖRR „Stück für Stück sein eigenes Grab“. Der ehemalige Chefredakteur Kai Gniffke stellte einmal die Frage: „Sind wir ein Staatsfunk, weil wir berichten, was die Regierung wünscht? Nein. Aber wenn Staatsfunk meint, dass wir das herrschende System stützen und die Regierung nicht absetzen wollen – ja, dann sind wir Staatsfunk.“ (In Parenthese: Es gab vor ein paar Jahren eine Podiumsdiskussion mit Gniffke, der sich kritischen Fragen von Rundfunkgebührenzahlern stellte. Seine Antworten verrieten, dass er über keinerlei Problembewusstsein in Sachen „sagen, was ist“ verfügt. Er räumte diese oder jene Schwäche in der Berichterstattung ein, führte sie aber einzig auf organisatorische Mängel zurück. Dass die Öffentlich-Rechtlichen auf dem linken Auge blind seien, dementierte er schroff. Die Meinungsvielfalt sei gegeben. Man müsse doch nur einmal die verschiedenen Zeitungen und Sender ansehen. Da gebe es doch in einem fort unterschiedliche Interpretationen politischer Geschehen. Entweder konnte er den Elefanten im Raum nicht sehen – oder er wollte es nicht.)
Zu Wort kommen bei den Experteninterviews, so Teskes Erfahrung, „zumeist biodeutsche Herren im fortgeschrittenen Alter“, „westdeutsche Männer mit akademischem Hintergrund. Wie die Journalisten selbst, gehören sie überwiegend zur privilegierten Schicht des oberen Zehntels der Bevölkerung und vertreten dementsprechend häufig Positionen der herrschenden Elite.“ Unterrepräsentiert seien auch hier Ostdeutsche, Menschen mit Migrationshintergrund, Schwerbeschädigte, Arbeiter, Landwirte, Handwerker. Lassen wir das erst einmal unkommentiert stehen.
Einen weiteren Faktor dafür, dass das Meinungsspektrum sich verenge – dass es schon einmal breiter war, bemängelte sogar unser derzeitiger Bundespräsident –, sei die Konkurrenz zwischen den Redaktionen. Die beobachteten sich gegenseitig und schrieben voneinander ab. „Es erfordert Mut, bewußt gegen den Strom zu schwimmen. Das derzeitige System in den Redaktionen belohnt aber genau das nicht.“ Zudem haben die Vertreter der jüngeren Generationen oftmals nur Zeitverträge. Das schafft Opportunisten, wie schon in Michael Meyens Buch „Die Propaganda-Matrix: Der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft“ von 2021 nachzulesen war.
Einen relativ großen Raum dagegen nimmt bei Teske das Verhältnis des öffentlich-rechtlichen Apparats zu Ostdeutschland und zur AfD ein. An einigen Beispielen macht er das immer noch virulente Desinteresse am Osten fest. Statt Teskes Vorschlag umzusetzen, die Feierstunde im Bundestag zu 70 Jahren Volksaufstand in der DDR live auf tagesschau24 zu übertragen, brachte der Sender lieber in stundenlangen Liveübertragungen Pressekonferenzen von Fußballtrainern, royalen Beerdigungen, Krönungen und Thronjubiläen. Auch in der geisteswissenschaftlichen Forschung gehe Ostdeutschland nahezu leer aus. Es gebe keinen einzigen Lehrstuhl zur Geschichte der DDR und des Kommunismus, aber 15 Lehrstühle samt Professoren für bayrische und fränkische. Von den 300 Mitarbeitern (bei Teske heißt es „Mitarbeitenden“) von ARD-aktuell seien etwa zehn ostdeutsch sozialisiert. Es würden nur westdeutsche Zeitungen abonniert. Als Teske erreicht hatte, dass wenigstens die Leipziger Volkszeitung hinzugenommen wurde, las sie kein Journalist. In der Hamburger Redaktion würden Stimmen Ostdeutscher nicht wahrgenommen. Im MDR arbeiten viele Westdeutsche als Chefs vom Dienst. Dennoch seien ihnen die Haltungen der Thüringer, Sachsen und Anhalter fremd geblieben. Alle Ostdeutschen würden von den Hamburger Redakteuren als homogene Masse wahrgenommen. Ihr Wahlverhalten mache die Ostdeutschen erst recht zu Dunkeldeutschen, die kein Interesse verdienten.
Auf den Umgang mit der AfD geht Teske ausführlich ein. Typisch sei hier der Blogeintrag eines MDR-Redakteurs: „Wer mit der AfD reden will, muss zum Arzt.“ Von Gleichbehandlung in der Berichterstattung könne nicht die Rede sein. Die ARD – und wahrscheinlich nicht nur dieser Sender – schwanke zwischen Ignorieren und Entzaubern. Ihrem Selbstverständnis, „sachlich, knapp und genau“, zudem „umfassend, neutral und journalistisch kompetent“ über die Ereignisse des Tages zu berichten, wird die ARD nicht gerecht, resümiert Teske. Umfassend, unparteiisch und frei von persönlichen Meinungen berichte man schon gar nicht. Das Motto „Journalismus mit Haltung“ habe allgemeine Anerkennung erlangt. Die Focus-Kolumnistin Nena Brockhaus wünschte sich 2024 „ein bundesweites Gesicht, welches ein liberales, konservatives Gegengewicht zu Anja Reschke bildet“. Diesen Wunsch teilt Teske offenbar.
Investigativen Journalismus betreiben heute nur noch – entsprechend ihrer Kapazität – die neu gegründeten Medien – vom Wahldesaster in Berlin bis zu den RKI-Files. Dieser Satz steht aber nicht im Buch „Inside Tagesschau“. Dieser Medienbereich kommt in Teskes Buch nämlich kein einziges Mal zur Sprache.
Und auch darüber hinaus kristallisiert sich bis zum Ende des Buches allmählich heraus, dass der Autor offenbar selbst die meisten politischen Annahmen der Tagesschau-Redakteure teilt. So hält er es für angemessener, „über die Kolonialverbrechen der britischen Krone“ zu berichten, anstatt über die „Schicksalsjahre eines Königs“. Er kritisiert, dass „die zahlenmäßig kleinen Bauernproteste riesengroß erscheinen, die größten deutschen Demonstrationen seit vielen Jahren aber, die gegen Rassismus und die AfD, kaum vorkommen.“ Auf dem Messengerdienst Telegram, weiß Teske, „tummeln sich bevorzugt Rechtsradikale, Waffenhändler, Drogendealer, Coronaleugner und Reichsbürger“. Auch vom „erneuten Überfall Russlands auf die Ukraine“ spricht der Journalist. Meta und X weigerten sich seiner Ansicht nach, „demokratiegefährdende Hetze, Fake-News und Kampagnen für Rechtsextreme und für den Brexit“ einzudämmen. Distanzlos verwendet er die Sprache der Wokeness, wenn er „Fake-News“ und „Hass-Postings“ beklagt, die Elon Musk kaum zensiere.
Da gelang es den Öffentlichen offenbar, einen Gläubigen zu vertreiben. Trotzdem ist es wieder ein ostdeutscher Journalist, der seine Loyalität gegenüber dem Establishment aufkündigt. Er hat mit Katrin Huß, Michael Meyen und Birk Meinhardt zahlreiche Vorgänger. Keiner von ihnen ist AfD-Mitglied oder Vertreter einer wirklich rechten und gar rechtsextremistischen politischen Haltung. Bei der Vergrämung oder Abservierung kritischer Medienschaffender geht es anscheinend weniger um einen bestimmten „Klassenstandpunkt“ als um das Berufsethos und die Art, wie sie Journalismus betreiben. Alle Genannten hatten dem westdeutschen Journalismusbetrieb Vorschusslorbeeren verliehen. Dass sie erneut, wie in der DDR, auf Haltungsjournalismus und parteiisches Berichten stoßen würden, erwarteten sie nicht. Wollten sie ihr idealistisches Berufsethos nicht verraten, kündigten sie die Mitarbeit auf – sofern sie nicht sowieso suspendiert wurden.
Vom „Abspann“ des Buches hätte man ein Resümee der Erfahrungen des Autors mit dem ÖRR erwartet. Die vielen Fallbeispiele lechzen nach Auswertung. Weit gefehlt. Stattdessen wählt er eine andere Verallgemeinerungsrichtung und gibt den Medienkonsumenten gute Ratschläge, wie sie es vermeiden, Newsjunkies zu werden, und vielmehr ihr psychisches Gleichgewicht angesichts der Flut deprimierender Nachrichten aus aller Welt aufrechtzuerhalten. Der Autor schließt sein Buch mit dem Motto auf der Tagesschau-Korrekturseite: „Bleiben Sie uns gewogen.“ Und ergänzt: „Aber bitte mit einer Portion Skepsis, ohne den Machern pauschal zu misstrauen. Dieses Buch konnte hoffentlich einen kleinen Beitrag dazu leisten, Ihren kritischen Blick zu schärfen.“
Nun ja, einiges an bisher unbekanntem und interessantem Material bekommt wohl jeder Leser geliefert. Doch über die Ursachen der geschilderten Mißstände erfährt man nichts. Fehler im System? Fehlanzeige. Charakterliche Schwächen? Vielleicht. Aber überhaupt systemische Gründe dafür, dass die Tagesschau und die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt dieses Bild bieten, einschließlich einer Kritikresistenz, die es im politischen Raum sonst allenfalls bei den Grünen gibt – das spart „Inside Tagesschau“ vollständig aus. Auch auf die Frage, wo eine Reform des Apparats ansetzen müsste, verwendet Teske keinen Gedanken. Jedenfalls äußert er sich dazu nicht. Offenbar genügt es ihm vorerst, sein Gewissen in Sicherheit gebracht zu haben. Alles in allem: Gut gebrüllt, kurz gesprungen. In Sachen Desillusionierung steht Alexander Teske wohl noch ganz am Anfang.
Alexander Teske, „
Hab keine Angst, es gibt bestimmt keinen Gott
Denial Bahtijaragić erzählt die anrührende Geschichte einer Familie, die aus dem Bürgerkriegs-Jugoslawien ins Wiener Exil flieht – wo ihr sozialer Status zerbröckelt, aber auch jede Hoffnung auf Rückkehr. Trotzdem gibt es in dem Roman weder Larmoyanz noch Migrationsverklärung. Schon das macht ihn zum literarischen Ereignis
von Artur Abramovych
Dass sich das Massaker von Srebrenica dieses Jahr zum dreißigsten Mal jährt und neuerdings gar offiziell von der UN begangen wird, wäre bereits Anlass genug, auf diesen vor wenigen Jahren erschienenen Roman zu verweisen. Denial Bahtijaragić, Jahrgang 1983, stammt aus dem nordbosnischen Prijedor, ist Spross einer bosniakisch-serbischen Ehe und stammt damit aus einem Milieu überzeugter Titoisten.
Jenseits jedweder Aktualitätsüberlegungen unterscheidet sich sein Roman „Die bogomilischen Gräber“ vor allem wohltuend von jenen „migrantischen“ back-to-the-roots-Romanen, die seit Jahren eine Konjunktur erleben, etwa von Saša Stanišić (auch er Sohn bosniakisch-serbischer Eltern), aber ebenso von deutschsprachigen Autoren anderer Herkunft, etwa Feridun Zaimoglu, Dmitrij Kapitelman oder seinerzeit der frühen (inzwischen aber zur gutbürgerlichen Professorin avancierten) Olga Grjasnowa. Diese larmoyanten Autoren kommen niemals ohne feuilletongerechte Klagen über die vermeintlich rassistische deutsche Mehrheitsgesellschaft aus und neigen zudem oft zu einer völlig kritiklosen Romantisierung ihres Herkunftslands um der Abwertung Deutschlands willen. Allein schon diese Sonderstellung gegenüber der mit dem Begriff migrantisch belegten Textproduktion macht Bahtijaragićs „Bogomilische Gräber“ zu einem literarischen Ereignis.
Andererseits hat Bahtijaragić aber auch keine Parodie auf dieses Genre vorgelegt, wie es etwa Sibylle Lewitscharoff mit „Apostoloff“ gelang; sein Herkunftsland, das sozialistische Jugoslawien kurz vor dem Zusammenbruch, versucht er keineswegs als primitiv und/oder exotisch auszumalen. Im Gegenteil, dem Autor liegt viel daran, sein Elternhaus als inkarniertes bürgerliches Paradies zu zeigen, beherrscht von der Gestalt des eleganten, respektablen Vaters, Chefarzt einer Klinik, der Dunhills zum Genuss raucht (allerdings nur in den eigenen vier Wänden, um vor den Untergebenen nicht als allzu bourgeois zu erscheinen), und einer mondänen, frankophilen Mutter. Dass der Vater Bosniake (damals sagte man: „Moslem im ethnischen Sinne“) und die Mutter Serbin ist, spielt in der vorurteilsfreien Familie keine Rolle.
In diese heile, zivilisierte Welt mit ihren Modellen des Eiffelturms in den Bücherregalen und den feinen, bestickten Spitzentaschentüchern bricht nun, zu Beginn der 1990er Jahre – „in dieser Zeit, in der alle begannen, von ihren Göttern zu reden“ – völlig unversehens die Irrationalität hinein. Der Reiz dieses Entwicklungsromans en miniature besteht nicht zuletzt in der meisterlichen Darstellung kindlicher Rezeption, wie sie auch James Joyce im „Porträt des Künstlers als junger Mann“ praktizierte: Die Geschehnisse und Interaktionen zwischen den Figuren, noch die spannungsreichsten, sind konsequent aus der Sicht des jungen, autobiographisch inspirierten Erzählers geschildert, eines sensiblen, kunstsinnigen Jungen, der zu Synästhesie neigt. Auch die Gliederung in fünf Kapitel erinnert an Joyces Debütroman.
Noch nach der ersten Morddrohung, die der Vater von serbischen Nachbarn erhält, bleiben die Eltern ihrem Titoismus treu; sie geben ihren hartnäckigen Selbstbetrug nicht auf, den unser kindlicher Erzähler allerdings zunehmend durchschaut: „Ich wusste, dass der Marschall schon vor meiner Geburt verstorben war. Wie sollte er da noch für Frieden sorgen?“ Sein Vater versichert ihm angesichts der heraufziehenden ethnoreligiösen Konflikte: „Hab keine Angst, es gibt bestimmt keinen Gott“. Die Mutter will ihm weismachen, dass die Schüsse, die er zunehmend häufiger hört, daher rühren würden, dass „die Soldaten nur aus Freude in die Luft schießen, da es hier bei uns sicher keinen Krieg geben“ werde. Doch der Erzähler stellt fest, dass „selbst nahegelegene Orte, wohin wir früher Ausflüge gemacht hatten“, unerreichbar wurden. Sogar die humoristische Fernsehsendung Nadrealisti widmet sich nun dem vielfach beschworenen Krieg; noch immer mit kongenialer Komik. Doch diesmal kann der Erzähler nicht mehr mitlachen.
Schließlich führt kein Weg mehr an der abenteuerlichen Flucht vorbei; die Familie, getarnt als Budapest-Touristen, lässt „einen Staat, den es nicht mehr gab“ hinter sich – und auch nahezu ihre gesamte Habe. Die Hoffnungen auf eine Anerkennung des väterlichen Diploms am Sehnsuchtsort Paris zerschlagen sich; die Familie landet im Wiener Arbeiterbezirk Ottakring in einer winzigen, von Silberfischchen heimgesuchten Wohnung. Der Vater, einst Genussraucher, beginnt, tiefe, gierige Züge zu nehmen. Er lässt sich gar dazu herbei, etwas zu tun, „was bei uns zuhause die größte Schande gewesen wäre: Er aß die Suppe aus einer Schüssel“. Rührend sind die hartnäckigen Versuche der Mutter, die soziale Deklassierung vor dem Sohn zu verheimlichen; da das Gehalt des Vaters als Lastenträger nicht hinreicht, wird sie tätig als Putzfrau, versteckt jedoch ihre Uniform vor dem Sohn. An das geräumige Haus in Bosnien erinnert nichts mehr in Ottakring, in „unserer kleinen Residenz“, wie die Mutter sich nach wie vor euphemistisch ausdrückt.
Beim Romantitel handelt es sich um eine unter Anhängern des bosnischen Zentralstaats verbreitete Bezugnahme auf das mittelalterliche Königreich Bosnien, ein kurzlebiges Gebilde, das den Osmanen zum Opfer fiel. Die dortige Kirche war ein mutmaßlich durch die Sekte der Bogomilen beeinflusste heterodoxe Erscheinung, weder katholisch noch orthodox, und eignete sich daher zur Schaffung eines bosnischen Sonderbewusstseins nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens.
Allerdings will dieser Roman, anders als Joyces Porträt des Künstlers, keineswegs eine Anklage gegen den Imperialismus eines Nachbarlands sein, sondern bleibt gleichsam protopolitisch. Im Fernsehen sieht der junge Erzähler die ihm bekannten „jugoslawischen Politiker, die jetzt aber eher an Feldherren gemahnten“; und auch die zunehmende Islamisierung der Bosniaken entgeht ihm nicht, wenn etwa auf den regelmäßigen Treffen der Wiener Flüchtlinge dem in bosniakisch-serbischer Ehe lebenden Vater zu Beginn des Krieges noch großer Respekt entgegengebracht wird. Doch je häufiger der junge Erzähler dort „Allahu Akbar“ zu vernehmen hat, desto mehr fällt ihm bei diesen Versammlungen auf, dass „die kaum verhohlenen Blicke des Hasses, wenn die Sprache auf die Taten der Serben kam, nun auch Vater und mir galten“. Auch mit den hinzustoßenden Kroaten, die „die Hand in jener Weise heben, wie es die Deutschen im letzten großen Krieg zu tun pflegten“, kann der Vater nichts anfangen.
Mit dem Abkommen von Dayton zerschlagen sich die Hoffnungen des Vaters auf eine Rückeroberung seiner Heimatstadt und damit auf eine Rückkehr; Prijedor fällt dauerhaft an Serbien. Unserem jungen Erzähler, nun als doppelt Heimatlosem, bleibt nichts anderes übrig, als durch die abendlichen Straßen Wiens zu flanieren und seinen Träumen nachzuhängen.
Denial Bahtijaragić, „Die bogomilischen Gräber“, Wien (Castrum), 152 Seiten, 25 Euro
Publico verwendet Affiliate-Links zu Amazon. Das bedeutet: wenn Sie dort ein Buch bestellen, erhält Publico eine kleinen prozentualen Anteil je Verkauf. Natürlich können Sie Bücher aber auch gern beim Buchhändler Ihrer Wahl oder direkt beim Verlag bestellen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen als Leser.
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.



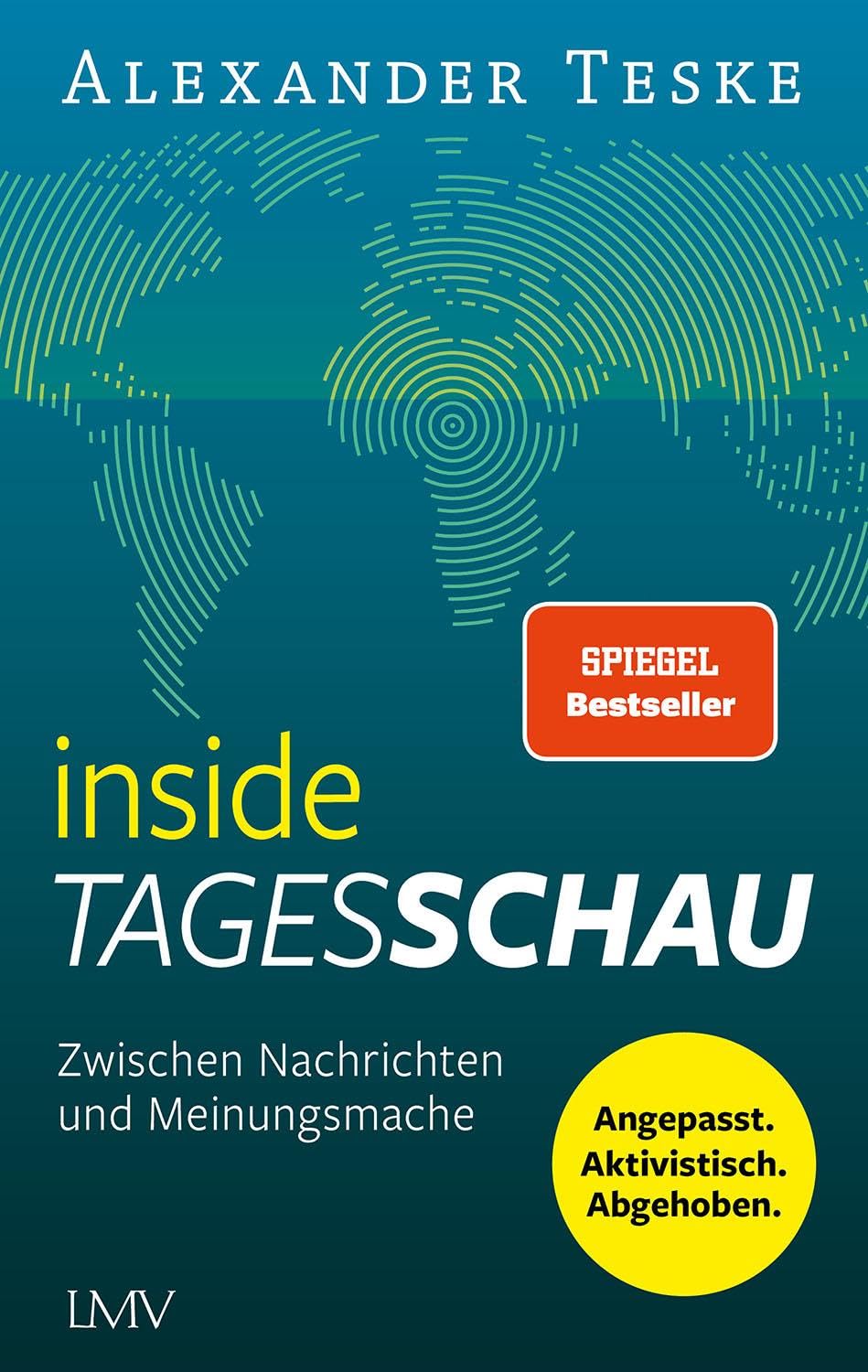
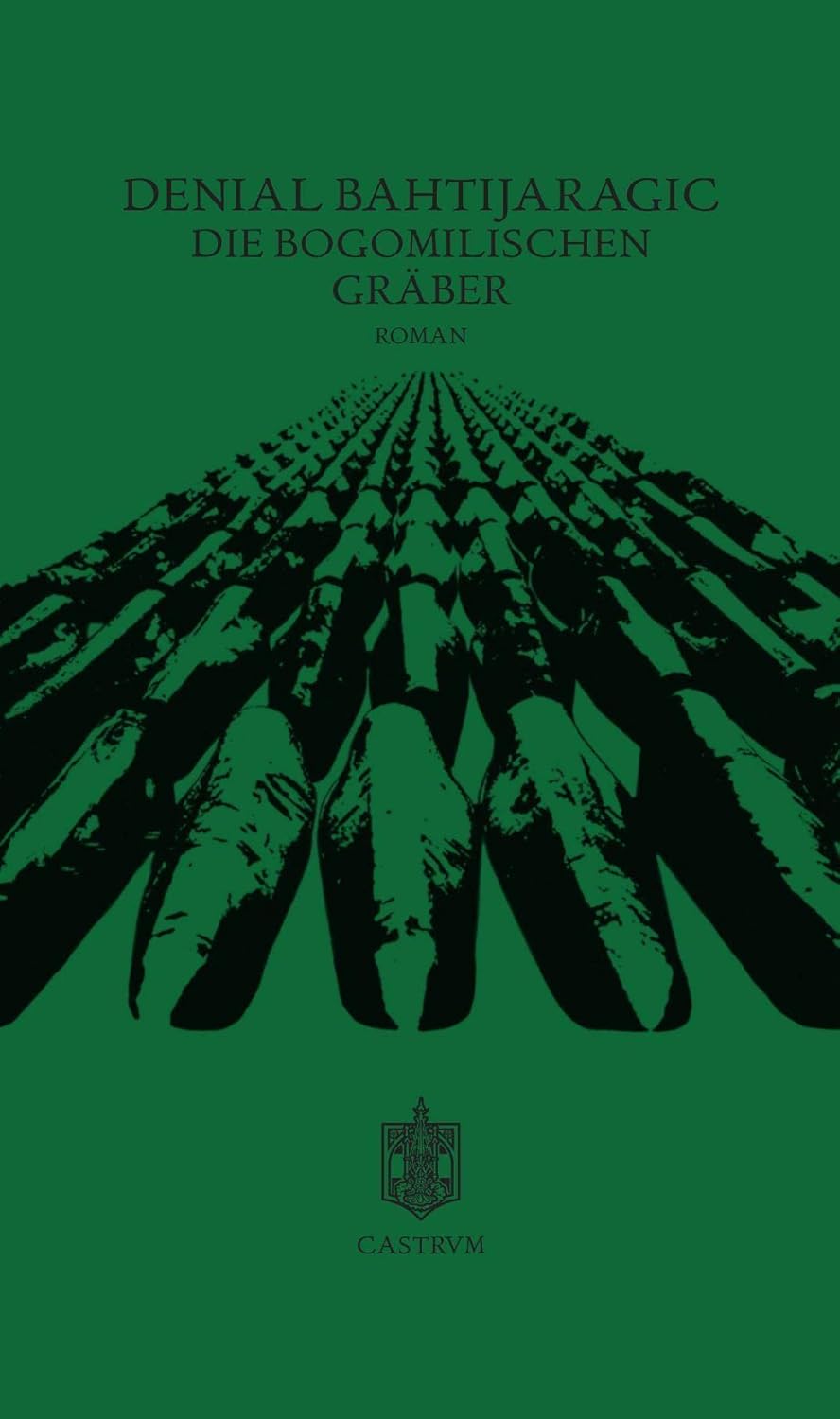



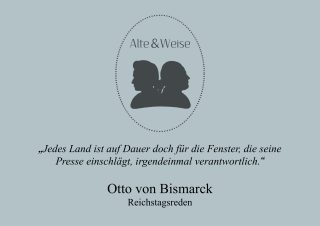

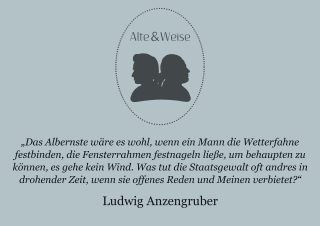

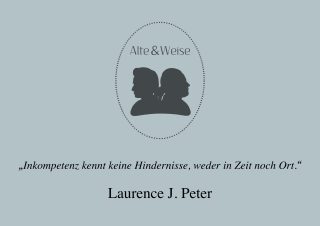

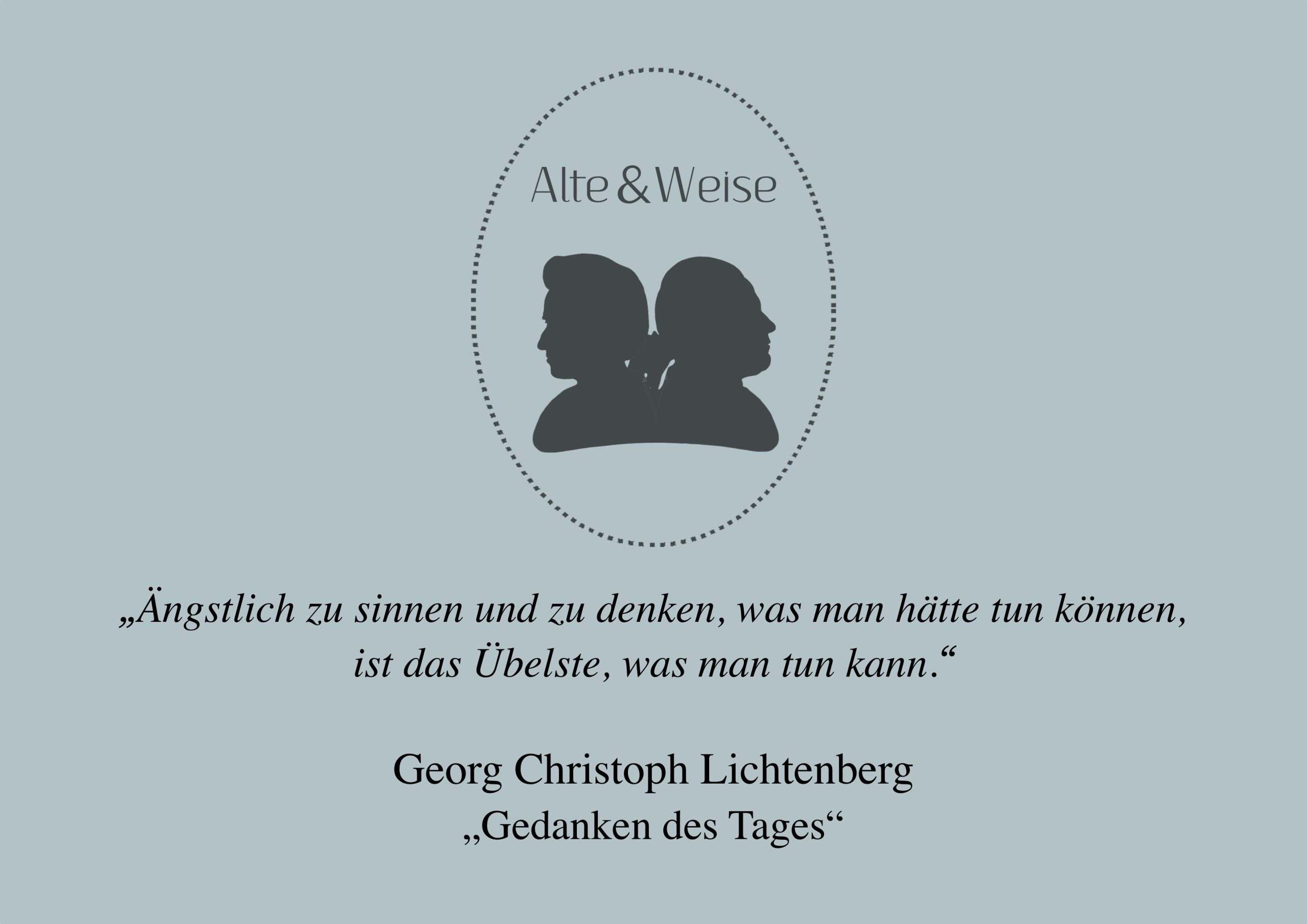
Lilo Sallinger
16.04.2025Lieber Herr Alexander Wendt,
eine schöne, neue (seit Januar 2025) Publikation ist auch dieses Buch ….und damit ebenso eine empfehlenswerte Frühlingslektüre:
Peter Handke
Schnee von gestern, Schnee von morgen:
Im Gehen trägt er zusammen, was ihm begegnet, Tag für Tag, Schritt für Schritt: zwei Raben zu seinen Füßen, ein angebissener Apfel am Wegrand, der Fliegenschwarm, »der auf der Stelle fliegt«. Dazwischen Gedanken an den durch Weltgeschehen und -geschichte irrenden Odysseus, Erinnerungen an die Schlange am Kindswaldrand, der Klang der Regentropfen im Laub, das Bild der Wolkenschatten. Dann das »Lachen von Kindern am Horizont«, ihr ausgelassenes Spiel, das den Krach am Straßenrand übertönt. Dort findet er den Frieden, den es nicht gibt, »im Mundschwung des Kindes, dort herrscht er«. Bis der eine, der da unentwegt spricht, aufbricht und ein anderer kommentiert: »Angeblich soll er vor einiger Zeit noch gesehen worden sein, als letzter Fahrgast hinten zusammengekauert im allerletzten Nachtbus.«
Schnee von gestern, Schnee von morgen ist ein Stück für die Bühne, ein Drama ohne Rednerwechsel, ein Lied ohne Kehrvers. Als ob Peter Handkes Figur sprechend und singend versucht, sich in die Stille einzuhören, also zugleich wegzuhören, Welt und Welterfahrung gerecht zu werden. Der Sprecher fällt sich selbst ins Wort, setzt neu an, und er sammelt nicht nur auf, was ihm im Gehen begegnet, sondern folgt auch den »Nachbildern bei geschlossenen Augen«.
ORF-Bestenliste
Bibliografische Angaben
Erscheinungstermin: 13.01.2025
Klappenbroschur, 74 Seiten, Sprachen: Deutsch
978-3-518-43225-9
Suhrkamp Hauptprogramm
Ich dachte: schöne Notizen zur Verbundenheit des Menschen mit der Welt, bzw. eigentlich zur Unverbundenheit.
Berührend in einer Zeit, in der die meisten Menschen scheinbar sehr weit weg davon sind, sich verbunden zu fühlen, oder überhaupt sich selbst zu fühlen.
Diese Gedanken von Peter Handke könnnten ein Trost in dieser eiskalten und unnahbaren, aktuellen Zeit sein. Für mich war es so.
Ein kluges Alterswerk zudem (man bedenke seine schwierigen Auseinandersetzungen, was den Balkankrieg angeht – deswegen hatte Jelinek den Nobel-Literaturpreis vor ihm erhalten).
Auch neueste Veröffentlichungen aus anderen Quellen (Jeanette Fischer, Giuseppe Gracia …beide Autoren) kreisen um das Thema….https://kontrafunk.radio/de/sendung-nachhoeren/lebenswelten/menschenbilder/menschenbilder-freiheit-ohne-bindung-freiheit-durch-bindung
Wünsche Ihnen schöne Osterfeiertage! Herzliche Grüsse Lilo Sallinger
Andreas Isenberg
17.04.2025Das Ozonloch schrumpft offenbar keineswegs so eindeutig, wie es das nach der gängigen Theorie (FCKW) tun sollte. Bislang war die Ausdehnungsentwicklung eher inkonklusiv, was man damit erklärte, dass FCKW halt länger in der Atmosphäre verbleibe als jene 25 Jahre, die man uns Ökologieinteressierten diesbezüglich Ende der 80er Jahre erklärte.
Hinzu kommt, dass 2020 zum ersten Mal ein Ozonloch in der Arktis und 2023 ein Ozonloch über der Antarktis gemessen wurde, das so groß war wie nie zuvor. Natürlich fehlen die üblichen Adhoc-Hilfshypothesen nicht (Vulkanausbruch?). Quelle aus: Manfred Brugger, Windwahn – Der Windwahn und seine klimatischen Konsequenzen, 2025: https://www.dlr.de/de/aktuelles/nachrichten/2020/01/20200325_ozonloch-in-der-arktis
https://www.ardalpha.de/wissen/umwelt/nachhaltigkeit/ozonloch-antarktis-suedpol-arktis-ozonschicht-fckw-100.html