Die „Neuaufteilung von Straßenräumen“ verwandelt intakte Straßen in politisch gewollte Rumpelkammern. Dafür braucht es ein ganzes Referat, das die bayerische Laundeshauptstadt für viel Geld berlinisiert. Eine Bildreportage aus dem echten Leben
von Jürgen Schmid
Was wird aus einer ganz normalen Straße, wenn aus ihr die Autos verbannt werden, um Radfahrern den Straßenraum zu überlassen? Eine „Fußgängerzone“, meint der Bezirksausschuss Haidhausen-Au in München.
Dieses grün dominierte Gremium arbeitete im Zusammenspiel mit dem „Mobilitätsreferat“ der Landeshauptstadt seit August 2024 daran, die Einkaufsmeile Weißenburger Straße zwischen Pariser und Weißenburger Platz in einer „Testphase“ für ein Jahr in einen „verkehrsberuhigten“ und „möblierten“ Abschnitt zu verwandeln, um die „Aufenthaltsqualität“ zu erhöhen.

Erstaunlich lange kamen Metropolen völlig ohne Möbel auf der Straße aus. Der Staat stellte sie nicht mit Steuermitteln auf, und Leute, die sich neu einrichteten, verkauften ihre alten Sofas und Stühle ganz regulär oder überantworteten sie dem Sperrmüll, statt sie auf dem Bordstein abzustellen. Merkwürdigerweise traten beide Phänomene ungefähr zeitgleich auf: Aufstellung von Gestühl und allem möglichen Plunder in eigener Initiative und deren Installation von Amts wegen. Der Vorgang beschränkt sich nicht auf die deutsche Hauptstadt. Es herrscht vielmehr auch weit außerhalb der Wille zur gründlichen Durchberlinisierung von bisher noch unberührten Gebieten, beispielsweise in grün dominierten Münchner Stadtbezirken. Und demnächst auch vor Ihrer Haustür. Diese Reportage bereitet Sie deshalb schon einmal in Wort und Bild auf die Transformation vor.
Um mit dem Hauptmöbel zu beginnen, mit dem in Haidhausen der Straßenraum neu verteilt werden soll: Es handelt sich um „größere farbige Sitzelemente (sogenannte Enzis)“. Diese sind offenbar noch nicht aus Wien eingetroffen, wo sie als „Hofmöbel“ für das MuseumsQuartier entworfen und nach einer ominösen Prokuristin namens Daniela Enzi benannt wurden – weshalb der Münchner Aufenthaltswillige vorerst mit an Ketten angeleinten Metallstuhlreihen in Gitternetzcharme und grauer Optik und einigen ebenfalls farblosen Holzbänken, zumeist ohne Rückenlehne, vorlieb nehmen muss, welche in den ehemaligen Parkbuchten abgestellt wurden. Denn darin, Parkplätze verschwinden zu lassen, liegt bekanntlich der zu hundert Prozent erfüllte Zweck dieser Umgestaltung. Das Draufverweilen ist fakultativ (zum Glück).
Vor den Stühlen kam Haidhausen schon in den Genuss der ersten Sperrholzpaletten im öffentlichen Raum Münchens, hoch gelobt von der örtlichen Zeitung. An dieser Stelle muss einmal erwähnt werden, woher die Idee eigentlich stammt, Möbel auf der Straße zu platzieren: aus San Francisco, wo Aktivisten 2005 damit anfingen, Parkraum wegzuverteilen und generell die Stadt zu transformieren. Die Grundidee bestand darin, die Art von Behelfsmöbeln aus Sperrholz, die sich bis dahin das Dauerpublikum im Golden Gate Park aus Resten zusammenzimmerte, professionell und möglichst mit öffentlichem Geld herzustellen, um mit dem Ergebnis den Autoverkehr in Downtown einzuschränken, und gleichzeitig ein bestimmtes Klientel zum Aufenthalt in Geschäftsstraßen zu ermuntern, die sich dann nach und nach in ehemalige Geschäftsstraßen verwandelten. 2012 veröffentlichte die UCLA Luskin School of Public Affairs eine Studie – nichts geht über die Studie! – mit dem Titel: „Reclaiming the Right-of-Way: A toolkit for Creating and Implementing Parklets, examining case studies for parklets in seven cities across North America“. Über die Erfolge dieser und anderer Projekte der Stadtumgestaltung berichtet der Autor Michael Shellenberger in seinem sehr lesenswerten, allerdings nicht auf deutsch erschienenen Buch „San Fransicko. Why Progressives Ruin Cities“.
Aber zurück nach Haidhausen. Dessen „Fußgängerzone“ verfügt über ein interessantes Alleinstellungsmerkmal: „Auf der abgesenkten Fahrbahn kann zu jeder Zeit in beide Fahrtrichtungen in Schrittgeschwindigkeit geradelt werden.“ Wem das als „Fußgänger“ nicht ganz geheuer sein sollte, der wird vom „Mobilitätsreferat“ beruhigt: „Fußgänger*innen haben immer Vorrang.“
Allerdings sind nicht nur Fahrräder „frei“, sondern auch „E-Scooter“, das Lieblingsspielzeug urbaner Avantgardisten. Die täglich beobachtbare Wirklichkeit: Auf der Fahrbahn rasen Räder und Roller hin und her („Schrittgeschwindigkeit“ ist nun mal Auslegungssache – ein Marathonläufer kommt schließlich auf seine 20 Kilometer pro Stunde). Fußgänger ballen sich also zu ihrer eigenen Sicherheit weiter auf den Gehsteigen zusammen, und meiden damit, was eigentlich „Fußgängerzone“ geworden sein will.
So ergibt sich eine ganz neue Spielart des divide et impera, vulgo: „Neuverteilung des Straßenraums“. „Spaltung der Gesellschaft“ heißt so etwas nur woanders, aber nicht im Herzen des progressiven Milieus, das nirgendwo in der Republik woker leuchtet als in Haidhausen mit fast 48 Prozent grünem Stimmanteil bei den letzten Wahlen zum Bezirksausschuss. Ein Spaltungsvakuum ist jedenfalls nicht vorgesehen: Wo eine bestehende Differenz durch Eliminierung eines Akteurs aufgehoben wird wie neuerdings in der Weißenburger Straße durch Ausschluss des verhassten motorisierten Autoverkehrs, muss zwingend eine neue Kontroverse geschaffen werden. Hieß es bisher: alle nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer (inklusive der nicht vierrädrig elektrifizierten) gegen die Autofahrer, so wird hier neues Kampffeld eröffnet: Radfahrende und Elektrorollernde gegen Zufußgehende. Mussten letztere ihr Heil bis Mitte August 2024 aus Angst vor blechernen Vierrädern auf den Gehsteigen suchen, so dient ihnen dieses Terrain jetzt als Zuflucht, um nicht unter die Zweiräder zu geraten, die im Haidhauser Milieu gerne als sogenannte „Lastenfahrräder“ panzergeschossartig die nachhaltige Gesinnung ihrer Lenkerinnen repräsentieren (es sitzen fast immer Frauen im Sattel). Sie können sich für die umfangreiche Förderung ihres Lebensstils durch die grün-rote Stadtregierung bedanken, wofür allerdings nicht das Mobilitätsreferat verantwortlich zeichnet, sondern ein eigenes Klimareferat mit seinem Sachgebiet Klimaneutrale Antriebe.

Autos und Lastkraftwagen sind aber grundsätzlich aus der Testzone verbannt, oder? Nein, die dürfen schon auch einfahren, aber nur in klitzekleinen Zeitfenstern: „Der Lieferverkehr ist an Werktagen von 22.30 bis 12.45 Uhr erlaubt“. Doch selbst an unauffälligen Nachmittagen können in der neuen „Fußgängerzone“ ein Dutzend Kraftfahrzeuge aller Art gesichtet werden, vom PKW über VW-Busse bis zum Liefer-LKW. Alles Ausnahmen aus der schier endlosen Sondergenehmigungsliste, im Behördensprech „Zufahrtserlaubnisse“ genannt? Als da sind (der Leser möge das Hoppeldeutsch des Amtsschimmels mit seinen Redundanzen verzeihen): „Personen, die [innerhalb der Fußgängerzone] über einen Stellplatz auf Privatgrund verfügen oder einen Stellplatz gemietet haben“; „Anwohnende zur häuslichen Versorgung“; „Baustellenfahrzeuge“ (von denen es wegen zweier Baustellen während der Testphase viele gibt); „stark bewegungseingeschränkte Personen und Patient*innen“; „Personen, die über einen Parkausweis für Schwerbehinderte verfügen“; „sogenannte Inklusionstaxis, also Fahrzeuge, die über technische Umbauten zur barrierefreien Beförderung von Menschen mit nicht umsetzbaren Rollstühlen verfügen“; „Pflegedienste, die Anwohner*innen betreuen“ sowie „Angehörige von pflegebedürftigen Anwohner*innen“. Kommen viele dieser Ausnahmen zum gleichen Zeitpunkt zusammen, bleibt nicht mehr viel Raum für „Aufenthaltsqualitäten“.
„Alle Verkehrsteilnehmer*innen sollen sicher, leicht und nachhaltig unterwegs sein können.“ Was in unsicherer Sprache daherkommt – in welcher Gewichtsklasse soll man sich einen Fußgänger vorstellen, der „leicht“ unterwegs ist? –, erweist sich als erklärtes Ziel der „Mobilitätsstrategie 2035“, mit welcher das Münchner Mobilitätsreferat vor fünf Jahren ambitioniert seine Arbeit aufnahm. Bisher hat das Konzept vor allem so wunderbare Wortgebilde wie „Fußverkehr“ und „Pendler*innenmobilität“ hervorgebracht und viel Aufheben um „Planungsprozesse“, „Bürgerbeteiligung“ und „interaktive Mitarbeit aller Teilnehmenden“ gemacht.
Nun kann man in Haidhausen Taten besichtigen. Ein objektiver, das heißt auch reaktionären Beobachtern einsichtiger Nachweis für die Sinnhaftigkeit einer „Neuaufteilung von Straßenräumen“ steht allerdings bis jetzt aus, genauso wie ein Beleg für eine höhere Sicherheit für den „Fußverkehr“.
Wie steht es nun um die Aufenthaltsqualität in Straßenräumen? Wer das Bild weiter oben betrachtet, der fragt sich, ob diese Metallsitzgelegenheiten nun vom Mobilitäts/Klima/Transformationsreferat aufgestellt wurden, oder ob sie in den Aufgabenbereich der Stadtreinigung fallen. Jedenfalls scheint es nur wenige Haidhausener zu geben, die die Aufenthaltsqualität einmal praktisch testen wollen. Zwei weit in den Straßenraum hineinragende Großbaustellen tun ihr Übriges, um den anheimelnden Charme des progressiv Urbanen abzurunden. Die Ästhetik setzt sich bruchlos fort in Gestalt großformatiger Blumenschalen, die unter dem Behördennamen „Pflanztröge“ dieses Schlamassel milde begrünen sollen. Jedenfalls erscheint die Stimmung vor Ort getrübt: Außer dem „Weltladen“, der das „Zukunftsprojekt“ plakativ begrüßt, lehnen fast alle Ladenbesitzer die Maßnahme ab.
„Alle Akteure bei der Verkehrswende mitzunehmen ist eine zentrale Aufgabe für das Mobilitätsreferat“, so erklärt die Behörde ihre Vorstellung von Bürgerbeteiligung, neu-deutsch: Partizipation. Unter „Mitnehmen“ verstanden Referat und Bezirksausschuss im Falle des Fußgängerzonenversuchs Weißenburger Straße eine Vorladung der Anwohner und Geschäftsleute, um ihnen mitzuteilen, was man zu tun gedenke. „Wir sind überhaupt nicht eingebunden worden“, stellt ein Ladeninhaber nüchtern fest. Und eine Buchhändlerin ist wenig erfreut, dass die Geschäftsleute „nicht mitreden durften und vor vollendete Tatsachen gestellt wurden“. Irritierenderweise für das wohlmeinende Milieu hat diese Art der „Mitnahme“ zu heftigem Unmut unter den „Mitgenommenen“ geführt. Zehn „Akteure“, allesamt Gewerbetreibende in der Weißenburger Straße, die nicht agieren, ja nicht einmal ergebnisoffen diskutieren durften, reichten sogar Klage gegen das Projekt ein.

Auffällig zurückhaltend verhält sich die Münchner Medienszene, der es sonst gar nicht schrill genug sein kann, wenn es um das Abfeiern von progressiven Projekten geht: „Willkommen in Münhattan“ titelte etwa die tz zu Plänen, im Süden der Stadt einen massiven Hochhausriegel zu errichten („Wir müssen Wohnraum schaffen“). Nach dem Start des „Verkehrsversuchs“ in Haidhausen kann man die seither erschienenen Berichte in der Lokalpresse an ein paar Fingern abzählen. Das Wenige, was man dem Leser vorsetzt, klingt auch noch gefährlich defätistisch: „Der Andrang ist überschaubar“, hieß es bei der Süddeutschen Zeitung. Im Boulevard schwingt gar ein frivoler Hauch Widerständigkeit mit, wenn die „Probe-Fußgängerzone“ als „umstritten“ (tz) eingeordnet wird.
Was sollte auch gefeiert werden? Nach uferlosen Ankündigungs- und Eröffnungsorgien – die Münchner Abendzeitung kennt dafür das Verb „ankendüdigt“ – gebar das lange kreisende Mobilitätsreferat vorerst eine teilmöblierte Radfahrerzone mit partiellem Autoverkehr. „So ganz durchdacht, so sagen es einige hier [so die tz], ist das Ganze noch nicht.“
Der Lokalreporter der Süddeutschen Zeitung zeigt sich bereits erleichtert über seine Erkenntnis, dass sich „Beschwerden bisher in Grenzen halten“. Und er findet sogar eine Anwohnerstimme, die das neue Flaniererlebnis als „gigantisch“ empfindet.
Was dem Leser nicht mitgeteilt wird: Dass diese Enthusiastin, der „das Herz aufgegangen“ sei, keine zufällig am Journalisten vorbeikommende Haidhauserin ist, sondern federführende Aktivistin einer lokalen Befürwortergruppe. Zusammen mit 50 Anwohnern wirbt sie auf einer eigens eingerichteten Homepage für das Projekt mit dem Slogan „Haidhausen für alle“. Viele der über 63.000 Haidhauser dürften gar nicht gewusst haben, dass ihr Stadtviertel bisher nicht allgemein öffentlich zugänglich war, sondern dass es dazu eines „Verkehrsversuchs“ bedurfte.
Der Befürchtung von Einzelhändlern, die Fußgängerzone werde für sie zu Umsatzeinbußen führen, halten die Beruhigungsbefürworter „Studien“ entgegen, die „nachgewiesen“ hätten, „dass autofreie Einkaufszonen zu mehr Umsatz führen“. Entgegen der Ankündigung im Plural wird nur eine Studie als Beleg für diese These angeführt. Sie stammt aus dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam (RIFS), das sich auf die Fahnen geschrieben hat, „Entwicklungspfade für die globale Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft aufzuzeigen“ und nach eigenem Verständnis „mit dem Ziel forscht, gesellschaftliche Wandlungsprozesse hin zur Nachhaltigkeit zu befördern und zu gestalten“ – eine zuverlässig objektive Adresse also. In der RIFS-Studie ist zu lesen, dass der Protest gegen Fußgängerzonen „fast immer männlich“ sei und „mit verschränkten Armen und bösem Blick“ daherkomme. (Für Haidhausen spricht in der tz studienkonträr eine freundliche Frau ganz unverschränkt über ihre Bedenken am Projekt.) Grundsätzlich, so weiter bei „Haidhausen für alle“, würden „Händler*innen den Umsatz überschätzen, der durch Kunden generiert wird, die mit dem eigenen PKW kommen“. Wenn diese Händler (auch jene ohne Stern) ihre Läden schließen müssen, wie es in der Berliner Friedrichstraße nach Verkehrsberuhigung der Fall war, wird es nur eine gefühlte Pleite sein – also halb so schlimm. Auch in Berlin gab es übrigens seinerzeit eine Studie, die den Händlern vorrechnete, wie sehr sie sich bei der Aufstellung ihrer Geschäftsbilanz irrten.

Einen Einwand der Probelaufbefürworter gegen ihre Kritiker kann man gleich vorwegnehmen: Man möge doch bedenken, dass – im Gegensatz zur vollendeten Fußgängerzone in der Sendlinger Straße – in Haidhausen der Straßenraum noch gar nicht rückgebaut wurde und damit bei weitem nicht alle Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität umgesetzt werden konnten. Wie aber, so muss man antworten, soll ein Passant in der Weißenburger Straße dann einen Eindruck von dem bekommen, was ihn irgendwann einmal erwarten könnte, wenn er nur winzige Teile davon präsentiert bekommt? Für was der ganze Testlauf, wenn nur ein Bruchteil des angestrebten Endergebnisses getestet werden kann?
Eine weitere Grundsatzfrage lautet: Warum stockte München sein ohnehin überbordendes Behördenwesen noch einmal um ein weiteres Referat auf? Denn um die Tätigkeitsschwerpunkte des neugeschaffenen „Mobilitätsreferats“ („Klimaschutz“, „Verkehrswende“, „Mobilitätswandel“, „Neuaufteilung von Straßenräumen“) kümmern sich traditionell bereits andere, die personell durchaus üppig ausgestattet sind: Übergeordnet das Baureferat als „Projektmanager bei städtischen Bauvorhaben“, wozu ja auch Fußgängerzonen zählen. Sodann spezifisch das Referat für Stadtplanung und Bauordnung, das explizit für „Verkehrskonzepte“ zuständig ist. Und zu guter Letzt gönnt man sich im klimabewegten Münchner Rathaus auch noch ein – ebenfalls neu gezimmertes – Referat für Klima- und Umweltschutz, welches exakt dasselbe Portfolio zu bespielen angibt wie das Mobilitätsreferat: „die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Stadtverkehr“, mit anderen Worten: das, was die Kollegen von der Mobilität „Verkehrswende“ nennen. (Die Riege der fünfzehn Münchner „Referent*innen“ strahlt übrigens durchweg im reinsten Blütenweiß, was auch für die Bürgermeistergilde gilt. Für Diversität sorgt bei den Vielfaltsbesorgten lediglich der Genderstern.)

Ja was meinen Sie denn, wie die Stadtverwaltung Berlins zu ihrem Umfang gekommen ist? Transformation schafft Arbeitsplätze – zwar nur im steuerfinanzierten Teil der Gesellschaft, aber immerhin. Bei diesen vielfältigen inhaltlichen Überschneidungen jedenfalls zwischen mindestens vier verschiedenen Referaten scheint Kompetenzgerangel unvermeidlich. Zudem ist eine Auffächerung des Immergleichen das pure Gegenteil von Verwaltungsvereinfachung und Bündelung. Dass die Wirklichkeit auf dem Zamanand-Festival Mitte September zwischen Odeonsplatz und Siegestor inzwischen bedenklich anders aussieht, als sich das mitveranstaltende Referat für Klima- und Umweltschutz das vorstellt – nämlich mit wenig klimabewegten Aktivisten, die noch zu mobilisieren sind, dafür aber mit viel gähnender Leere zwischen den vereinzelten Ständen und Aktionsflächen –, diese Erkenntnis eines sichtbar überschrittenen Zenits der großen Transformationsbewegung wäre eine eigene Betrachtung wert. Und als Verschwörungstheoretiker würde sich gar verdächtig machen, wer dazu noch annimmt, dass mehrere Referate für das Gleiche auch viel mehr Gutachten, Studien, Evaluierungen und Modellierungen bei gleichgesinnten Agenturen in Auftrag geben können als eine einzige Behörde. Glücklicherweise verfügt München über eine ganze Reihe an einschlägigen Beratungsfirmen, die bereit sind, ihr Angebot an die neue Zeit und ihre Bedürfnisse wie „Mobilität im Wandel“, „Elektromobilität“ und „Radverkehr“ anzupassen.
Und was machen die Menschen vor Ort, all die Haidhauser Bürger also, die vom Mobilitätsreferat als „Akteure“ bezeichnet werden? Sie sitzen bei schönem Wetter auf der einen Seite der neuen Fußgängerzone, wo viele den wundervollen baum- und blumenbestandenen Weißenburger Platz frequentieren, auch auf der anderen Seite am ebenfalls ansehnlichen Pariser Platz. Die Leute halten sich eben dort auf, wo sie es gemütlich finden – und nicht da, wo sie dem Mobilitätsreferat zufolge sitzen sollen. Wo beginnt Delegitimierung staatlichen Herrschaftswillens?

Wie geht es weiter mit dem Testlauf in Haidhausen? Ob Mobilitätsreferent Georg Dunkel seinem erklärten Ziel einer „autoarmen Altstadt“ mit der Teildemobilisierung des Autoverkehrs in der Weißenburger Straße einen Schritt näher kommt, werden er und die Münchner Bürger bald wissen. Denn – so verkündet es Dunkels mobilitätswendender „Geschäftsbereich Strategie“ – „zur Bewertung der Wirksamkeit [von Mobilitätsmaßnahmen] wird die Entwicklung der Mobilität in München kontinuierlich gemessen, berechnet und modelliert.“ Ob allerdings alle durch die Mobilitätswende freigesetzten Arbeitskräfte der Automobilindustrie in den dafür benötigten Evaluierungsbehörden, Projektagenturen und Modellierungs-StartUps unterkommen können, darüber verlautbaren die Münchner Wendepioniere nichts. Aber wenigstens können sie auf dem Straßengestühl neben der Baustelle Platz nehmen, um über die Neuaufteilung der Industrie zwischen Deutschland und China nachzusinnen.
Von Ergebnissen der Evaluation hat man bisher noch nichts gehört; nur indirekt wurde Nachbesserungsbedarf eingestanden: Im Frühjahr 2025 berichtete münchen.tv über eine neue Idee, die Zone „aufzuhübschen“, im Auftrag „der Stadt“, die eine Kunstaktion mit 10.000 Euro bezuschusst. Ergebnis: Bunte Quadratflächen auf Gehwegen und Fahrbahn, die schnell verschmutzen und auf wenig Gegenliebe bei Fußgängern stoßen. Wobei: eine SPD-Bezirksausschussende glaubt, die Farbe helfe dabei, die Fußgängerzone „ein bisschen fühlbar zu machen“.
Was man aber jetzt schon weiß – und das ganz ohne Messen, Berechnen und Modellieren: wie eine „Fußgängerzone“ mit „Aufenthaltsqualität“ auszusehen hat. Wer seinen Fuß vom „Zukunftsprojekt“ des Jahres 2024 in direkter Achse nur wenige Meter über den Weißenburger Platz hinweg auf den kurzen Abschnitt der Weißenburger Straße lenkt, welcher an der S-Bahn-Station Rosenheimer Platz endet, wird dies mühelos erkennen. Dort stehen keine „Enzis“ in grau betoniertem Nirwana. Hier laden Bistro- und Restauranttische von Cafes und Gastronomie zum angenehmen Verweilen ein (Außengastronomie gibt es in der Versuchszone mit einer kleinen Ausnahme übrigens nicht – wo denn auch zwischen Kübeln und Metallsitzen?). In dem naturbelassenen Straßenabschnitt ist Rad- und Rollerfahren nicht nur nicht erlaubt, sondern wurde in den letzten Jahren immer wieder per Bußgeldbescheid sanktioniert. Dort wurden auch keine Blumenkübel zur Dekoration installiert, dafür sind verwurzelte Bäume zuhause. In der untransformierten und deshalb zukunftsunfitten Straße bietet ein Gemüsestand seine Waren an, dienstags gibt es einen Wochenmarkt.

Allerdings handelt es sich um ein ganz und gar falsches, ja gefährliches Idyll. Es verschafft weder Stadtmöbelherstellern Aufträge noch einem städtischen Referat eine Existenzberechtigung, es kostet kein Steuergeld, vor allem aber entziehen sich Bürger hier der Lenkung und Raumaufteilung durch die berufenen Fachleute.
Stadtpolitiker sollten schleunigst eine Studie über diese Bürger und ihre Verweigerungshaltung in Auftrag geben. Nur so lässt sich die endgültige Spaltung der Gesellschaft in Haidhausen und weit darüber hinaus noch verhindern.
Jürgen Schmid ist Historiker und freier Autor. Er lebt in München.
Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” – fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt –, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.
Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.
Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.
Publico ist am Ende, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.
Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto
A. Wendt/Publico
DE88 7004 0045 0890 5366 00
BIC: COBADEFFXXX
Die Redaktion
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.
PayPal:

Überweisung:















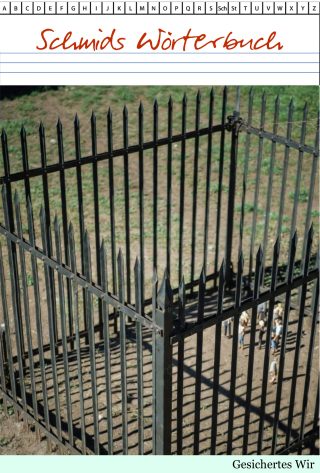
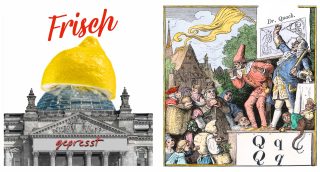

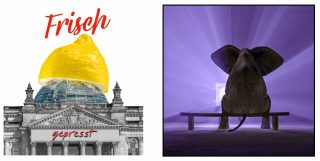

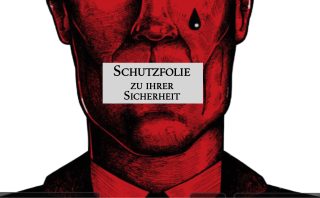

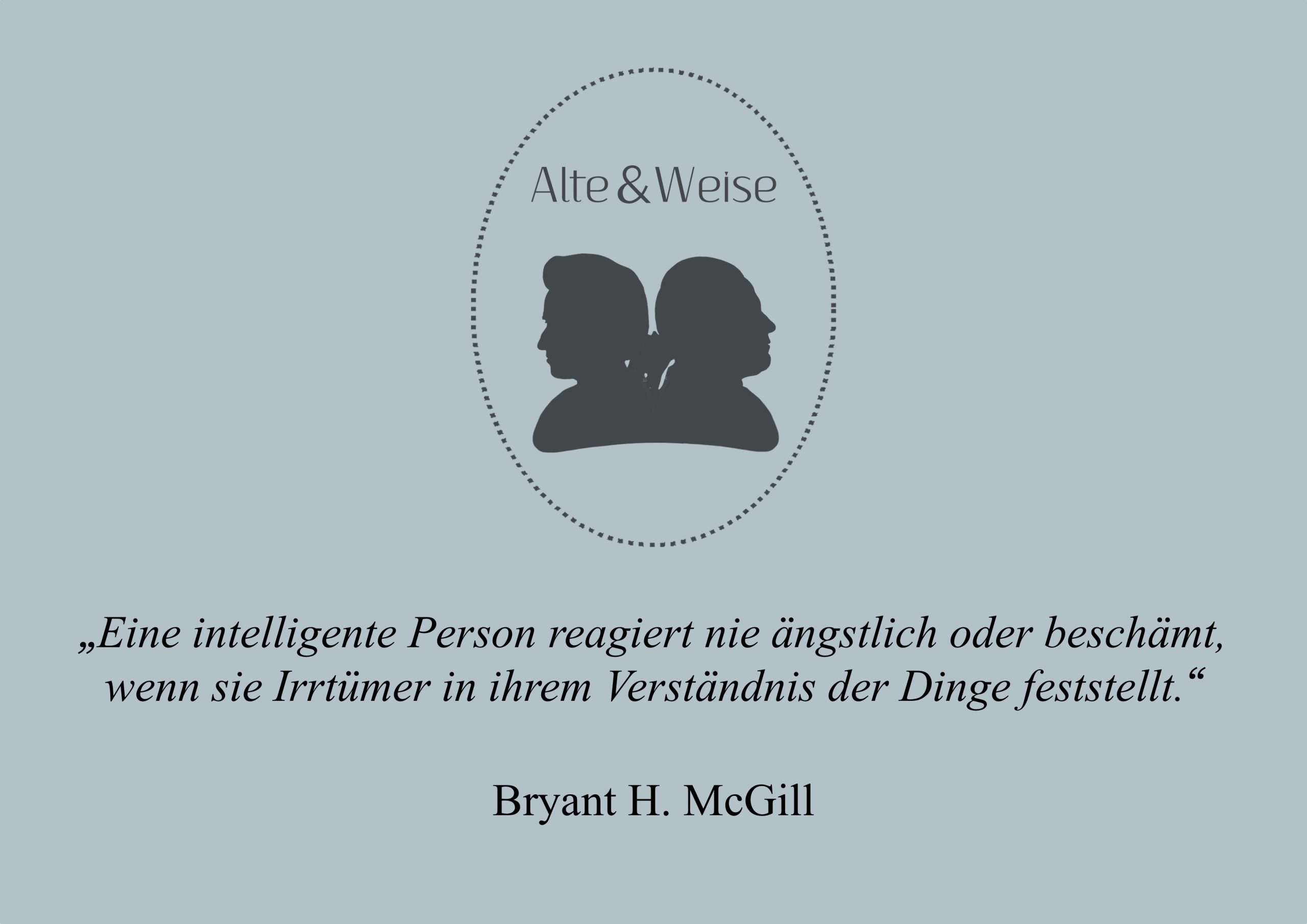
Andreas Rochow
04.06.2025Das könnte die Bewebung für den Titel „Shithole City“ sein. Die Olymischen Spiele in München dürften schon mal hinfällig sein. Die aggressive, antihumanistische, linksgrün-woke Symbolik macht mich traurig. In der DDR plakatierten sie weiß auf rot: Der Sozialismus siegt! Jetzt erhebt sich der Bolschewismus in der Verkleidung des rückwärtsgewandten, technikfeindlichen Weltenretters und verspricht wahrheitswidrig, dass es nur ohne Reiche, ohne Industrie, ohne Polizei, ohne Grenzen, ohne Energie, ohne Identität, ohne Verkehr und ohne eine vernünftige nicht-linke Opposition so richtig kuschelig wird. So gesehen ist der Great Reset ein lupenrein kommunistisches Projekt: Erstmal Kaputtmachen (Robert Habeck). Danach sehen wir weiter. Das hat Genosse Gregor Gysi von der Mauerschützen-SED bis 1989 auch gedacht, bis er sich in die verhasste westdeutsche Demokratie integrieren musste! „Besitzlos aber glücklich“ sollen wir ausgerechnet nach Vorstellung des globalistischen Superkapitalisten Klaus Schwab werden, der aber nicht wagte, das Chaos vor seinem „Great Reset“ als bolschewistisches Zerstörungswerk zu benennen. Bis dahin heißt es: Aussteigen und zu Fuß auf die Barrikaden!
MySenf
06.06.2025Danke für diesen Artikel wie auch schon den von Herrn Wendt „ein Stadtbild wie der Unterarm…“. Ich dachte bisher, das beschränkt sich auf Berlin, aber stimmt, die Orks sind jetzt auch hier. Ja, Sie sehen das ganz richtig: Es geht nicht darum, den Bürgern etwas Gutes zu tun. Dann würde man einfach Bäume pflanzen – richtige Bäume, nicht „Begrünung“ in blöden Kübeln – und drunter Cafétische aufstellen. In München herrscht bei schönem Wetter ein notorischer Mangel an Cafés zum Draußen sitzen! Und die Autos in der Weißenburger Straße waren noch nie ein Problem.
(Pseudonym: ) Curt Tuschinsky
08.06.2025Da kommt ja nun endlich! was ins Rollen! Da werden nicht nur Kisten mit Hausmüll und versifften Sofas auf den Gehweg gestellt, nun kommt es dicke – und das wird dann auch noch bezahlt. Von den paar Blöden, die noch schuften. Und da kommen die Radtrampler endlich richtig zum Zuge. Das Maximaltempo eines Radler auf engem Fussweg war ca 55 km/h – ich bin schnell rübergesprungen, in Gera knallte der Pizza-Lasten-Rudi von Domino noch schnell bei Kirschgrün über die Ampel und rief „Weg da“ (ich als Fußgänger. Seitdem haben sie einen Kunden weniger. Aber diese Firmen“profis“ lastenfahrradeln immer auf dem Fussweg), überhaupt, breite Fahrrad- und Fusswege: wo rast der Radler? Auf dem Fusweg. Hat sich irgendwie eingerollt.
Nun (endlich!, wiegesagt) werden die letzten Parkplätze zu Sitz- und Kiffkolonien (den ersten Agitationsfilm zum Thema sah ich am 6.6. im ZDF*in) und die Parks, wo man sich ja auch treffen könnte (Bänke sind ja da) könnten gute Zeltplätze hergeben oder die Wohnwagenkolonien könnten endlich (!) dort hin umziehen. Strom (grüner natürlich) sollte es kostenlos geben (gleich auf den Kilowattpreis draufgesetzt) – da gibt es viel zu tun und einen Bakkelor braucht man für diese Ideen nicht. Gib den Langschläfern einen Tschoint mehr, dann haben die das ritz-ratz raus. Für zwei Tschoints pro Idee. Vielleicht als nächstes Expansionsziel: die Parkdecks der Innenstädte „beleben“. Oder die Gärten der Villen – die ja alle viel zu groß sind für die Milljonäre…