Es kommt selten vor, dass ein amerikanisches Sachbuch fast zeitgleich in den USA und Deutschland erscheint. Im Fall von „Original Sin“ der Journalisten Jake Tapper und Alex Thompson, die den geistigen Verfall Joe Bidens und die Operation eines politisch-medialen Komplexes zur Leugnung des Offensichtlichen beschreiben, liegt das Buch seit Mai auch hierzulande unter dem Titel „Hybris. Verfall, Vertuschung und Joe Bidens verhängnisvolle Entscheidung“ vor.
Trotz deutlicher Schwächen, um die es gleich gehen soll, handelt es sich um eine empfehlenswerte Lektüre. Tapper, Journalist bei CNN, und Thompson, tätig für Axios, sprachen für „Original Sin“ mit zahlreichen Schlüsselfiguren aus dem Weißen Haus und der Demokratischen Partei, die offen redeten, meist allerdings unter der Bedingung, anonym zu bleiben. Daraus entsteht ein dichtes dokumentarisches Bild; vor allem zerstören die Autoren aber eine ganze Reihe von Entlastungserzählungen, die Politiker der Demokraten und etliche ihnen zugeneigte Journalisten nach der totalen Niederlage von Kamala Harris und dem Sieg Donald Trumps verbreiteten.
Ohne es direkt auszusprechen, erzählen Tapper und Thompson eigentlich nicht die Geschichte einer Irreführung und Täuschung: denn schon 2022, spätestens 2023 existierten genügend Bilder, die einen Biden zeigten, der orientierungslos durch den Rosengarten des Weißes Hauses taperte, dessen Sätze im Nichts endeten, und der bei öffentlichen Auftritten ganz offenkundig den Faden verlor. Täuschung hätte bedeutet, diesen Niedergang zu verbergen – was der enge Zirkel um den Präsidenten allenfalls noch Anfang 2020 schaffte. Ab einem bestimmten Zeitpunkt richtete die Truppe, im Buch „Politbüro“ genannt, ihre Anstrengungen auf ein anderes Ziel: Nämlich, Millionen Amerikanern und selbst Nichtamerikanern einzureden, dass es sich bei dem, was sie sahen, nicht um die Wirklichkeit handelte, sondern um „Fakenews“, „Desinformation“, die Ausgeburt von Trump-Helfern oder schlicht um persönliche Fehlwahrnehmung. Die Technik nennt sich Gaslighting; „Hybris“ schildert also das bisher größte Gaslighting-Experiment der Geschichte.
Dass diese Hypnose der Öffentlichkeit zeitweise funktionierte, zumindest bei einer Teilöffentlichkeit, gehört zu den finsteren Befunden der Reportage. Der deutsche Titel „Hybris“ passt besser als das stark moralisch konnotierte „Original Sin“: Im Zentrum der seitenlangen Recherche steht eine Gruppe von Machttechnokraten, die fest daran glauben, zwar nicht die Realität selbst steuern zu können, aber deren Wahrnehmung. Gegen das Narrativ verliert die Wirklichkeit – so ließe sich ihr Arbeitsmotto zusammenfassen.
Zweitens zeigen die Autoren, dass und wie das mächtigste Land der Welt spätestens in Bidens zweiter Amtshälfte tatsächlich von einem „Politbüro“ von fünf Personen geleitet wurde, deren Namen den meisten Durchschnittsamerikanern nichts sagten. Die entsprechende Stelle im Buch charakterisiert es so: „In der Praxis war Bruce Reed der wichtigste Berater für innenpolitische Themen, Mike Donilon war der tatsächliche politische Direktor, Steve Ricchetti war verantwortlich für Gesetzgebungsvorhaben und (Stabschef) Ron Klain mischte überall ein bisschen mit. ’Er ist fast achtzig, er weiß, was er will, und wir wissen, wie wir mit ihm umgehen müssen‘ – das war die interne Maxime. All diese Faktoren führten dazu, dass der innere Kreis einzigartig klein und loyal war. Manche hatten das Gefühl, dass das Inseldasein des ’Politbüros‘ dazu beitrug, dass es seinen Einfluss behauptete. ’Fünf Leute führten das Land und Joe Biden war, wenn überhaupt, Seniorchef dieses Gremiums‘, sagte jemand, der mit der internen Dynamik vertraut war.“
Unter verfassungsgemäßen Bedingungen müsste der Vizepräsident beziehungsweise die Vizepräsidentin zusätzlich Regierungsgeschäfte übernehmen, wenn die Fähigkeiten des Amtsinhabers nachlassen. Kamala Harris allerdings, das zeigt „Hybris“, befand sich noch nicht einmal in der Nähe des inneren Zirkels, der sich an Stelle des Präsidenten setzte. Auch darin liegt die Qualität des Buchs: Es führt vor, wie schnell sich die zentrale Institution selbst eines Landes mit langer demokratischer Tradition in eine Kulisse verwandeln lässt, hinter der sich Strukturen etablieren, die nirgends in der Verfassung stehen. Gerade in der Zeit, da Medien und oppositionelle Politiker Trump vorwerfen, „Institutionen auszuhöhlen“, liest es sich interessant, wie genau das tatsächlich zwischen 2022 und 2024 in den USA geschah.
Zu den wenigen Personen, die nicht unter Anonymitätsschutz mit Tapper und Thompson redeten, gehört David Plouffe, einer der Berater des Wahlkampfteams von Harris. Die Autoren zitieren ihn mit dem Satz: „Wir als Partei sind von Biden dermaßen betrogen worden“, und: „Er hat uns total in die Scheiße geritten.“ Genau diese Post-Desaster-Legende der Demokraten, Biden und seine Umgebung hätten die Partei getäuscht, erledigt „Original Sin“ beziehungsweise „Hybris“ restlos: Die gesamte Führung der Demokraten wusste über Bidens geistigen Niedergang Bescheid, sie wusste auch, dass er schneller voranging, als es die ersten Videos des stolpernden und konfus redenden Präsidenten ahnen ließen. Sie beteiligten sich an der Umformung der Wirklichkeit, bis es nicht mehr ging. Selbst nach der katastrophal verlaufenen Präsidentschaftsdebatte zwischen Trump und dem Amtsinhaber, als die ganze Nation seine Senilität vorgeführt bekam, meinte Barack Obama, Biden hätte eben „einen schlechten Abend“ gehabt. Ihre fortgesetzte Wirklichkeitsverzerrung – heute mit ‘Biden ist schuld‘ – verzeihen viele Wähler offenbar nicht. Ende Mai 2025 erklärten in einer Erhebung von The Economist und YouGov 36 Prozent der Befragten, die Demokraten zu bevorzugen, während 57 Prozent sie ablehnten.
Warum beteiligte sich die gesamte Führung der Partei an der Operation Gaslight? Offenbar deshalb, weil man dort glaubte, damit durchzukommen. „Er musste nur gewinnen und dann konnte er für vier Jahre verschwinden – nur ab und zu hätte er auftauchen müssen, um zu zeigen, dass er noch lebt“, zitieren die Autoren einen anonymen Biden-Berater: „Seine Mitarbeiter könnten für ihn einspringen. ‘Wenn man für jemanden stimmt, stimmt man auch für die Leute um ihn herum.’“ Das „Politbüro“ und der Tiefenstaat hinter ihm betrachteten ihre Herrschaft also ganz offensichtlich als legitim. Die Passage wirft ein erklärendes Licht auf das Verhältnis dieser Art Regierungstechnokraten zum Demokratieprinzip. Sie meinten (und meinen wahrscheinlich immer noch), dass die Herrschaft eines nicht legitimierten Zirkels der Richtigen die höhere Moral für sich beanspruchen kann als die Regierung eines zwar gewählten, aber aus dem falschen politischen Spektrum stammenden Staatschefs.
Im Fall eines Harris-Sieges hätten die gleichen oder sehr ähnliche Leute versucht, dann eben sie entsprechend zu lenken. Ein Detail im Buch macht plausibel, dass ihnen das wahrscheinlich auch gelungen wäre: Es zeichnet das Bild einer völlig unsicheren Person, die sich selbst für einen Dinner-Auftritt trainieren ließ. „Im April 2022“, heißt es über die Vizepräsidentin, „sollte sie an einem zwanglosen Abendessen mit Journalisten und Prominenten im Haus von David Bradley teilnehmen – einem einflussreichen Pressemagnaten aus Washington. Die Harris-Mitarbeiter hatten immer Angst, dass ein solcher Abend nicht glatt verlaufen könnte, also hielten sie vor diesem Event ein Probedinner ab, bei dem Mitarbeiter die Rollen der Gäste übernahmen.“
Über längere Strecken wirkt das eingängig geschriebene und in Kurzkapitel gegliederte Werk Tappers und Thompsons unterhaltend, weil durchaus komisch. Denn die Art und Weise, wie die Wirklichkeitsklempner von Washington die Kunstfigur des agilen, ganz und gar amtstüchtigen Biden zusammenbastelten, trägt durchaus klamottenhafte Züge. Der innere Zirkel versuchte zwar die Auftritte des Präsidenten zu reduzieren. Andererseits brauchte man die Bilder eines noch amtsfähigen Chefs. Also passten die Regierungs-Kamerateams, die Bidens Auftritte vor Bürgern filmten, ihre Arbeitsweise den Umständen an.
Um seine Ausfälle zu kaschieren, so Tapper und Thompson, „filmte sein Stab Biden mit zwei Kameras statt nur mit einer. Falls er die Aufnahme vermasselte, konnte man den Schnitt mit einem Kamerawechsel leichter kaschieren. Auch andere Politiker setzen solche Sprungschnitte ein, doch die Biden-Leute brauchten sie beim Präsidenten weitaus öfter als normal. Wenn sie Videos aufnahmen, war viel von dem Material unbrauchbar. ’Der Mann konnte nicht reden‘, sagte einer der Beteiligten. Das Problem war nicht sein Stottern, sondern sein Ringen um Worte, die Unfähigkeit, sich zu erinnern, worüber er gerade sprach, und bei einem Gedankengang zu bleiben. Seine Mitarbeiter drehten die Videos manchmal in Zeitlupe, um zu verschleiern, wie langsam er sich tatsächlich bewegte. Und wenn sie fertig waren, mussten seine Mitarbeiter das Material stundenlang schneiden, um Biden im besten Licht dastehen zu lassen. Manchmal hatte der Präsident solche Schwierigkeiten, sich auszudrücken, dass die Videos nicht mehr zu retten waren und das Biden-Team sie nicht freigab.“
Die Kabinettssitzungen fanden nach einem vorgefertigten Skript statt, das Donilon, Stabschef Klain und andere entwarfen, um Diskussionen am Tisch zu verhindern, denen der Präsident nicht mehr hätte folgen können. „Die Kabinettssitzungen waren oft schrecklich und unangenehm, und das waren sie schon von Anfang an“, so ein Ex-Minister, den das Buch zitiert: „Ich kann mich an keine Sitzung erinnern, die durch seine Präsenz beeindruckt hätte. Alles lief strikt nach Drehbuch.“ Ein anderes Kabinettsmitglied: „Man will doch dort die Wahrheit hören und echte Dialoge führen, aber das war in diesen Sitzungen unmöglich.“
Das, was sich demnach im Zentrum der amerikanischen Regierungsmacht abspielte, erinnert zum einen an den Film „The Trouble with Harry“, zum anderen an „The Truman Show“. Nur mit dem Unterschied zum ersten Film, dass der Harry, der hier Joe hieß, durchaus lebte, aber eben in einem bedauerlichen Zustand, und zur „Truman Show“, dass das riesige Täuschungstheater nicht etwa auf Biden zielte, sondern auf 330 Millionen Amerikaner und eigentlich die gesamte Weltöffentlichkeit.
Die große Schwäche von „Hybris“ liegt darin, dass Tapper und Thompson die Rolle ihrer eigenen Branche nur sehr knapp abhandeln. Ohne die etablierten Medien, die Videos von Bidens erratischem Auftritt beim G-7-Gipfel 2024 und andere Aufnahmen zu „Deep fakes“ (Washington Post) erklärten und dutzendfach kurz vor dem Fernsehduell Biden-Trump verbreiteten, der Amtsinhaber sei „sharp as a tack“, wäre die Inszenierung nicht möglich gewesen. Die Autoren verzichteten darauf, mit Vertretern der großen Zeitungen, Magazine und Sendeanstalten ähnliche Gespräche zu führen wie mit den Mitarbeitern von Administration und Partei. Diese Lücke muss der Leser durch eigene Schlussfolgerungen füllen.
Trotz dieses Mangels lässt sich „Hybris“ als Handbuch zur Wirklichkeitsverbiegung lesen – beziehungsweise als Leitfaden, um derartige Unternehmen zu erkennen. Die erste Regel für alle, die einer großen Öffentlichkeit eine designte Wirklichkeit aufdrängen wollen, lautet: Versuche es nicht subtil. Übertreibe hemmungslos. Hätten die Leute des inneren Zirkels vor der TV-Debatte erklärt, Biden sei in einem leidlich guten Zustand, dann wäre das immer noch die grobe Unwahrheit gewesen. Es musste aber unbedingt die Maximierung „sharp as a tack“ sein. Dass Jill Biden und andere Mitglieder des klandestinen Zirkels Joe Biden unmittelbar nach der TV-Debattenkatastrophe auf eine Bühne schleiften und ihn als Quasi-Sieger bejubelten, gehört zu den gruseligsten Szenen der amerikanischen Politik überhaupt. Aber sie besaß ihre innere Logik: Nur eine maximal brutale Entstellung der Realität lässt Normalmedienkonsumenten an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln.
Zweitens: Moralisiere. In dutzenden Kommentaren von Parteifunktionären und Journalisten hieß es, als der Zustand des Präsidenten sich immer deutlicher auch für die Öffentlichkeit abzeichnete, er sei ein „anständiger Mann“. Das stimmte nicht; ein anständiger Amtsinhaber hätte sich aus dem Weißen Haus zurückgezogen. Biden nahm seine Ausfälle schließlich durchaus wahr. Aber die Frontenstellung funktionierte offenbar zumindest für bestimmte Milieus und gerade für Medienmitarbeiter: hier der bedauerlicherweise senile Biden, den eine Kamarilla steuerte – dort der moralisch indiskutable Trump, den man mit allen Mitteln vom Weißen Haus fernhalten musste.
Drittens: Skandalisiere deine Gegner. Diese Methode demonstrieren Tapper und Thompson sehr schön am Einsatz des Sonderermittlers Robert Hur, der 2024 die (illegale) Einlagerung von Regierungsdokumenten aus Bidens Vizepräsidentenzeit in dessen Haus in Delaware untersuchte. Hur schrieb anschließend in seinem Bericht, Biden sei ein „wohlmeinender älterer Herr mit schlechtem Gedächtnis“ und riet von einer Strafverfolgung ab. Damit tat er Biden objektiv einen Gefallen. Trotzdem fielen der Abgeordnete der Demokraten Adam Schiff und Harris über Hur her; Schiff beschuldigte ihn, sich an einer Kampagne gegen den Präsidenten zu beteiligen.
Die Autoren von „Hybris“ veröffentlichten wesentliche Teile der Befragung Bidens durch Hur und FBI-Mitarbeiter. Das erstmals publizierte Protokoll zeigt Biden in einem derart desolaten Zustand, dass die Democrats Hur nachträglich kniefällig Blumenbuketts senden müssten. Biden redete der Aufnahme zufolge weitschweifig über die Einrichtung seines Hauses, dann aber auch vom Mongoleneinfall in Europa, er konnte den Tod seines Sohnes Beau (er starb 2015) nicht mehr dem richtigen Jahr zuordnen, sprach dann aber länger über ihn, und fing am Ende der Befragung noch einmal von Beau an. Alles in allem wirkte er völlig konfus, allerdings bei bester Laune.
Regel Nummer vier: Die Begriffe „Fake“ und „Desinformation“ kann gar nicht oft genug und wahllos verwenden, wer die Realität umbiegen will.
So etwas wie ein Handbuch scheint tatsächlich zu existieren. Dazu ähneln bestimmte Muster länderübergreifend einander zu stark. Zum Punkt des hemmungslosen Übertreibens fallen einem deutschen Betrachter die hypertrophen Lobgesänge der Medien auf Annalena Baerbock – “Lizenz zum Weltendeuten“ – Süddeutsche Zeitung 2021 ein, gestylt für eine Politikerin, die ihren Lebenslauf fälschte und groteske Sentenzen zum Besten gab („Grundlasthuhn“).
Skandalisierung: Etliche Medien unter besonderer Beteiligung des ÖRR fanden es damals unerhört, dass sich überhaupt jemand mit ihren Studienabschlüssen und ihrem zusammenplagiierten Buch befassten. Ein politisch-mediales Milieu erklärte 2024 nicht etwa die Millionenflüsse an Nahstaatsorganisationen zum Skandal – sondern die parlamentarischen Fragen danach. Moralisieren statt argumentieren: Dazu fällt jedem eine Überfülle von Beispielen ein.
Die in „Hybris“ erzählte Geschichte reicht deutlich über die Zeit bis 2024 und weit über die USA hinaus. Das macht sie trotz ihrer Lücken lesenswert.
Europabücher, die lieber nichts von Europa wissen wollen
Kritiker Jürgen Schmid wirft einen Blick auf Neuerscheinungen zu dem Thema, die fast alle die Frage nach der Identität des Kontinents umgehen – schon deshalb, weil sie die EU mit dem Weltteil gleichsetzen. Ein Werk empfiehlt er trotzdem
von Jürgen Schmid
So aggressiv-laut der Aufschrei deutscher und Brüsseler Politiker und ihrer angeschlossenen Funk- und Pressehäuser auf die Münchner Rede des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance auch ausfiel, so verschämt ließen sie alle eine, vielleicht die zentrale Frage seiner Wortmeldung unter den Tisch fallen: Worin besteht die positive Vision der Gemeinschaft, die sich EU nennt?
Wer in der letzten Zeit die medial kommentierten Aktivitäten dieser glühenden Europäer verfolgt – denn so sieht sich die EU-Elite gern –, der muss den Eindruck gewinnen, dass vor allem eine Vision oben auf der Agenda steht: Erhöhung des Militäretats und Aufrüstung im Kampf „gegen Putin“ und dessen angeblichen Expansionswillen weit über die Ukraine hinaus. Bekanntlich wollte Vance in München wissen, was die EU-Staaten eigentlich verteidigen wollen. Dazu würde neben der Frage: „Wo stehen wir, wo wollen wir hin“ auch und sogar vordringlich geklärt werden müssen: „Wo kommen wir her?“ Kurz: „Wer sind wir?“
Nun wird man Politikern im Tagesgeschäft, die mal mehr, mal weniger hysterisch auf Ereignisse und Stimmungen des Tages reagieren, eine etwas eingeschränkte Sicht auf die Longue durée der Geschichte nachsehen. Aber die vielen Welterklärer, die als Historiker und Philosophen, Think Tanker und Berater, Schriftsteller und sonstige Experten im Hintergrund, die eigentlich über Zeit und Muße für tiefschürfendes Nachdenken verfügen: Wie definieren sie, was Europa ausmacht und im Innersten zusammenhält?
Betrachtet man den Buchmarkt mit Blick auf die Neuerscheinungen zu Europa, fällt sofort auf: In der Unübersichtlichkeit herrscht Einigkeit über zwei Punkte: Man setzt EU und Europa unhinterfragt gleich – und hält die EU alternativlos für ein Zukunfts- und Friedensprojekt. Schaut man etwas genauer hin, fällt eine gähnende Leere auf: Keiner der Autoren kann auch nur im Ansatz beantworten, worin die gemeinsame Vision bestehen könnte, weil dazu die Frage nach der Identität erst einmal gestellt werden müsste. Diese Notwendigkeit scheint keinem aufzufallen. Was aber tun, wenn eine Lücke klafft, wenn glühende Europäer, die gar nicht wissen, woran sie sich eigentlich erwärmen, anderseits nicht wollen, dass die Identitätsfrage ins Bewusstsein der europäischen Bürger dringt? Das gemeinsame Muster der meisten Bücher zu dem Thema lässt sich so beschreiben: Umso mehr Staub aufwirbeln, je weniger Substanz man zu bieten hat; die immergleichen Phrasen über „Demokratie“ und „Freiheit“ verbreiten lassen, um mit schierer Textmasse dem Publikum das Gefühl zu geben, es gäbe Diskussionsstoff in unerhörter Vielfalt und Qualität.
Vier Beispiele für enttäuschende Leere bei anhaltender Substanzsimulation sollen das illustrieren – ein Verlagsprogramm, eine Literatursendung und zwei europäische Vordenker:
Der Europa Verlag, gegründet 1933 in der Schweiz, heute mit Sitz in München, engagiert sich, so die Selbstbeschreibung, „für die Werte Europas“, worunter man – recht unspezifisch – „Demokratie, Freiheit, Menschenrechte“ versteht. Unter den Neuerscheinungen in der Rubrik „Europa“ stehen im April 2025 bei den lieferbaren Titeln zuoberst: Klaus-Rüdiger Mais Biographie „Angela Merkel. Zwischen Legende und Wirklichkeit“ und ein Buch über den innerrussischen „Widerstand gegen Putins neue Weltordnung“. Dazu, noch weiter oben: „Anmerkungen zum Holocaust“, angekündigt für November dieses Jahres, außerdem: „Adolf Hitler – Ein Mann gegen Europa“ für März nächsten Jahres. Wer hier Aufschluss über die Werte Europas sucht, über die Frage des Woher in einem positiv-substantiellen Sinn und über die Gemeinsamkeit einer europäischen Vision, dürfte nach dem jetzigen Stand bei dem Publikationshaus nicht fündig werden, das Europa im Namen trägt.
Die WDR3-Literaturreihe „Gutenbergs Welt“ stand im Januar unter dem Titel „Neue Bücher über das Modell Europa“. Hier beginnt die Floskelei bereits im Werbetext: Europa, heißt es dort, wäre „die Idee der Menschenrechte, des Liberalismus, des Rechtsstaats“, und diese Ideale stünden „unter Druck“. In diesem Stil moderiert man sich durch die Sendung, benennt als „Herausforderungen“ erwartbar „Autoritarismus, Populismus, Klimakrise“ – und hat nicht viel mehr zu bieten als Ratlosigkeit über dieses – so wörtlich – „merkwürdige Gebilde“ Europa, in dem wir nun mal zuhause seien, und dessen Eigenschaften „unklarer denn je“ wären. Auf die Idee, nach diesen Eigenschaften einmal auf anderen Wegen zu suchen als auf den ausgetretenen und verdorrten Hauptstraßen der üblichen EU-Textbaustein-Produzenten scheint man aber nicht zu kommen. Selbst das einzige Buch, das in dieser Europa-Sendung einen erkennbaren Europa-Bezug aufweist, Sloterdijks „Kontinent ohne Eigenschaften“, führt – der Titel kündigt es an – auch nur in die Ratlosigkeit.
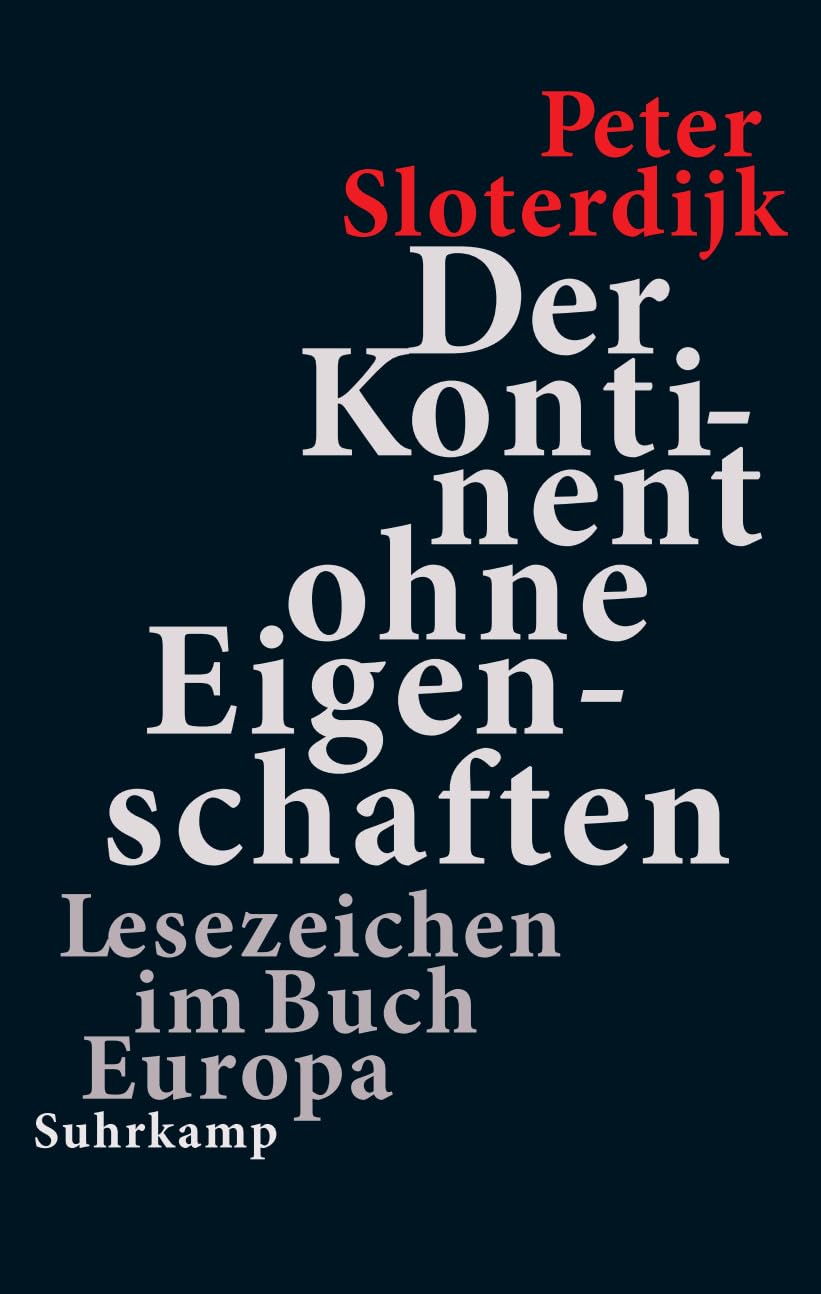
Eigentlich macht es der Suhrkamp-Verlag dem Interessenten leicht, den „neuen Sloterdijk“ nicht zu erwerben, wenn er auf den Klappentext diese Sentenz setzt: „Das wahre Europa, so Sloterdijk, findet sich überall dort, wo die schöpferischen Leidenschaften denen des Ressentiments den Rang abgelaufen haben.“ Diese Wortverschlingung zeigt das Problem, das Sloterdijk mit sich trägt: Er liebt erkennbar seinen eigenen Sound.
Europa (meint der Autor die EU?) habe sich „in die Niemandsposition zurückgezogen“. Liegt darin womöglich auch ein verborgenes Selbstporträt des Philosophen Sloterdijk? Wer wie er beständig stets von allem spricht, alles mit allem verbindet – im Europa-Buch etwa Marxismus, Luhmanns Systemtheorie, Patentierung des Dynamit, Erfindung der Vollnarkose und Religionsfreiheit – und gleichzeitig jede Position, die er bezieht, sofort wieder mit einer Gegenposition versieht – europabezogen in einem Bogen vom Lob „zivilisationsgeschichtlicher Leistungen“ über die Bestärkung des Vorwurfs, imperial „das Niederträchtigste“ in alle Welt exportiert zu haben, zurück zur Verteidigung des „Projekts Europa“ gegen seine Kritiker –, dem fehlt irgendwann vielleicht tatsächlich die wichtigste Eigenschaft des Autors, nämlich die, eine Position zu bestimmen.
Und als würde die politmediale Klasse nicht schon genug Hohlformeln prägen, betätigt sich auch der Philosoph an deren Produktion, wenn er von „Kunst des Interessenausgleichs, Kompromissfähigkeit, Demokratie und Rechtsstaat“ als „Kategorien des öffentlichen europäischen Lebens“ ausgeht. Sein ceterum censeo: Die Religionsfreiheit sei die bedeutendste zivilisationsgeschichtliche Leistung Europas. Was, wenn nicht das Christentum, hätte Europa jahrhundertelang zusammengehalten, möchte man fragen? Aber man würde ja ohnehin nur eine Antwort erhalten, die ein weiteres Buch füllt und alle Fragen offenlässt.
Was Sloterdijk genau weiß: Wer schuld ist an der EU-Verdrossenheit, die er und viele andere als „Hass auf Europa“ umdeutet: das undankbare Volk. Wenn der WDR beklagt, „ungeachtet aller Annehmlichkeiten“ für die Bürger, wäre die EU „nie zu einem wirklich identitätsstiftenden Projekt geworden“, trägt dafür nicht der gescheiterte Identitätsstifter die Verantwortung, sondern jene Europäer, die ihre „Bringschuld“ dem Projekt gegenüber nicht erfüllen. Sie sind undankbar – solch eine Anklage erinnert an Habecks Pressekonferenz nach seinem Bündniskanzler-Aus bei der Bundestagswahl vom Februar 2025: Das Angebot sei „top“, die Nachfrage sei das Problem gewesen. Undankbarkeit, so Sloterdijk, sei ein Synonym von Unbelesenheit, aber heilbar. Doch ist „Europa ein Buch, das von denen, die es angeht, zu wenig gelesen wird, und in dem seine Hasser nur blättern, um ihre Anklagen zu dokumentieren“? Wenn Europa wie ein Buch ist, das identitätsstiftend wirken kann, warum präsentiert man den Europäern dieses Buch dann niemals, sondern belehrt sie nur darüber, wie erstrebenswert die Vision eines geeinten Europas wäre, ohne dass die Visionäre sagen können, worauf sie gründet und worin sie besteht? Ehrlichkeit wäre vielleicht ein erster Ansatz für jede ernstgemeinte Beschäftigung mit europäischer Identität – wozu die Feststellung Dirk Glasers gehört, dass es „kein europäisches Volk als Erinnerungskollektiv“ gibt, weshalb auch keine „europäische Öffentlichkeit“ existiert, „die diesen Namen verdienen würde“, wie Hans Magnus Enzensberger 2011 in seinem Essay „Sanftes Monster Brüssel oder Die Entmündigung Europas“ anmerkt.
Peter Sloterdijk, Der Kontinent ohne Eigenschaften. Lesezeichen im Buch Europa. Suhrkamp, Berlin 2024, 320 Seiten, 28 Euro
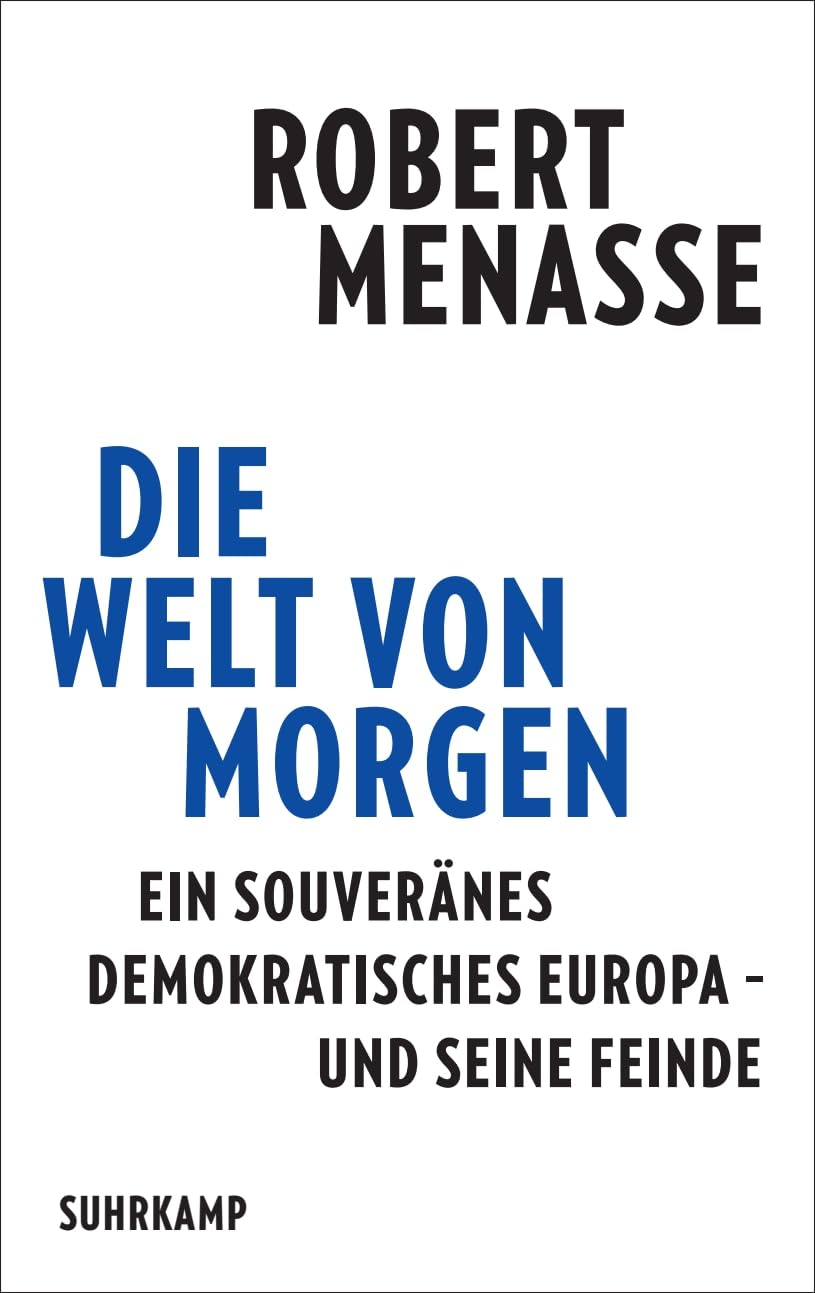
Kann sich der geneigte Leser in einem Sloterdijk-Buch stets das ein oder andere Bonmot herauspicken, über das nachzusinnen lohnt (etwa die provokante Frage „Was ist Europa anderes als ein Klub aus Nachfolgern gedemütigter Imperien?“), bilden EU-Hymnen von Robert Menasse nur Wüsten der Langeweile und erwartbarer Gemeinplätze samt Invektiven gegen rechts. (Was beiden Büchern gemein ist: das bemühte Spiel mit berühmten Werktiteln, einmal angelehnt an Robert Musil, das andere Mal an Stefan Zweig.)
Schon der erste Satz, den der Verlag als Buchankündigung serviert, ist eine Manipulation: „Robert Menasse erklärt und verteidigt – im Jahr der Europawahl – die europäische Idee“. 2024, als das Buch erschien, wurde nicht in Europa gewählt, sondern in den Mitgliedsstaaten der EU, was – auch wenn diese Feststellung ermüdend oft getroffen werden muss – einen signifikanten Unterschied macht. Damit ist aber immerhin gesagt, was das Buch sein wollte: Ein etwas zu lang geratener Aufruf, bei den Wahlen zum EU-Parlament die „demokratischen Parteien“ zu wählen und Abstand zu nehmen von Alternativen. Dafür hätte es ein Plakat auch getan.
Viel mehr, als dass „Nationalismus“ böse sei und „das europäische Projekt bedroht“, will Menasse eigentlich nicht als Erkenntnis unters Volk bringen. Warum man allerdings für diese Aussage, die einem jeden Tag von allen Medien und von sämtlichen Verlautbarungstafeln des öffentlichen Raumes nahegebracht wird, ein Buch von 192 Seiten zum Preis von 23 Euro erwerben und lesen soll, davon steht in der Verlagsankündigung nichts. An wen sich dieser Text eigentlich richtet, bleibt im Unklaren. Wer die Vereinigten Staaten von Europa ohnehin schon für eine gute Idee hält – denn zu diesem Endziel soll sich die EU nach Menasses Ansicht transformieren –, der liest nichts Neues. Alle anderen dürfte dieses Manifest kaum überzeugen.
Man muss schon sehr weit zurückgehen in der Galerie der Europa-Visionäre, um etwas Substantielles zur europäischen Idee zu finden: Richard von Coudenhove-Kalergis Manifest „Pan-Europa“ erschien 1923; José Ortega y Gasset fragte 1953 dezidiert nach einem „europäischen Kulturbewußtsein“, das er als „Grundkapital“ gemeinsamer „Bräuche“ aus der Geschichte abgeleitet sehen wollte. Jan Patočka trat mit seinem Essay „Europa und das Europäische Erbe bis zum Ende des 19. Jahrhunderts“ 1975 auf den Plan, Manfred Fuhrmann beleuchtete 2002 in seiner Streitschrift „Bildung“ wesentliche Aspekte von „Europas kulturelle[r] Identität“. Inzwischen sind Autoren selten zu finden, die auf der Klaviatur substantieller Ideen zu Europa spielen können (und wollen). Und wenn, dann handelt es sich überwiegend um EU-Kritiker, auf die eine größere Öffentlichkeit nicht hört, weil sie aus der nichtoffiziösen Richtung denken, etwa Felix Menzel und Philip Stein mit „Junges Europa. Szenarien des Umbruchs“ (2013) oder der Althistoriker David Engels mit seinem Plädoyer für eine „Renovatio Europae“ (2019), die sich mit „einer tiefen Verankerung im kulturellen, historischen und spirituellen Unterbewußtsein einer seit Jahrhunderten geteilten Vergangenheit“ befasst.
Aus der gegenwärtigen Europabuch-Überproduktion ohne Mehrwert (mit Sloterdijks Werk wurde noch eines der wertigsten dieser Produkte vorgestellt) folgt zweierlei: Zum einen ermüdet sie durch ihre Wiederholungsschleifen, zum anderen verstellt sie die Frage von Vance – diejenige nach anknüpfungsfähiger Identität in einer 3000-jährigen Geschichte des Abendlandes – so gründlich, dass irgendwann nur noch eine unwillkürliche Ermattung beim Stichwort Europa auftritt, also die Europa-Müdigkeit, welche die EU-Elite ja gerade verhindern zu wollen vorgibt.
Alles in allem: Die Masse substanzloser EU-Apologetik nimmt denen Platz und Aufmerksamkeit, die Europa rückgebunden in seine Geschichte und Kultur zu verstehen und zu fundieren versuchen.
Genau das dürfte Aufgabe und Ziel der Europabuchflut sein: die Frage nach der Substanz Europas totzureden, um die EU zu stabilisieren.
Robert Menasse, Die Welt von morgen. Ein souveränes demokratisches Europa – und seine Feinde. Suhrkamp Verlag, Berlin 2024, 192 Seiten, 23 Euro (gebunden), 14 Euro (Broschur)
Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” – fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt –, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.
Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.
Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.
Publico ist am Ende, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.
Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto
A. Wendt/Publico
DE88 7004 0045 0890 5366 00
BIC: COBADEFFXXX
Die Redaktion
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.






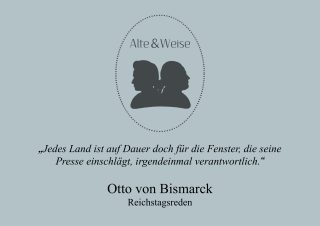

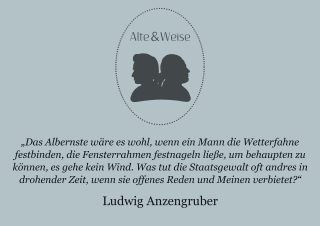

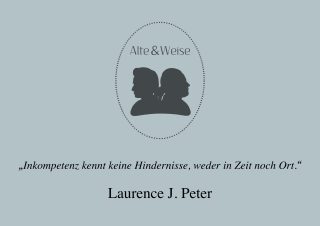

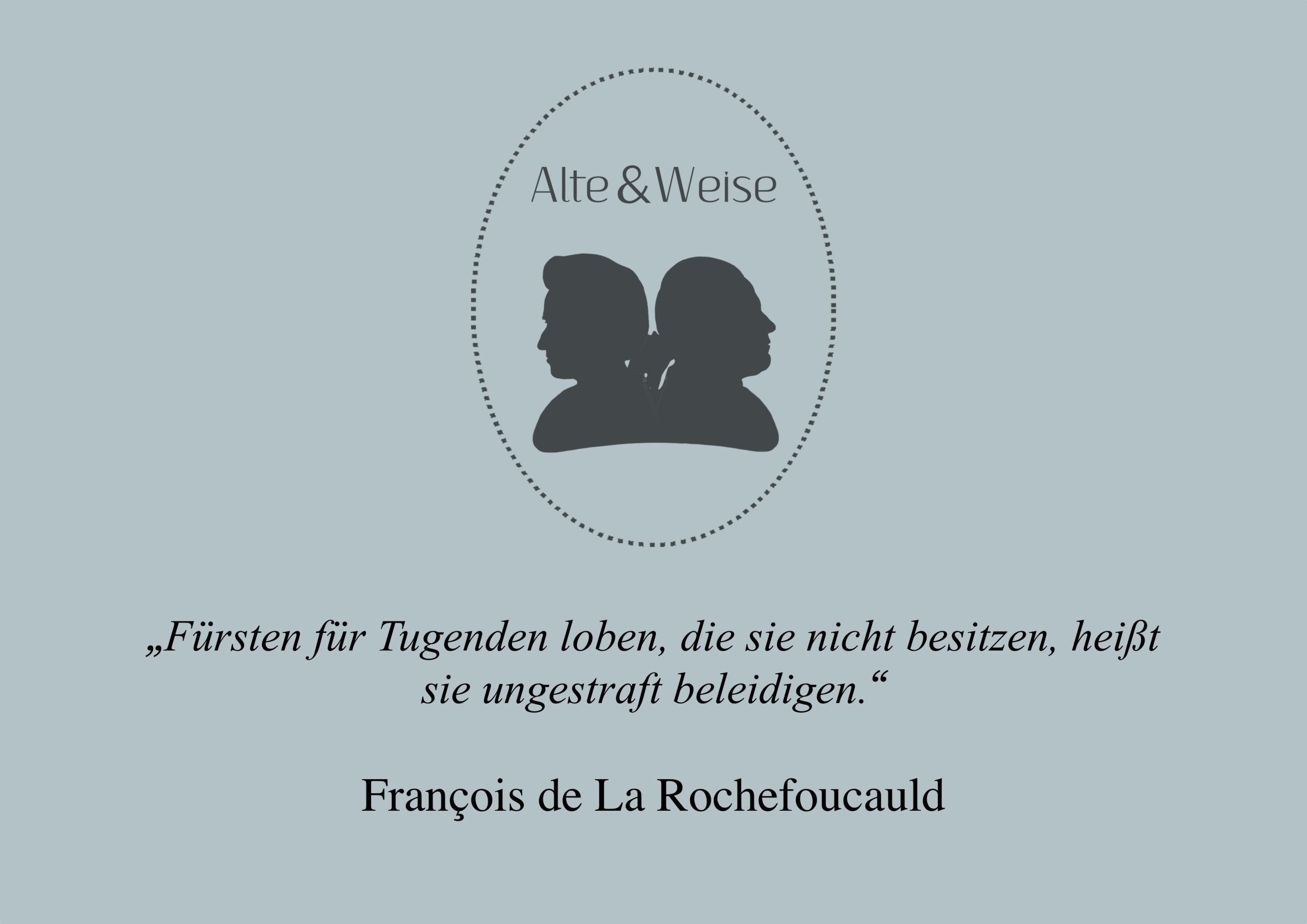
Andreas Rochow
14.06.2025Widerwillig werde ich bei Erwähnung der Kamarilla, die von Washington aus die ganze Welt über die mentale Gesundheit des Präsidenten der USA zum Narren hielt, an den deutschen medialen „Botschafter vor dem Zaun“ erinnert: Elmar Thevessen pries die Fitness des im Wahlkampf gescheiterten Patienten noch in den höchsten Tönen, als es schon fünf nach zwölf war! Unkritisch und fakeverliebt, wie ein Kundschafter des Apparates – „Regime“ geht ja nicht mehr! – zu sein hat, legte er auf den Bullshit der „Kamarilla“ noch eines oben drauf, auf dass sein Auftraggeber, das ö.-r. Himmler-TV, ihm keinen Rückfall in den kritischen Journalismus vorwerfe! Der nächste Fernsehpreis dürfte ihm sicher sein … verliehen von einer völlig schwerelosen, faktenbefreiten Kamarilla im Epizentrum von EU-ropa.
irgendwer
15.06.2025Der (damals noch) Twitter-Account von James Woods war derart voll von Aussetzern Bidens im Wahlkampf, dass Bidens Ausspruch bei dem Passieren einer Wache „Salut the marines“, statt schlicht zu salutieren, bereits eine Steuerung per „Knopf im Ohr“ plausibel erscheinen ließ.
Und es spielten nicht nur die weltweiten Verbündeten mit, auch die Widersacher. Gerade die Bilder eines recht amüsierten Herrn Putin sind mir noch präsent.
Es würde mich nicht wundern, wenn Trump es deswegen gerade so eilig hat, seine Wahlversprechen umzusetzen, um im Jahr vor den Midterms einem Untersuchungsausschuss viel Zeit einzuräumen und als Höhepunkt des Wahlkampfs Bidens Begnadigungen aufzuheben bzw. aufheben zu lassen…
Werner Bläser
16.06.2025Hm, ich weiss nicht. Ist der Fall Biden wirklich so etwas Besonderes? Er ist vielleicht nur der extremste; aber Politiker, die offensichtlich ihre Gedanken nicht ganz beisammen haben, scheinen mir keine Ausnahme zu sein. Nicht aufgrund von Demenz, sondern qua Geburtsfehler. Wenn ich so die Ampelminister vor meinem geistigen Auge Revue passieren lasse… Biden hätte z.B. wahrscheinlich noch erklären können, was eine Insolvenz ist.