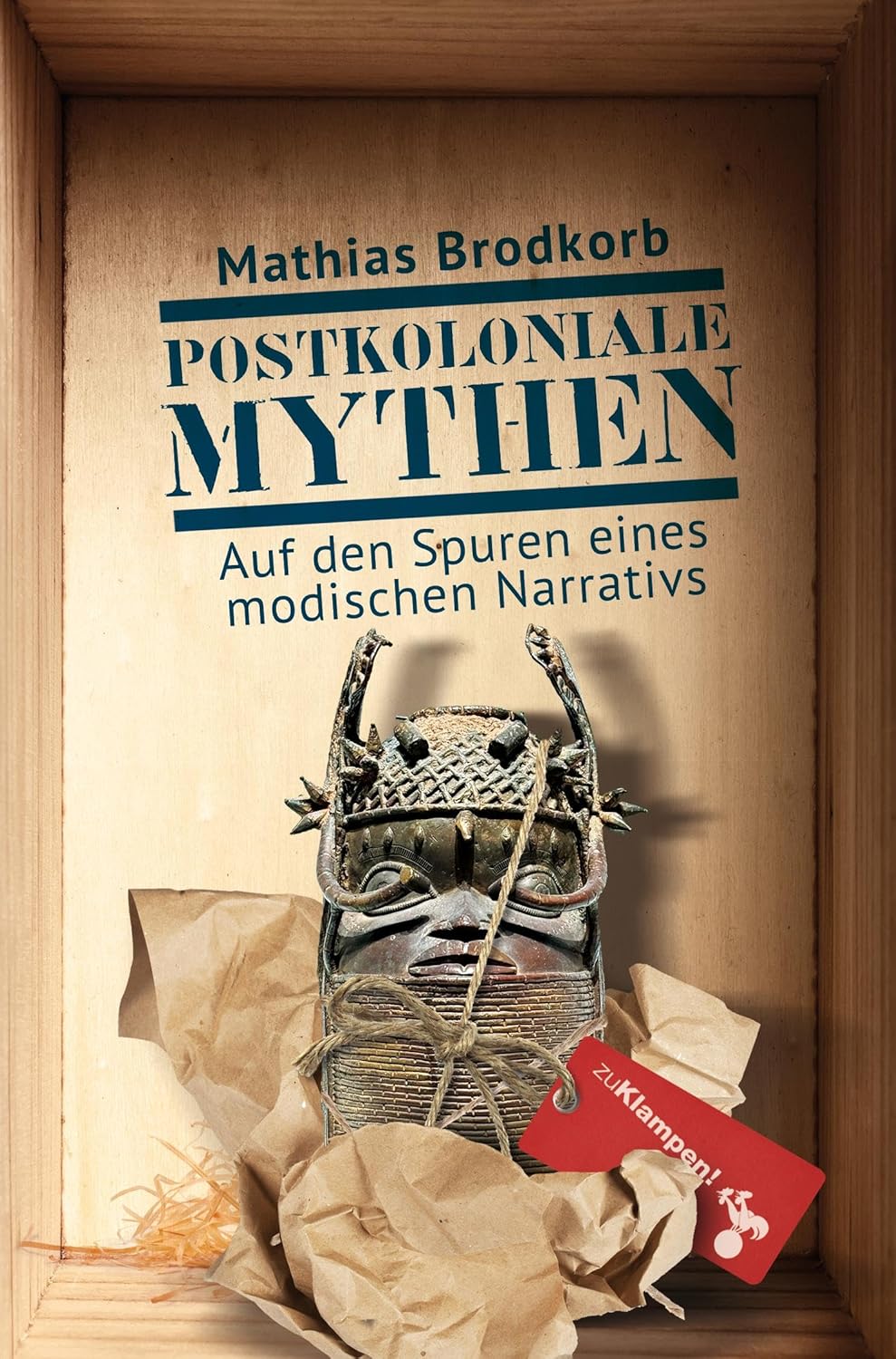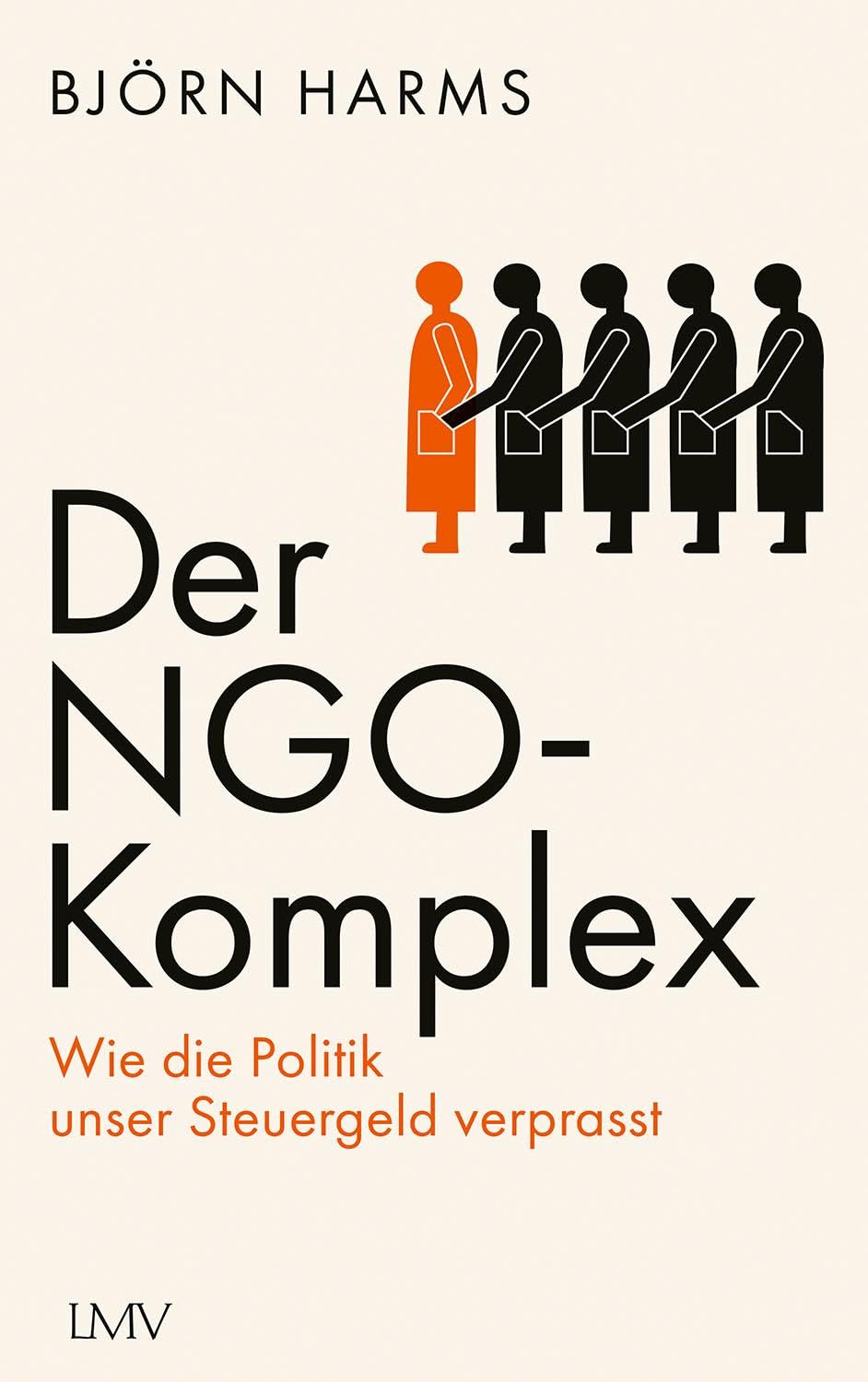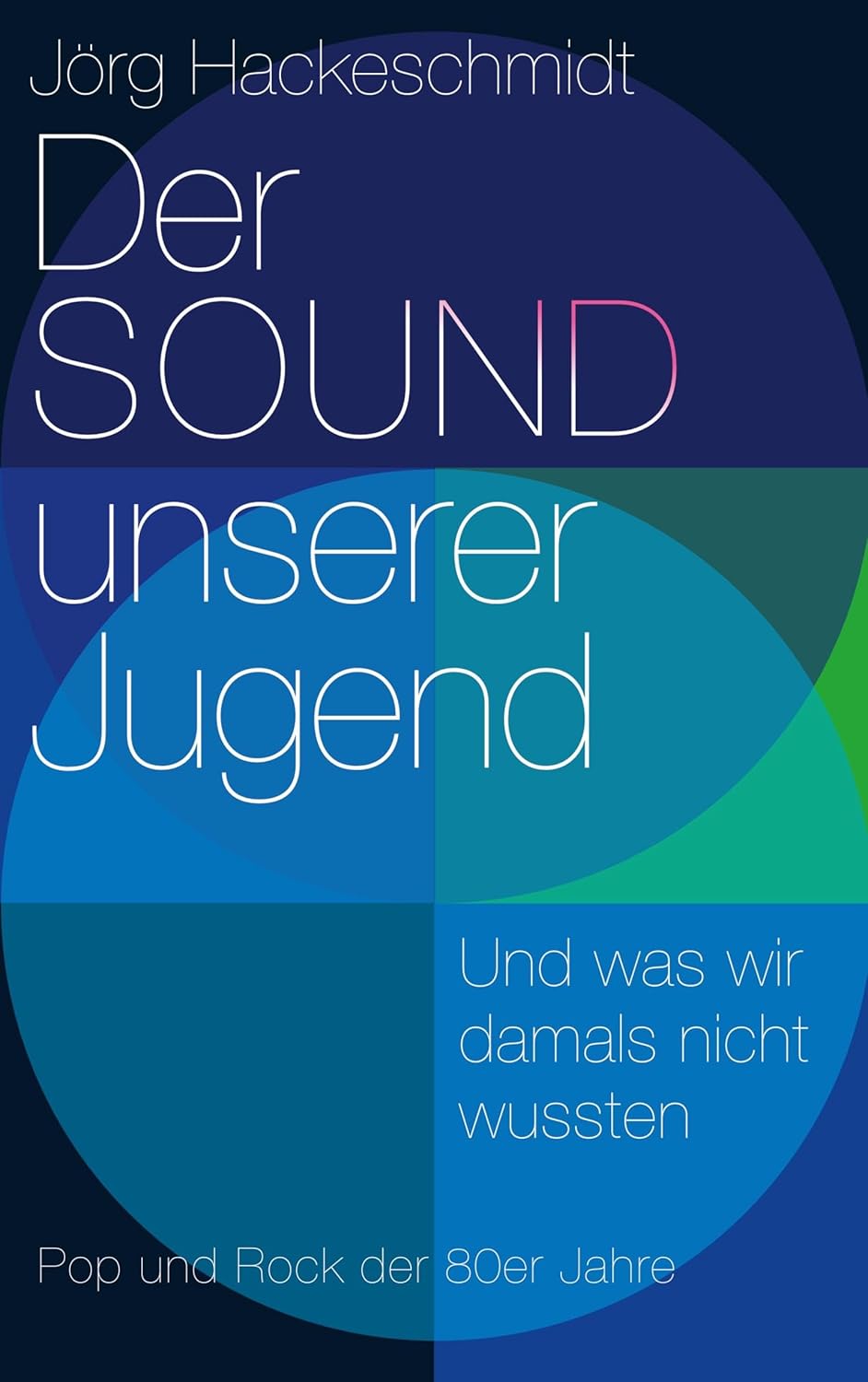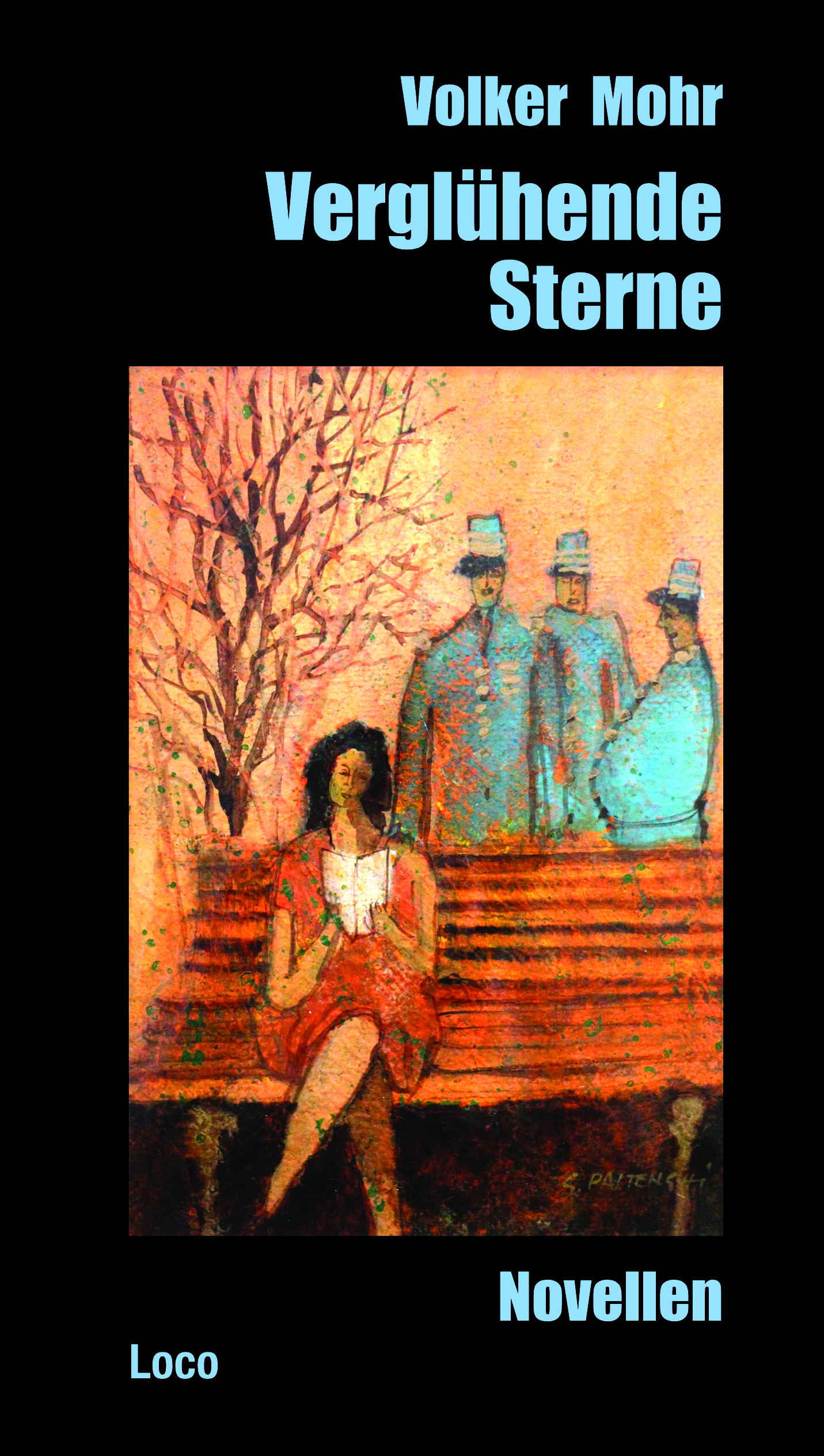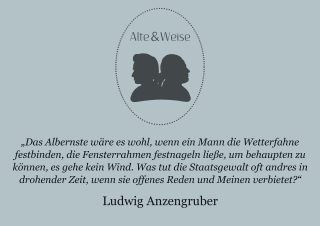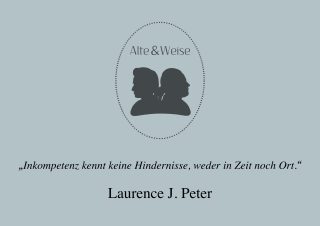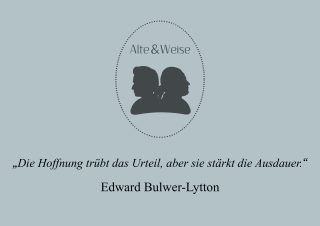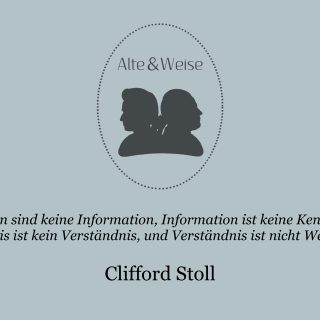Jürgen Schmid, Alexander Wendt und Günter Scholdt stellen Neuerscheinungen des Herbstes vor
Wenn Umerzieher die Fenster zur Welt vermauern
In „Postkoloniale Mythen“ legt sich Mathias Brodkorb mit Ideologen an, die ethnologische Museen zu Indoktrinationsanstalten umbauen
Von Jürgen Schmid
Das neue Buch von Mathias Brodkorb ist bei einem ersten Blick auf den Titel und den Untersuchungsgegenstand eine Überraschung: Wer hätte gedacht, dass der ehemalige SPD-Landesminister und nunmehrige Cicero-Publizist nach seinem fulminanten Stich in die Herzkammer von „Unseredemokratie“ – dem politisch instrumentalisierten Verfassungsschutz, dessen Abschaffung er fordert – als nächstes eine ausgewachsene Studie über ein Thema schreiben würde, das zunächst denkbar abseitig und politisch irrelevant erscheint: die Ausstellungspraxis von Völkerkundemuseen? Doch die Lektüre lässt schon nach wenigen Seiten keine Zweifel darüber aufkommen, dass sich Brodkorb nach seinem Plädoyer gegen die Gedanken- und Gesinnungskontrolle erneut mit einem wirkmächtigen Zeitgeistphänomen befasst, das bisher in Deutschland noch niemand umfassend kritisierte: die zu Umerziehungszwecken eingesetzte Ideologie des Postkolonialismus.
Quintessenz des postkolonialen Lehrgebäudes ist es, die Menschheit zu unterteilen in Opfer- und Tätergruppen, und das jeweils monochrom: Weiße sind immer Täter, nie Opfer; Schwarze stets Opfer weißer Gewalt, als Täter scheiden sie in dieser Doktrin a priori aus. Wie diese höchst windschiefe Doktrin die Völkerkundemuseen erobert und „ungenießbar“ (Leipziger Zeitung) gemacht hat, warum sie – über Ausstellungen zu fremden Völkern und deren Kulturen weit hinaus – politische Sprengkraft entwickelt, mit welchem ideologischen Hintergrund und mit welch vehement gesellschaftsgestalterischem Anspruch sie dies tut, diese Geschichte erzählt Brodkorb in seinem akribisch recherchierten, keineswegs pauschal urteilenden, sondern abwägend formulierenden, ausgezeichnet illustrierten Text.
Das Ergebnis seiner Reise durch Völkerkundemuseen des deutschsprachigen Raums, die sich verwirrenderweise MARKK (Hamburg; im kleingedruckten Untertitel: „Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt“), Ethnologisches Museum im Humboldt-Forum (Berlin), GRASSI (Museum für Völkerkunde zu Leipzig) und Weltmuseum (Wien) nennen, fasst er in zwei lakonischen Sätzen zusammen: „Ethnologische Museen waren einmal Fenster in die weite Welt. Heute blicken sie mit postkolonialem Anspruch stattdessen auf sich selbst“.
Die Geschichte einer Introspektion
Als deutsche Völkerkundemuseen ausnahmslos und wiedererkennbar auf den Namen „Völkerkundemuseum“ hörten (und sich noch nicht in buntem Namenswirrwarr verirrt hatten), antwortete ein dort tätiger Kurator auf die Frage, welches Anliegen er mit seinen Ausstellungen verfolge: Er wolle die Schönheit der Welt in ihrer Vielfalt präsentieren – im konkreten Fall indianischen Federschmuck.
In der Jetztzeit ist von diesem Anspruch nicht mehr viel übriggeblieben: Die Museen agieren weniger als Hüter von Schätzen, deren Schönheit und Bedeutung sie dem Publikum in angemessener Form präsentieren wollen. Brodkorb zeichnet das wenig schmeichelhafte Porträt von Vertretern eines postmodernen Museumsbetriebs, die sich kaum noch für den Eigenwert der gesammelten und präsentierten Objekte interessieren, dafür umso mehr für deren Verwertbarkeit zur Durchsetzung metapolitischer Agenden wie Gendertheorie, Antirassismus oder eben Postkolonialismus. Die Protagonisten dieses Betriebs wollen dem Publikum weniger etwas zeigen und erklären, als ihre Besucher im Sinn einer antiwestlichen Lehre umerziehen.
Dazu bedarf es der Kennzeichnung möglichst vieler musealer Sammlungsobjekte als materielle Sinnbilder kolonialen Unrechts. Man informiert das Publikum nicht mehr in erster Linie über den künstlerischen Wert von Objekten, über ihre Funktion in Alltag und Religion der Menschen, die die Dinge herstellten und benutzten, sondern belehrt zuvorderst darüber, dass vieles (wenn nicht das meiste oder gar alles) im Sammlungsbestand deutscher Völkerkundemuseen unrechtmäßig erworben worden sei, kurz: dass man als Museum eigentlich kein Recht habe, es zu besitzen und auszustellen. Und dass der Besucher kein Recht habe, es weiterhin zu sehen; noch kürzer: dass man mit diesen Sammlungsobjekten nur eines tun dürfe – die Besitzansprüche an ihnen aufgeben und sie in Form einer „wiedergutmachenden“ Rückgabe zurückerstatten, an wen auch immer.
Gezielte Suche nach Blut
Wie dabei selektiv vorgegangen wird und nur das in Betracht gezogen, mit dem man die unverantwortlich handelnden Vorgänger im Museumsamt der unrechtmäßigen Handlung bezichtigen kann, beleuchtet Brodkorb an vielen Beispielen, die für den Umbau der ethnologischen Museen in Erziehungsanstalten stehen. Aus der Fülle der Fallbeispiele, die zum angeblich geraubten Königsthron aus Kamerun und zum faustgroßen Stein vom Gipfel des Kilimandscharo – beides von Brodkorb detailliert rekonstruiert – hinzukommen, seien hier lediglich zwei weitere besonders signifikante genannt:
In Berlin etwa beschäftigte man sich im „Humboldt Lab Tanzania“ nicht generell mit Objekten aus der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika, sondern ausdrücklich nur mit solchen, „die einem gewaltsamen Erwerbskontext aus Kriegszusammenhängen entstammen“ – gerade so, als wolle man den Eindruck erwecken, es gäbe keine anderen Objekte in den Ausstellungsräumen und Magazinen als solche, „an denen Blut klebt“. So jedenfalls hatte es die französische Ethnologin Bénédicte Savoy als Sprachregelung und Forschungsauftrag vorgegeben, als sie das Humboldt Forum aus Protest gegen zu wenig Political Correctness verließ: „Ich will wissen, wie viel Blut von einem Kunstwerk tropft“.
Ein größeres Verbundprojekt fragt ebenso gezielt nach „Spuren des ‚Boxerkrieges’ in deutschen Museumssammlungen“. Wenn man dem Publikum lange genug nahezu ausschließlich Informationen zu Objekten zukommen lässt, die „aus Plünderungen“ stammen und damit als „Plünderware“ eine „problematische Herkunft“ aufweisen, dann wird das Publikum – so wohl das Kalkül – irgendwann vergessen, dass es auch unproblematische Erwerbsgeschichten musealer Sammlungsobjekte gibt, und zwar in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle.
Eine moralisch gegebenenfalls fragwürdige Erwerbsgeschichte von Sammlungsobjekten wird von den Ideologen des Postkolonialismus nicht mit Erschrecken konstatiert, wo sie tatsächlich auftritt, vielmehr lechzen viele postkolonial infizierte Ethnologen und ihr publizistisches Umfeld geradezu danach, so viel wie möglich davon aufzustöbern, auch dort, wo es nicht existiert: Das Wiener Weltmuseum porträtiert Brodkorb als Paradebeispiel dafür, dass es dem postkolonialen Milieu vorrangig um Opfersuche geht – was eine Täterbezichtigung selbst dort nötig macht, wo es gar keine Tat gibt. Denn die Habsburgermonarchie war nie Kolonialmacht. Den gewünschten Täter aber bekommt man so: Man behauptet, bereits das Erforschen einer fremden Kultur durch Kulturfremde (hier: Weiße) bedeute strukturelle Gewalt. Brodkorb schildert diese hirnverwundene Praxis, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass man mit solchen Sprachmanipulationen nahezu jeder Begrifflichkeit (hier: Gewalt) den Sinngehalt und alle Substanz rauben kann.
Der Autor listet mehrere Fälle auf, in denen selbst dort, wo die Provenienzforschung für ein Objekt nachgewiesen hat, dass es als Geschenk (besagter Königsthron) oder durch rechtmäßigen Erwerb an ein deutsches Museum gelangte, die postkoloniale Doktrin dekretiert: In kolonialen Abhängigkeitsverhältnissen könne es kein Geschenk eines Kolonialisierten an einen Weißen geben, dessen Gabe auf Freiwilligkeit bestehe, auch keine Kaufgeschäfte, die nicht unter illegitimem Druck zustande kämen, so dass letztlich alle Beziehungen von Weißen zu Schwarzen als latente Gewaltanwendung zu werten seien. Diese pauschalisierende Überzeichnung der postkolonialen Doktrin an teils hanebüchenen Beispielen herausgearbeitet zu haben, ohne selbst zu pauschalen Urteilen oder gar Rechtfertigungen jedweder kolonialen Handlung zu greifen, diese Fairness im Umgang mit seinem Thema macht wohl den wichtigsten Teil von Brodkorbs Analyse aus.
Ein flächiges Symptom, keine Einzelfälle
Mathias Brodkorb hätte auf seiner Erkundungstour auch das „Museum Fünf Kontinente“ in München, das Stuttgarter Linden-Museum oder nahezu jedes andere Museum durchleuchten können – alle teilen die gleiche Ideologie. Selbst renommierte Kunstausstellungen wie die Biennale in Venedig sind vom modischen Narrativ Postkolonialismus gekapert worden, was Brodkorb in einem eigenen Kapitel darstellt, worin unter anderem wieder einmal deutlich wird, wie sehr die künstlerische Potenz unter dem selbstauferlegten Druck der Kunstschaffenden, stets das current thing des Zeitgeistes in ihren Werken thematisieren zu wollen, unter die Räder kommt.
So zum Beispiel München, wo eine erst kürzlich zu Ende gegangene Sonderausstellung über den „Kolonialismus in den Dingen“ suggerierte, Museumsobjekte seien hauptsächlich unter den Vorzeichen von „Gewalt“ und „Rassismus“ ins Museum gekommen, stets verbunden mit dem „Versuch, die Kulturen der Kolonisierten zu verdrängen“. Letztere Behauptung erscheint richtiggehend tolldreist, wenn man früheren Museumsethnologen vorwirft, sie hätten gerade durch das Sammeln und Bewahren, das Erforschen und Vermitteln von Kulturgütern die Kulturen, aus denen diese von ihnen derart wertgeschätzten Objekte stammen, verdrängen wollen.
Zum Beispiel Stuttgart, wo eine neuere Afrika-Ausstellung „ausschließlich auf die aktuellen Debatten zum Kolonialismus reagiert“ und deshalb „in diesem Diskurs verfangen“ bleibe, wie die Stuttgarter Nachrichten bedauern – eine Selbstbespiegelung, worüber die Ausstellungsmacher die Interessen des Publikums vergessen haben.
Inzwischen ist die Garde jener Ethnologen, die sich mitunter auch noch Völkerkundler nannten, weitgehend abgetreten, welche mit Freude fremde Kulturen erforschten und diese Freude in Publikationen und Ausstellungen an ein breiteres Publikum weitergeben wollten. Darunter zählen nahezu alle der vom Bochumer Ethnologen Dieter Haller für sein Projekt German Anthropology interviewten Zunftgenossen, etwa Jürgen Jensen, Ulla Johansen, Erhard Schlesier oder Wolfgang Haberland, aber auch Werner Müller und ganz besonders der letzte Neo-Romantiker Hans Peter Duerr, ein sehr früher Kritiker jener Political Correctness, deren Museum gewordene Spielart Brodkorb so gekonnt seziert. Diese ältere Generation stieß in Deutschland das Tor zur Welt weit auf und vermittelte die Faszination fremder Kulturen um deren selbst willen. Ihre jüngeren Nachfolger arbeiten sich mit großer Verbissenheit und oft nur notdürftig mit dem Deckmantel vorgeblich wissenschaftlicher Forschung kaschiert an ihrer politischen Agenda ab, wozu sie die fremden Kulturen und ihre musealen Zeugnisse benutzen, ohne sie für sich stehen und sprechen zu lassen. Sie bieten eine Schau eigener Befindlichkeiten, und verschließen damit das Fenster zur Welt.
Aufblitzen von Vernunft – kurz
Vor einigen Jahren meldete sich das Münchner Museum tatsächlich als Stimme der Vernunft: Die Museumsethnologin Karin Guggeis beklagte im Museumsjahrbuch 2019, wie sich „in den Medien ein Kanon [formierte], der ethnologische Museen auf die Formel ‚koloniale Sammlungen = Raubkunst = gebt sie endlich zurück, sie gehören nicht hierher’ reduzierte.“ – „Raub“ impliziere dabei „pauschal einen unrechtmäßigen Erwerbungskontext“; „Kunst“ suggeriere „immense finanzielle Werte dieser Kulturgüter“. (Dass akademische Ethnologen die Medien dazu angeregt hatten, den Raubkunst-Kanon zu verbreiten, verschwieg Guggeis dezent.) Am Beispiel einer altüberlieferten Münchner Sammlung aus Kamerun konnte sie belegen, dass ihr größter Teil weder geraubt noch wertvoll ist: Es handelt sich um Auftragsarbeiten für europäische Sammler; schon ein Kurator der Erwerbszeit notierte: „Vieles sieht aus wie auf Bestellung gefertigt“.
Was die Provenienzforscherin offen zugab: Man hat nicht irgendeine Sammlung für das Herkunftsforschungsprojekt ausgewählt, sondern gezielt eine, auf der ein „Verdachtsmoment“ lag – jener, dass der Sammler Max von Stetten, Führer der Polizeitruppe, später Kommandeur der Schutztruppe in Kamerun war. So konnte man dem Grusel nachspüren, „dass die Sammlung Bestände mit einem gewalttätigen Erwerbskontext enthält“. Guggeis Fazit: Für viele Objekte habe sich der Verdacht „nicht erhärtet, sondern wurde ins Gegenteil gewendet“.
Geht nun das Museum Fünf Kontinente nach dieser Erkenntnis etwas behutsamer mit „Verdachtsmomenten“ um? Im Gegenteil: Es besteht in seiner jüngsten Sonderausstellung dezidiert auf dem Vorzeichen von „Gewalt“, unter dem seine Objekte erworben wären (siehe oben); der Katalog macht aus Bayern einen „Schauplatz der Kolonialgeschichte“. Man beteiligt sich am Projekt, „Plünderware“ aus den Boxerkriegen in den Museumsdepots aufzuspüren (siehe oben). Und was thematisiert die hauseigene Vortragsreihe 2025? „Raub und Rückgabe von Kulturgut“, „koloniale Raubkunst“, schließlich wie ein Fazit: „Restitution und mehr“. (Karin Guggeis, wiewohl weiterhin Museumsmitarbeiterin, war an all diesen Projekten übrigens nicht mehr beteiligt.)
Netzwerke
Natürlich hat die polit-aktivistische jüngere Generation von Ethnologen, die heute das Wohl und Wehe deutscher Völkerkundemuseen bestimmt, den Postkolonialismus und seine Anwendbarkeit für linke Volkserziehungskonzepte nicht erfunden. Man fügt sich vielmehr ein in ein längst flächendeckend etabliertes Netzwerk von Aktivistengruppen, die sogenannte Decolonize-Projekte initiiert haben, etwa in Göttingen, wo ein sich selbst autorisiert habendes „Stadtlabor“ „Wege zur kolonialkritischen Stadt“ vorbereitet; in Freiburg im Breisgau, wo das Afrika-Zentrum für Transregionale Forschung davon überzeugt ist, dass „die Wissensproduktion an Universitäten bis heute kolonial geprägt“ sei und deshalb in einem Projekt „Decolonize Universities“ „bei Ansätzen zur Dekolonisierung von Wissensproduktion mitwirken“ will; in München, wo man unter dem betörenden Titel „Spuren Blicke Stören“ gar nicht erst fragt, ob sich der „Kolonialismus in das Münchner Stadtbild eingeschrieben“ hat, sondern nur: wie. In der Isarmetropole heißt es jedenfalls wie aller Orten: dekolonisieren. In ganz großem Stil propagiert das erwartungsgemäß die Bundeshauptstadt, wo Postkolonialisten als eingetragener Verein „für eine gesamtgesellschaftliche Dekolonisierung“ streiten.
Mit immerwährender Aufarbeitung von kolonialem Unrecht (das im Falle Deutschlands inzwischen weit über hundert Jahre zurückliegt) aber nicht genug: Dieselben Protagonisten und Gruppen werden auch auffällig mit Antirassismus-Kampagnen, Initiativen wie „Sichere Häfen“ für Geflüchtete (vulgo: Migranten) in unseren Städten, „Wir haben Platz“- und „No-Nation-No-Border“-Aktivismus, kurz: Sie sind unterwegs als Wiedergutmachungswillkommenskulturverkünder, wozu die Antikolonialismus-Kampagnen die historische Begründung liefern sollen. So hängen alle diese Ideologeme inhaltlich miteinander zusammen, wie sie auch von derselben Aktivistenklientel bedient werden, was eine Art Kreislaufwirtschaft bildet.
Das Eintreten für ehemals Kolonisierte ist die neueste Etappe bei der Vergabe eines „wandernden Opferstatus“, für den linke Parteien und NGOs immer neue „marginalisierte“ Gruppen entdecken, um diese ökonomisch, politisch, parteitaktisch, moralisch bewirtschaften zu können. Deutsche Arbeiter sind seit langem schon nicht mehr darunter. Ein Musterbeispiel sind Pläne der rot-grünen Dortmunder Stadtregierung, neben einem „Heimathafen“ als zentraler Anlaufstelle für „Neubürger“ ein „dekoloniales Denkmal“ zu errichten; zudem in Planung: ein „Gastarbeiterdenkmal“.
Umdenken im Mainstream?
Es ist das große Verdienst von Mathias Brodkorb, mit seiner Streitschrift – eine solche sind die „Postkolonialen Mythen“ und wollen es dezidiert auch sein – sogar den Mainstream aufgerüttelt zu haben. Wer anders als ein Publizist seines Formats und Standortes hätte erreichen können, dass die FAZ eine Besprechung bringt, deren Titel von einer „Schuldlust der Europäer“ spricht? Oder gar, dass selbst der grün-moralisch eingefärbte Deutschlandfunk das ansonsten als rechtslastig beklagte Wort von der „Schuldlust“ zustimmend verwendet, indem die dortige Rezension Brodkorbs Diagnose als „Lustvolle Suche nach Schuld“ beschreibt?
Noch vor nicht allzu langer Zeit, als die grüne Außenministerin zusammen mit der grünen Kulturstaatsministerin die Rückgabe der Benin-Bronzen (dies ebenfalls von Brodkorb kontextualisiert und entmystifiziert) als Wiedergutmachungsglanzleistung zelebrierte, wo Deutschland – in Nigeria niemals Kolonialmacht – gar keine Schuld auf sich hatte laden können, applaudierte der gesamte Mainstream artig dieser Geschichtsklitterung; ein kritisches Hinterfragen des regierungsamtlichen Narrativs fand nicht statt.
Wenn die Leipziger Zeitung in ihrer Brodkorb-Rezension die Klärung der Frage verspricht, „Warum moralische Belehrung die Völkerkundemuseen heute so ungenießbar macht“, dann ist solch eine Schlagzeile das pure Gegenteil einer journalistischen Propaganda, die von SZ über Zeit und FAZ bis taz jahrelang die Ungenießbarmachung wohlwollend kommentierend begleitet, wenn nicht gar publizistisch aktiv gefördert hat: „Verfluchte Schätze“ würden deutsche Völkerkundemuseen hüten, eine Nummer weniger reißerisch konnte es der Tagesspiegel in seinem Aufklärungsfeldzug gegen „Koloniale Beutekunst“ nicht machen.
Mehr Aufklärungsarbeit im Stile von Brodkorbs augenöffnender Reportage erscheint dringend nötig, um einer lauten und medial immer noch äußerst durchsetzungsstarken Minderheit das Indoktrinieren breiter Massen der Bevölkerung nicht unwidersprochen durchgehen zu lassen, zumal die Aktivisten von ihrem Moralbewirtschaftungsmonopol sehr einträglich leben, solange die staatlichen Geldhähne für sie weit aufgedreht bleiben.
Denn die postkolonialen Agenten, die sich der Völkerkundemuseen bemächtigt haben, können die fortschreitende Ungenießbarmachung dieser Institutionen nur betreiben, weil ihr ideologisches Unternehmen mit öffentlichen Geldern großzügig und großflächig finanziert wird. Um es in einem eingängigen Bild zu sagen: Weniger die Bewahrung von in öffentlichem Besitz befindlichem Kulturgut wird mit öffentlichen Finanzmitteln in den Völkerkundemuseen betrieben, sondern dessen Ausverkauf durch immer ausuferndere Rückgabeaktionen. Hier darf die Frage gestellt werden, ob damit vom Bürger erhobene Steuergelder sinnvoll eingesetzt werden. Ohnehin wirkt es absurd, dass Museumskuratoren ihre Bestände absichtsvoll schlechtreden und damit entwerten.
Der Zeitgeist kann sich auch wieder wandeln, auch unter dem Druck exzellenter Recherchen wie der von Brodkorb. Möglicherweise kommt dann wieder eine Zeit, in der eine neue Generation von Kuratoren in den deutschen Völkerkundemuseen den Umerziehungskampf beendet, und sich wieder der eigentlichen Aufgabe dieser Häuser zuwendet: der Freude an der Vermittlung fremder Kulturen und deren Geschichte.
Mathias Brodkorb, „Postkoloniale Mythen. Auf den Spuren eines modischen Narrativs“, zu Klampen, Springe 2025, 272 Seiten, 28 Euro
Wie linke Kulturkämpfer den Staat kapern
Björn Harms liefert in „Der NGO-Komplex“ ein Dossier über steuerfinanzierte Organisationen, die sich „Zivilgesellschaft“ nennen
Von Jürgen Schmid
Während Mathias Brodkorb den Scheinwerfer auf ein spezielles Kampffeld lenkt, leuchtet ein anderer Publizist im Breitbandkinoformat den Abgrund des NGO-Staates aus. Wer wissen will, wie das Land in die gegenwärtige Schieflage gekommen ist (und wer es in weiten Teilen beherrscht), der sollte zu beiden Büchern greifen.
Denn die Gründe für diesen bedauernswerten Zustand haben nun gerade nicht die sich selbst so nennenden Leitmedien beschrieben, sondern die alternativen neuen Medien. Zu dieser Sphäre gehört der Journalist Björn Harms, lange bei der Jungen Freiheit, nun bei Nius. Er legt eine Art Kompendium vor, wer wie und warum den Staat gekapert hat. Das Buch liest sich in seiner umfassenden Bestandsaufnahme wie eine Dystopie, und müsste für die neugewählte Regierung, besonders für die Kanzlerpartei CDU samt der bayerischen CSU, ein Handlungsauftrag zur Rückabwicklung dieses undemokratischen Komplexes sein.
Der Untertitel „Wie die Politik unser Steuergeld verprasst“ trifft auf den Staat im Staate, den die sogenannten Nicht-Regierungs-Organisationen inzwischen bilden, durchaus zu, stellt aber nicht das zentrale Problem dieses weitverzweigten Netzwerkes dar. Viel schlimmer noch als Geldverschwendung ist das ungedeihliche Wirken, das durchwegs links-aktivistisch, spalterisch und destruktiv genannt werden muss.
Während Brodkorbs Postkolonialismuskritik im Mainstream mitunter sogar zustimmend rezipiert wird, hüllt sich das qualitätsmediale Agendasetting-Gewerbe beim NGO-Komplex in nahezu totales Schweigen, ein Interview mit dem Autor in der Berliner Zeitung ausgenommen, dessen Titelzitat die Antwort auf das vielsagende Ignorieren ist: „Das linke Lager hat Angst, dass ihnen jemand ans Leder will.“ Dabei handelt es sich bei dem „NGO-Komplex“ um einen Publikumserfolg, dessen Listung in der Spiegel-Bestsellerliste prompt einen prominenten Vertreter derjenigen auf den Plan rief, deren Machenschaften Harms durchleuchtet: Die Amadeu Antonio Stiftung. Deren Geschäftsführer Timo Reinfrank verhält sich wie ein ertappter Straßenräuber, der „Haltet den Dieb!“ schreit, wenn er allen Ernstes behauptet, Harms greife mit seiner Kritik an den undemokratischen Strukturen des NGO-Netzwerks „das Rückgrat der Demokratie“ an. Dieses Rückgrat besteht für die Amadeu Antonio Stiftung aus der Amadeu Antonio Stiftung selbst, nebst gesinnungsähnlichen anderen NGOs. Wer sich so versündigt wie Harms ist in deren Augen natürlich: „rechtsextrem“. Wie originell.
Inhaltlich besprochen haben den „NGO-Komplex“ nur die alternativen Medien, denen Autor Harms entstammt und angehört – und diese werden neuerdings in einigen Städten wie Eltville oder Rüdesheim vom dortigen öffentlichen WLAN als unerwünschte „rechte Medien“ blockiert. Betroffen sind etwa Nius, Achgut, die Junge Freiheit und Tichys Einblick. Man sieht: Der Komplex tut viel dafür, um zu verhindern, dass der Bürger sich ungehindert eine von der Selbstdarstellung des Komplexes unabhängige und womöglich abweichende Meinung bilden kann. Eine Vertreterin der Amadeu Antonio Stiftung beriet kürzlich die Linkspartei in Berlin-Treptow, wie es gelingen könnte, die Redaktion des jungen libertär-konservativen Mediums Apollo News aus dem Stadtteil zu vertreiben – und zwar gewaltsam. Denn die Parole einer entsprechenden Parteibroschüre lautet: „Rechten Medien auf die Tasten treten“.
All dies geschieht im Namen einer „Zivilgesellschaft“, zu der sich auch eine staatlich durchfinanzierte Pressure-Group wie die erwähnte Amadeu Antonio Stiftung rechnet. Denn der Name ist ein Etikettenschwindel, wie Harms darlegt – es handelt sich um „linke Lobbygruppen“, die „eine Art zweiten öffentlichen Dienst gebildet“ haben und „direkt von den Futtertrögen des Staates abhängen“.
Das konsequent-sympathische Fazit von Harms: Er fordert nicht etwa, dass auch konservative Anliegen durch entsprechende Lobbygruppen staatlich gefördert werden, sondern die Trockenlegung des Sumpfes. Und ebenso schwebt Mathias Brodkorb in seiner Postkolonialismuskritik nicht ein ihm mehr zusagendes Narrativ über den Kolonialismus vor, sondern statt immer neuer ideologisch instrumentalisierter Geschichtspolitik eine Rückkehr zum Erzählen über die Vergangenheit, wie es die Quellen gebieten, wenn man ihnen keine Gewalt antut.
Kein Kulturkampf, sondern dessen Beschreibung
Grundsätzlich muss der Vorwurf, diejenigen zettelten einen Kulturkampf an, die den in Harms’ „NGO-Komplex“ porträtierten grünlinkswoken Kulturkämpfern die Stirn bieten, vom Kopf wieder auf die Füße gestellt werden. Denn ausgerechnet ein Milieu, das wenig anderes aufzuweisen hat als Kulturkampf, beklagt sich neuerdings, dass seine Kritiker quasi aus dem Nichts einen Kulturkampf dadurch „anzetteln“ (Ferda Ataman) würden, indem sie gegen den grünlinkswoken Kulturkampf opponieren.
Die „Argumentation“ läuft wie folgt: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zettle einen Kulturkampf an, wenn sie die Regenbogenfahne nicht auf dem Reichstagsgebäude hisse. Das erstmalige Hissen dieser Fahne, wie es gegen jede staatspolitische Gepflogenheit kurze Zeit praktiziert wurde, war in dieser Lesart mitnichten eine Aktion von Kulturkämpfern, sondern wird dem Publikum so verkauft, als wäre das Wehen des Identifikationswimpels einer Minderheit auf dem Parlamentsgebäude eine jahrhundertelang gewachsene Tradition, an die Hand anzulegen einen Kulturkampf bedeute. Die Rücknahme einer kulturkämpferischen Intervention wird kontrafaktisch als Beginn eines gegen „die Demokratie“ gerichteten Kulturkampfes gewertet, während der Kulturkampf selbst als demokratisch einzig zulässige Willensäußerung gesehen werden soll.
Auf den konkreten Fall der beiden Bücher übertragen, um die es in diesen beiden Besprechungen geht: Nicht Brodkorb bricht einen Kulturkampf vom Zaun, sondern legt die Methoden postkolonialer Kulturkämpfer offen. Und auch Harms zettelt keinen Kulturkampf an, wenn er die Auswüchse des NGO-Komplexes dokumentiert – er beschreibt einen solchen.
Björn Harms, „Der NGO-Komplex. Wie die Politik unser Steuergeld verprasst.“ Langen Müller, München 2025, 288 Seiten, 22 Euro
Das Jahrzehnt der erwachsenen Stars
Jörg Hackeschmidt ruft den „Sound unserer Jugend“ zurück – in einer großartigen Rock- und Pop-Geschichte der Achtziger
Von Alexander Wendt
„Wer sich an die Achtziger erinnern kann, der hat sie nicht erlebt“, meinte Johann Hölzel, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Falco. Bei ihm, der seinen Produzenten Bolland & Bolland zufolge bis zu seinem Unfalltod 1998 nur ganz gelegentlich nüchterne Phasen einstreute, traf es vermutlich zu. Die meisten der damals Jugendlichen und Jüngeren überstanden das Jahrzehnt, zum Glück. Wer sich in diese Zeit zurückdenkt oder besser zurückfühlt, der denkt nicht zuerst an Politik, sondern an den Klang. Das Jahrzehnt bestand vor allem aus Musik. Aus ihr entstanden, zuerst bei Peter Gabriel und dann bei hunderten anderen, Videos. Die Musik verschmolz mit Filmen, sie bestimmte die Mode mit und handelte von Mode (über die Paninaros, die Jungs mit roten Daunenjacken und Blue Jeans auf Motorrollern vor den Panino-Läden in Italien, schrieben die Pet Shop Boys 1986 einen eigenes Popstück mit einem Text von konkreter Poesie: „Paninaro, Paninaro / oh, oh, oh / Armani, Armani, ah-ah-Armani Versace, cinque/ Paninaro, Paninaro, oh, oh, oh“).
Die Songs der eigenen Jugend verbinden sich mit Erfahrungen. Meist genügen schon die ersten Takte, um die Erinnerung wieder aufsteigen zu lassen: An die erste Liebe und den fast unvermeidlichen Liebeskummer, den ersten Sex, den ersten Ausflug ohne Eltern. Jörg Hackeschmidts „Der Sound unserer Jugend“ gehört zu den Büchern, bei deren Erscheinen man sich fragt, warum es sie nicht schon längst gibt. Der Autor, Jahrgang 1961, promovierter Historiker, ehemals Redenschreiber im Bundespräsidialamt und im Kanzleramt, heute freier Autor unter anderem für Publico, schreibt seine musikalische Biografie.
Sehr viele Leser der Sechziger-Geburtsjahrgänge dürften sich darin wiedererkennen. Denn die Musik teilte man sich, man erlebte sie meist zusammen, zu zweit, im Club, live. Und auch das, was daran hängt, die Stationen des Erwachsenwerdens. „Das alles: Musik als Ausdruck eines Lebensgefühls, als Tor zu den eigenen Emotionen, als unabsichtliches Therapeutikum; Textzeilen, die ins eigene Leben hinein- und aus den Erinnerungen herausragen wie die Präsidentenköpfe am Mount Rushmore, auf denen Cary Grant in Hitchcocks ‚North By Northwest‘ herumgekraxelt ist – das alles ist Thema dieses Buches“, heißt es programmatisch in der Einführung. Sein Untertitel lautet: „Und was wir damals nicht wussten.“ Hackeschmidt betreibt neben der Verfolgung des Soundtracks auch eine Art Rock- und Poparchäologie – er erzählt von den verborgenen Themen und Motiven vieler Songs, den Geschichten ihrer Entstehung und Verbreitung, die nicht immer, aber ab und zu zur größeren Zeitgeschichte gehören.
Die Schilderung setzt zwar in den späten Siebzigern ein, um den Kontrast zu dem neuen Jahrzehnt zu schärfen. Aber vorher erwähnt Hackeschmidt noch das Jahr 1985, für ihn der Höhepunkt der Popdekade, die, wie er schreibt, 1988 eigentlich schon wieder auslief. In diesem Jahr 1985 erschien nicht nur „Take on Me“ von a-ha, sondern eben auch – damals etwas völlig Neues – das Video dazu (das der Buchautor zu den zehn besten Videos aller Zeiten rechnet). Ein Jahr später veröffentlichte Peter Gabriel sein aufwendig gestaltetes Video zu „Sledgehammer“, produziert von dem Trickfilmstudio, das später mit den Knetfiguren Wallace & Gromit zu Weltruhm kam. Für die Generation Z, in der fast jeder mit Künstlicher Intelligenz und wenig Aufwand Videos basteln kann, wirkt es kaum noch verständlich, welche Neuerung die verfilmte Musik bedeutete. Als sie aufkam, fragte man andere auf einmal: „Hast du den neuen Song von XY schon gesehen?“ Die Songs verdoppelten sich gewissermaßen. „Musik war nicht mehr nur etwas, was man sich hörend erschloss“, schreibt Hackeschmidt, „Musik war jetzt gekoppelt an Bilder.“
Was unterschied die Achtziger, egal, ob im Post Punk, New Wave, Disco Pop, so sehr von der Gegenwart? Zweierlei: erstens ihre Leichtigkeit, obwohl es in dem Jahrzehnt genügend politische Krisen gab. Und zweitens die Erotik. Der Rezensent unterhielt sich einmal mit einem Vertreter der Generation Z über die Enterotisierung von Musik und Videos; er meinte, das sei doch Unsinn, man müsse sich doch nur einmal die Rapsongs anhören und die Videos ansehen, dort sei doch unentwegt vom Sexualakt die Rede (er verwendete ein anderes Wort). Ihm fiel überhaupt nicht auf, wie steril und geradezu aseptisch nahezu fast alle Rapper über das Penetrieren sprechsingen. Mit dem Begriff ‚Erotik‘ konnte er offensichtlich gar nichts anfangen.
„Der Sound unserer Jugend“ schildert, wie Debbie Harrys „Call Me“ für die lange Eingangssequenz von „American Gigolo“ zustande kam, mit einem „Songtext aus der Sicht eines männlichen Prostituierten“, gespielt von Richard Gere (und nicht von John Travolta, der eigentlich für die Hauptrolle vorgesehen war). Zu den Achtzigern gehört, auch – das beschreibt der Autor mit scharfem Blick – eine erwachsene Männlichkeit, wie sie Richard Gere verkörperte, Bryan Ferry und später Spandau Ballet. Stars traten selbstverständlich im Anzug auf wie Ferry und David Bowie – oder im Smoking wie Falco. Diese Art der Erotik hielt die Spannung, sie erzeugte in Texten und Videos Bilder, die sehr viel stärker wirkten als das explizite Aussprechen. Beispielsweise in Falcos „Junge Roemer“ (dessen Musik bekam Hackeschmidt in seiner Münchner Zeit früher mit als andere, Falco lief dort schon in den Clubs, bevor er in den Charts für ein Massenpublikum aufstieg). Das „Étienne“-Video von Guesch Patti, gedreht 1987, das vom weiblichen Begehren handelt, zu dem auch Unterwerfungsfantasien gehören, bekäme heute garantiert das Verdikt „Sexismus“ aufgedrückt, und Sender könnten sich gar nicht schnell genug davon distanzieren; David Bowies „China Girl“, ursprünglich von Iggy Pop 1977 komponiert, von Bowie 1983 auf Hochglanz poliert, würde 2025 unter „Rassismus“ fallen.
Darin liegt nicht der einzige, aber ein großer Wert von Hackeschmidts Geschichtsschreibung: Erst vor dieser Folie fällt dem Leser auf, wie stark die Mischung aus obsessivem Gerede über Sex bei gleichzeitiger Prüderie die Gegenwart beherrscht. In dem speziell für Jugendliche produzierten ARD/ZDF-Format „funk“ bleibt zwar keine Körperöffnung und -ausscheidung unerörtert, gleichzeitig warnt die woke „4b-Bewegung“ junge Frauen vor einer romantischen Beziehung mit einem Mann, vor Ehe und Familie erst recht. Ratgeber trichtern Pubertierenden, noch bevor sie überhaupt ihren eigenen Körper richtig entdecken können, die Botschaft ein, dass sie wahrscheinlich im falschen Körper stecken, während andere Tipps ihnen nahebringen, was sie alles schon beim ersten Date verkehrt machen können. Es kommt also nicht überraschend, dass laut der soziologischen Studie „Leben in der Schweiz“ zwei Drittel aller Männer und 40 Prozent aller Frauen zwischen 18 und 25 angeben, dass sie noch nie eine Beziehung hatten. In anderen westlichen Ländern sehen die Zahlen ähnlich aus. In der dauererregt-prüden Gegenwart entdeckte ein empörter Anklägerchor kürzlich auch – und zwar am Beispiel von „Rammstein“ – , dass sich Musiker nach dem Konzert nur selten mit einer Tasse Kamillentee in den Schlafsack zurückziehen. Nicht nur die Männer, überhaupt die Achtziger wirken im Vergleich zur Gegenwart erwachsener.
Den Großen wie Peter Gabriel und David Bowie (der sich von dem Siebziger-Bowie gründlich unterschied und mit „Let’s Dance“ 1983 seine Karriere noch einmal neu und anders begann) widmet Hackeschmidt längere Abschnitte, elegant und kenntnisreich, aber nicht so insiderisch, dass er nur den Fans etwas bietet, die eigentlich sowieso schon fast alles über ihre Stars wissen. Er erklärt aber auch, dass und warum ein Sänger weder Aura noch Perfektion braucht, damit wenigstens ein Lied von ihm für immer bleibt. „Hört man den Song heute an“, heißt es über Joachim Witt und seinen „Goldenen Reiter“, „fällt auf, dass er nicht wirklich gut produziert ist: die Stimme wirkt irgendwie weit weg und der Sound ist nicht zu vergleichen mit zeitgleich entstandenen Produktionen.“ Witt produzierte das Album damals selbst, weil keine Plattenfirma Interesse zeigte. Von ihm blieb nur dieser eine Titel, dauergespielt von Rias 2, in Clubs, im Autoradio. Warum? Er traf wie jeder gute Song einen Nerv.
Zu den besten Hintergrundgeschichten im Buch zählt die Szene, in der die britische Band „The Style Council“ ein sozialistisches Aufmunterungslied, eigentlich bestimmt für den Kampf gegen Margaret Thatcher, 1985 in Warschau intonierte, in dem die KP gerade das Kriegsrecht verhängt hatte. Die Musiker wunderten sich sehr, warum die Reaktion der Einheimischen so wenig enthusiastisch ausfiel.
„Der Sound unserer Jugend“ lässt sich als Erinnerungsalbum lesen, als Zeitgeschichtsbuch, aber auch, siehe oben, als Kontrastmittel, um die Konturen der Gegenwart deutlicher zu sehen. Es eignet sich nicht nur für diejenigen, die die Achtziger als Jugendliche erlebten. Aber für die natürlich besonders.
Jörg Hackeschmidt,
Lachen am Ende des Irrgartens
Volker Mohrs Erzählungssammlung „Verglühende Sterne“ wirkt auf den ersten Blick phantastisch. Seine Texte beschreiben allerdings keine Dystopie – sondern unsere Gegenwart
Von Günter Scholdt
Kam Ihnen, verehrte Leser, angesichts unseres täglich aufs Neue inszenierten Politabsurdistans nicht auch schon mal der Gedanke, zermürbende Sorge, maßlose Wut oder laute Empörung bildeten nicht die einzig richtige oder bekömmliche Antwort auf solches Skandalon? Dass man auf die immer penetrantere Praxis, eine Demokratie zur Postdemokratie, einen Rechts- zum Gesinnungsstaat zu verschandeln, um seelischer Erbauung willen auch mal anders reagieren kann oder darf? Etwa dadurch nämlich, dass man das Schauerlich-Groteske wie Verhängnisvolle dieses Vorgangs von seiner komischen Seite her beleuchtet.
Offenbar von solchen Überlegungen hat sich der Schweizer Erzähler Volker Mohr in seinem neuesten Novellenband „Verglühende Sterne“ inspirieren lassen. Gleich seine Eingangsgeschichte trägt den programmatischen Titel „Das Lachen“. Darin befällt den Helden bei der Betrachtung bestimmter Bauten oder Institutionen ein unwiderstehlicher, Verstimmung erregender Lachkrampf, dessen Ursache sich ihm erst am Ende erschließt. Anlass zu diesem scheinbar befremdlichen Verhalten boten beispielsweise das Parlament, das Rathaus, diverse Medien oder eine renommierte Kunstausstellung – alles Stichworte zur Erläuterung einer Kalamität, wonach selbst ursprünglich respektable Einrichtungen einem erschreckenden Wertverfall unterliegen können. Man denke etwa daran, wie bigott und pathetisch zurzeit Deutschlands Paulskirchen-Tradition von den hiesigen Parteiklüngeln zelebriert wird.
In der nächsten Geschichte entledigt sich ein zum Protest entschlossener Spaßvogel seiner Ersparnisse, faltet 500-Euro-Scheine zu Papierflugzeugen oder zerschneidet sie, was en passant den bloß symbolischen respektive fiktiven Charakter eines so hoch taxierten Wertes enthüllt und damit fast einen Aufruhr entfacht. In „Das Zepter“ wiederum verhilft ein der Allgemeinheit unsichtbares Schloss einem Außenseiter dazu, ganz neu zu beginnen. Infolge übernimmt er quasi im Dienst früherer Generationen eine Art Staffelstab zur gesellschaftlichen Bewusstseinsarbeit.
Mein Favorit im Band ist der Text über eine Mauer, die ohne Ankündigung plötzlich in einer Stadt ersteht, gleichermaßen als „Irrgarten“ oder „unsichtbares Gefängnis“ fungierend. Vom Tiefbauamt war das Projekt zuvor geleugnet, von den Bürgern nicht zur Kenntnis genommen worden. Der an Aufklärung interessierte Held überwindet die (bewusste?) Ignoranz, indem er das Bauwerk erklettert und zumindest in der Rolle als „Artist“ oder „Magier“ Aufmerksamkeit und Applaus erhält. Ein weiterer Protagonist, Mitarbeiter des staatlichen Inlandsgeheimdiensts, provoziert seinen Abschied von dieser Behörde durch einen imponierenden Schabernack. Erprobt er doch sein früher zur Infiltration der Opposition genutztes denunziatorisch-konspiratives Talent nun auch mal an einer Regierungspartei.
Allen Geschichten hat der Verfasser leitmotivisch ein komisches Ende unterlegt.
Darin feiern die Protagonisten mit subtilen Botschaften ihre kleinen humoristischen Siege. Überzeugt solches Happy Ending angesichts einer real existierenden politischen Klasse, die mittlerweile jede Scham ablegt und selbst offensichtliche Lächerlichkeit nicht mehr scheut? Siehe die unverhüllten Verstöße gegen elementare Normen einer Volksherrschaft respektive Demokratie, die diesen Namen verdient, etwa in Ludwigshafen, wo selbsternannte Verteidiger „unserer“ Demokratie dem aussichtsreichsten Kandidaten der Opposition schlicht das passive Wahlrecht entzogen. Zeigt sich der Autor in diesen Novellen angesichts der tatsächlichen Zustände heutiger Elitioten als naiver Optimist?
Keineswegs. Denn auch rabenschwarze Szenerien oder Dystopien zu ersinnen gehört zu Mohrs Repertoire, nachzulesen in den Erzählungen „Das Urteil“, „Im Spital“, „Die Clowns“ oder „Die letzte Fahrt“. Trotzdem belässt er seinen Protagonisten meist Resthoffnungen oder gönnt den Hauptpersonen zumindest individuelle Ausstiege aus einer kollektiven Katastrophenszenerie. Und wenn er seine Figuren diesmal durchweg als moderne Eulenspiegel zeichnet und ihnen subversiv-satirische Triumphe zuschanzt, liegt darin kein Utopismus gemäß unzähligen (gar unter „Politanalyse“ firmierenden) linken Theoriegebäuden und anthropologischen Wolkenkuckucksheimen. Schließlich schiebt Mohr gelegentlich Märchenhaftes ein, das schon immer Reservate auch für Träume offenhielt – oder Gegenwelten mit Appellcharakter und aufklärerischen Pointen.
Ein Letztes noch: Just dieser Band versteht sich als Therapie – des Autors selbst wie seiner Leser. Die damit verbundene aufmunternde Geste ist mit Dialektik formuliert und bedarf der Tucholsky’schen Einschränkung: „Lerne lachen ohne zu weinen“.
Volker Mohr, „Verglühende Sterne“ – Novellen, Loco Verlag, Schaffhausen 2025, 140 Seiten, 22 Euro
Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” –, fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.
Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.
Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.
Publico ist am Ende das, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.
Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto
A. Wendt/Publico
DE88 7004 0045 0890 5366 00
BIC: COBADEFFXXX
Die Redaktion
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.