Für 2027 steht die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes an. Schon jetzt formiert sich eine Koalition, die festlegt: Es muss unbedingt eine Frau sein. Wer, ist nicht so wichtig. Dabei wäre es so einfach, die Identitätspolitik hinter sich zu lassen – und jemanden zu bitten, der den Rechtsstaat verteidigt
Spätestens am 18. März 2027, dem letzten Tag seiner Amtszeit, soll offiziell feststehen, wer Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue nachfolgt. Das heißt: Natürlich steht der Name lange vorher fest, denn Überraschungen in der Bundesversammlung gibt es praktisch nie.
Die Kandidatensuche beginnt gerade, und zwar unter dem bewährten Ausschluss der Öffentlichkeit. Bis Ende des Jahres dürfte ein Name feststehen, der dann 2026 strategisch über die üblichen Hintergrundrunden an der Spree durchsickert. Nur der vergleichsweise unwichtige Wahlakt findet erst 2027 statt.In einem Punkt legt sich ein parteiübergreifendes Bündnis schon jetzt fest: Diesmal soll eine Frau in das höchste Staatsamt einrücken. So verlaufen die Personaldebatten der Gegenwart: Als Erstes gilt es, das Geschlecht der gesuchten Person in Stein zu meißeln. Zu dieser Vorgabe gibt es keine Alternative. Zweitens sprechen die Mehrheitsverhältnisse, falls nichts dramatisch kippt, beim nächsten Mal für ein Besetzungsrecht der Union, wobei sie mit Rücksicht auf die Brandmauer vermutlich im linken Lager um Stimmen bitten muss. Jenseits von Chromosomen und Parteibuch herrscht größtmögliche Flexibilität. Eine unausgesprochene Bedingung bleibt deshalb unausgesprochen, weil sie sich für alle an der Kür Beteiligten von selbst versteht: Wer auch immer in knapp zwei Jahren ins Schloss zieht, soll den politischen Betrieb nicht stören. Diese Bedingung erfüllt der derzeitige Amtsinhaber exzellent; er setzt darin den Katzengoldstandard, den jede Nachfolgerin tunlichst beachten muss.
Die Frage, wie es bis zum Frühjahr 2027 weitergeht, wenn alles nach Berliner Vorschrift verläuft, beantwortet sich am besten durch die Geschichte der Steinmeier-Auswahl. Damals, 2016, setze es sich die Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel in den Kopf, unter allen Umständen eine grüne Frau ins höchste Amt zu befördern, gewissermaßen als Anzahlung auf die von ihr dringend gewünschte schwarz-grüne Regierungskoalition. Zunächst sondierte sie bei Marianne Birthler, die zu DDR-Zeiten zu der oppositionellen Bewegung „Frieden und Menschenrechte“ gehörte, später Mitglied der Grünen und Bildungsministerin in Brandenburg war. Das Amt legte sie 1992 nieder, nachdem die Stasi-Tätigkeit von Ministerpräsident Manfred Stolpe ans Licht kam. Von 2000 bis 2011 leitete sie die Stasi-Unterlagenbehörde; 2018 spielte sie allerdings bei der Demontage des Stasi-Gedenkstättenleiters Hubertus Knabe eine zwielichtige Rolle.
Nach einer Bedenkzeit lehnte Birthler Ende 2016 Merkels Angebot ab. Die Kanzlerin, nach wie vor fixiert auf Frau und grün, suchte Ersatz, und fand ihn in Katrin Göring-Eckardt. Die zeigte sich überhaupt nicht spröde, sondern nahm bei ihren Auftritten aus dem Stand Begriffe wie zusammenführen und versöhnen ins Repertoire auf. Bei diesem noch unausgesprochenen und im Hinterzimmer eingestielten Personalvorschlag überschätzte Merkel allerdings die Duldungsbereitschaft des damaligen CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer und seines immer noch einflussreichen Amtsvorgängers Edmund Stoiber. Seehofer meinte, das ginge wirklich nicht; Stoiber sah es genauso, der Überlieferung nach rhetorisch noch ein bisschen nachdrücklicher.
Also nahm Seehofer Kontakt zu dem damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier auf, um ihm die Unterstützung der CSU für eine Bundespräsidentenkandidatur zuzusichern. In der Münchner Staatskanzlei beredeten beide die Einzelheiten. Die Sozialdemokraten hätten sich zumal mit entsprechender Medienbeihilfe natürlich für die grüne Frau begeistert, konnten die Offerte aber unmöglich ablehnen, nach Johannes Rau wieder den Bundespräsidentenposten zu besetzen, und das noch als Juniorpartner in der Regierung. Merkel befand sich nicht in der Lage, ihrem Koalitionspartner die Nominierung abzuschlagen, die Grünen ihrerseits wollten das Verhältnis mit der SPD nicht verderben. Steinmeier kam also nur aus einem singulären Grund ins Amt: damit dort keine andere Person Platz nahm.
Sobald er die Stimmenmehrheit für ihn in trockenen Tüchern wusste, gab er 2016 das für Aspiranten auf dieses Amt obligatorische Versprechen ab, unbequem, beziehungsweise weiter unbequem zu sein: „Wer mich kennt, weiß, dass ich es mir nie einfach gemacht habe, sondern immer auch unbequeme Dinge sage, für die es in der Öffentlichkeit keinen Applaus gibt.“ Als kantiges, kontroverses und rhetorisch risikofreudiges Staatsoberhaupt forderte er die Bürger draußen im Land zum Zusammenstehen und Unterhaken auf –, denn darin besteht für ihn die Essenz der Demokratie – und mahnwarnte gleichzeitig vor Populisten, Hetzern und Spaltern. In seiner Antrittsrede meinte er: „Aber viele fragen auch: Was ist eigentlich der Kitt – der Kitt, der unsere Gesellschaft im Kern zusammenhält? Und hält dieser Kitt auch für die Zukunft?“ Bei Kitt handelt es sich laut Definition um ein „pastenförmiges Klebe- und Dichtungsmittel, das auch als Füllstoff für Spalten, Fugen und Löcher genutzt wird“. Seine Reden erfüllten fortan genau diesen Zweck.
Neben dem hauptamtlichen Unbequemsein gab er sich durchaus konziliant und diplomatisch. Die taz-Journalistin Hengameh Yaghoobifarah lud er ins Bellevue, bevor sie Polizisten auf den Müll wünschte, aber nachdem sie den Deutschen eine „Dreckskultur“ bescheinigte; ferner gratulierte der Mann, der als Außenminister 2016 Donald Trump den Glückwunsch zur Wahl verweigerte, der iranischen Führung zum Revolutionsjahrestag im jahre 2023.
Nach dem Messermord durch zwei Migranten 2018 in Chemnitz bewarb er die stracks darauffolgende musikalische Sause, auf der u.a. die Bands „Feine Sahne Fischfilet“ und K.I.Z. auftraten. Zum Repertoire der ersten Combo gehört ein Lied, in dem es heißt: „Ich mach mich warm, weil der Dunkelheitseinbruch sich nähert. Die nächste Bullenwache ist nur einen Steinwurf entfernt“; ein K.I.Z.-Song beginnt unter anderen mit den Zeilen: „Ich ramm die Messerklinge in die Journalistenfresse“. Das Couplet spielten sie auch auf der Veranstaltung, die sich nach Steinmeiers Worten „gegen den Hass“ richtete. Dazu gab es Freibier.
Das konnte man noch ganz allgemein in der Rubrik politische Ausrichtung abbuchen, die er entgegen aller Beteuerungen in seiner angeblich überparteilichen Position nie zurücknahm. Das reichte ihm allerdings ganz offenkundig nicht. In etlichen seiner Reden versuchte sich Steinmeier auch in einer Rolle, zu der es in seiner Laufbahn nie irgendeinen Berührungspunkt gab, nämlich als Intellektueller. In seiner Rede zur Wiedereröffnung des Thomas-Mann-Hauses in Pacific Palisades 2018 schrieb er beziehungsweise sein nicht minder bildungsferner Redenverfasser den „Zauberberg“ kurzerhand um, indem er die Figur des Leo Naphta zum Vertreter des „Völkisch-Irrationalen“ erklärte. Bei Naphta handelt es sich um einen galizischen Juden und Jesuiten mit Sympathie für einen weltweiten Kommunismus; für das Völkische interessiert er sich also ungefähr soviel wie der Oberbeamte aus dem Bellevue für deutsche Literatur.
In seiner Ansprache zum 30. Jahr des Mauerfalls 2019 hakte Steinmeier die DDR schnell ab, um sich dann über lange Strecken am deutschen Kaiserreich abzuarbeiten, nach seiner kontrafaktischen Schilderung mindestens eine Halbdiktatur, in der Juden angeblich als „Reichsfeinde verfolgt, ausgegrenzt, eingesperrt“ wurden. Dass er über den SED-Staat deutlich milder redete, könnte daran gelegen haben und noch immer liegen, dass er als gar nicht mehr so junger Jurist einen Text für die linksradikale Zeitschrift „Demokratie und Recht“ verfasste, die in dem von Honeckers Partei finanzierten Pahl-Rugenstein-Verlag erschien. In einem Aufsatz von 1990 bedauert Steinmeier das Ende der DDR ausdrücklich.
Der Präsident konnte sich so geben und reden, weil er mit keiner größeren kritischen Medienöffentlichkeit rechnen musste. Im Fall des Sauerländers Heinrich Lübke erfand die Spiegel-Redaktion Sätze aus seinem Mund, um ihn lächerlich zu machen (“equal goes it loose“). Steinmeiers Sulz ließ und lässt sich mühelos auf der Seite des Bundespräsidialamts nachlesen. Es findet sich nur eben kein Spiegel– und kein Süddeutsche-Redakteur, der ihn professionell in Scheiben schneidet. In dem Gefühl, mit allem durchzukommen, warf der Präsident 2024 sein Buch „Wir“ auf den Markt, einen bunten Strauß aus Gedankensurrogaten und Stilblüten („Hunderttausende Obdachlose in diesem wohlhabenden Land lassen mir keine Ruhe.“).
Ausnahmsweise mokierte sich diesmal doch der eine oder andere sonst wohlgesinnte Medienvertreter. Damit erfüllte sich also doch noch seine Prophezeiung von 2017, er werde für manche seiner Äußerungen keinen Applaus bekommen.
Aber: Seine rhetorischen Karambolagen, seine alternative Geschichtsschreibung, seinen Einsatz für das Chemnitzer Postmordkonzert, den Glückwunsch für die Mullahs, seine generellen Bildungsschluchten, das alles hätte eine Mehrheit in diesem Land wahrscheinlich großzügig hingenommen wenn nicht sowieso ignoriert, wäre er während der Coronazeit bereit gewesen, auch nur einigermaßen an ihrer Seite zu stehen und die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes gegen den Zugriff der Exekutive zu verteidigen. Bekanntlich tat er nicht nur das nicht, sondern das Gegenteil.
Als erste Proteste gegen die mit Corona begründeten Freiheitseinschränkungen aufkamen, erklärte das Staatsoberhaupt, er verliere jetzt „die Geduld“ mit dieser Sorte Bürger, worin auch seine grundlegende Überzeugung mitschwang, die Regierten müssten sich Vertrauen und Geduld der Staatsspitze erst durch gutes Verhalten erwerben. Bei einem Besuch in einem (leeren) provisorischen Corona-Notfallzentrum 2020 erklärte er, der „vielleicht manchmal unbequeme und lästige Mundschutz“ sei „empfehlenswerter als der Aluhut.“ Bei ebendieser Visite zog er sich den Mundschutz schleunigst vom Gesicht, sobald die Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen ihr Interview mit ihm beendet hatten. Dass danach noch jemand mit der Handykamera weiterfilmte, fiel ihm nicht auf. Mit sich selbst übte er generell eine beachtliche Geduld, beispielsweise, als er 2022 zu einer Zeit keine Maske in der Bahn trug, als die Polizei Normalbürger wegen dieses Vergehens aus dem Abteil holte.
Um seine Formulierung „der Spaziergang hat seine Unschuld verloren“ zu übertreffen, müssten sich Amtsnachfolger schon außerordentlich anstrengen. Während er Bürgerdemonstrationen auf diese Weise kommentierte, schwieg er zu ungeheuerlichen Sätzen wie „der Handel muss für die Ungeimpften geschlossen werden“ (Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag Katharina Schulze) und „Ungeimpfte, ihr seid raus aus dem gesellschaftlichen Leben“ (der damalige Ministerpräsident des Saarlands Tobias Hans). Ihm fiel auch nichts dazu ein, als die Exekutive reihenweise Grundrechte einfach außer Kraft setzte, als ein in der Verfassung nicht vorgesehener Kanzlerin-Ministerpräsidentenrat Beschlüsse fasste, die Abgeordnete debattenlos abnickten; er fand es auch nicht weiter bemerkenswert, dass in Deutschland die Schulen länger geschlossen blieben als in jedem anderen EU-Land, und das, wie der Vergleich mit Schweden zeigte, ohne jeden Effekt auf die Ausbreitung des Virus.
Oft hieß es von vorsichtigen Kritikern, Steinmeier habe sich auf die Seite des Staates gestellt. Das stimmt in dieser Schlichtheit nicht, jedenfalls dann nicht, wenn man unter „Staat“ die Verfassungsordnung mit ihrer Gewaltenteilung und den Abwehrrechten der Bürger gegen den Staat versteht. Der Bundespräsident stellte sich damals vielmehr an die Seite eines autoritären politisch-medialen Komplexes – und gegen die Bürger. Das lag nicht etwa daran, dass er sich zu tagespolitischen Fragen generell nicht äußern würde. Das tat er seine gesamte Amtszeit über.
Als ein halbes Dutzend angetrunkener junger Leute 2024 in der Pony-Bar auf Sylt zu Döp-dö-dö-döp „Ausländer raus“ skandierte, schien das dem Staatsoberhaupt gewichtig genug, um eine „Verrohung der politischen Umgangsformen“ zu beklagen. Zu den Pro-Hamas-Kundgebungen, wie sie vor seiner Haustür im Wochenrhythmus stattfinden, teils auch mit offen mitgeführten IS-Flaggen, äußerte er sich dagegen sehr viel achtsamer: „Wir dürfen keinen Israel-Hass, der sich auf unseren Straßen entlädt, dulden. Von niemandem!“ Also ungefähr so wie Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, der unentwegt versichert, in seiner Stadt gebe es „keinen Platz für Antisemitismus“. Irgendwann verspielt ein bestimmter politischer Typus in der Gesamtbetrachtung jede Nachsicht.
Wer steht nun zur Nachfolge im schon halboffiziellen Angebot? Erstens Ilse Aigner. Wer mit dem Namen erst einmal nichts anfangen kann, muss sich nicht schämen. Die CSU-Politikerin amtiert als bayerische Landtagspräsidentin, also auf einem Posten, der gemeinhin als goldenes Abstellgleis gilt. Als Bundeslandwirtschaftsministerin (2008-13) hinterließ sie genauso wenig Spuren wie als Wirtschafts- und Bauministerin in Bayern (2013-18). Selbst in der CSU-Zentrale kann sich niemand an irgendeinen Satz erinnern, der im öffentlichen Gedächtnis geblieben wäre. Aus Sicht Markus Söders liegt darin eine große Qualität: immerhin auch kein Skandal, kein Fehltritt, sondern ein sich in regelmäßigen Abständen selbstlöschendes Blatt. Ins Schloss nach Berlin möchte Söder sie befördern, um als erster Parteichef dazustehen, der das höchste Staatsamt erfolgreich für die CSU reklamiert. Es scheint einen entsprechenden innerkoalitionären Handel zu dieser Sache zu geben; das könnte erklären, warum die CSU-Führung die SPD-Verfassungsgerichtskandidatin Frauke Brosius-Gersdorf so schnell durchwinken wollte, wobei sie nicht mit den etwa 60 Rebellen in der Unionsfraktion rechnete.
Mit Ilse Aigner käme der Empty Hosenanzug schlechthin an die Spitze. Wobei: Zu einigen gesellschaftlichen Themen meldete sie sich durchaus. In ihrer Weihnachtsansprache 2021 verglich sie die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen mit der SA 1933: „Sie marschiert mit Fackeln, um einzuschüchtern – ganz bewusst wie zu dunkelsten Zeiten. Das sind sie: die sprichwörtlichen Anfänge“, und forderte ein imaginäres Wir auf, sich gegen diese „Stimmungsmacher“ zu „wehren“. Kürzlich rief sie bei X zum Kampf „gegen gefährliches Reden“ auf, „weil dadurch allzu oft gefährliches Tun geworden ist“.
Wie sie sich den Kampf gegen das gefährliche Reden genau vorstellt, buchstabierte sie nicht näher aus. Gleitende Übergänge vom Reden zum gefährlichen Handeln gibt es durchaus, beispielsweise, wenn Politiker und technokratische Stichwortgeber der Öffentlichkeit einreden, Deutschlands historische Mission bestehe in der Weltklimarettung. Daraus entwickelte sich tatsächlich eine Deindustrialisierung auf breiter Front. Aber das meinte Aigner höchstwahrscheinlich nicht. Sie würde Steinmeiers Stil mit leichten Variationen fortsetzen, erstens nie etwas von sich zu geben, was bei den Öffentlich-Rechtlichen schlecht ankäme, und zweitens, Kritik grundsätzlich nur am Bürger zu üben.
Wer befindet sich noch in der Lostrommel? Ursula von der Leyen. Wer immer ihren Namen in die Gerüchtekanäle einspeiste, geht offenbar davon aus, dass sich die Korruptionsermittlungen gegen die EU-Kommissionspräsidentin bis 2027 in Wohlgefallen auflösen werden. Anders als Aigner schleppt die CDU-Frau zwar eine große Kollektion von Skandalen mit. Dafür besitzt sie ein blütenweißes Mobiltelefon ohne eine einzige Nachricht an oder von Pfizer-Chef Albert Bourla.
Manche Journalisten nennen noch die ehemalige CDU-Kurzzeitvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, möglicherweise, weil sie nach ihrem nicht ganz freiwilligen Ausscheiden aus der Berufspolitik in manchen Redaktionen nicht als Funktionärin im Ruhestand, sondern als Kandidat von außen gilt. Angesichts des Bewerberfelds läuft es wohl auf Aigner hinaus, also auf einen Triumph der Laufbahnpolitik und der Absprachen hinter verschlossenen Türen.
Das heißt: So liefe es in einem politischen Apparat, der mittlerweile fast seine gesamte Energie für seine Selbsterhaltung aufwendet. Es ginge auch anders. Wenn das Ereigniskärtchen Frau keine Rolle spielt, sondern Eignung und bürgerschaftliche Erwartung, dann kämen endlich andere Kandidaten ins Spiel. Einer empfiehlt sich gleich aus mehreren Gründen: der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier. Er würde das Amt nicht wie andere besetzen, sondern ausfüllen.
Als Verfassungsrichter von 1998 bis 2010 zählte er zu der mittlerweile aus Karlsruhe fast verschwundenen Juristengeneration, die Bürgerrechte konsequent als Abwehrrechte auslegte, und dafür in mehreren Urteilen dem Staat rote Linien zog. Nach Merkels Asylwende 2015 gehörte der Rechtsprofessor zu den wenigen öffentlichen Personen, die sich gegen das groteske Diktum wandten, die deutschen Grenzen ließen sich nicht schützen, und Deutschland habe es, wie sich die Kanzlerin ausdrückte, „nicht in der Hand, wie viele zu uns kommen“. In der allgemeinen Begeisterung von fast allen Politikern, Managern. Kirchenführern, Chefredakteuren und auch vielen Juristen, die einander damals steinmeieresk unterhakten, meinte er 2016 im Gespräch mit der Welt:
„Die engen Leitplanken des deutschen und europäischen Asylrechts sind gesprengt worden. Bestehende Regelungen wurden an die Wand gefahren. Die Asyl- und Flüchtlingspolitik krankt seit Langem daran, dass man es versäumt hat, zwischen dem individuellen Schutz vor Verfolgung einerseits und der gesteuerten Migrationspolitik für Wirtschaftsflüchtlinge andererseits zu unterscheiden.“ Und: „Wir haben rechtsfreie Räume bei der Sicherung der Außengrenzen, das darf nicht sein.“
Als beinahe solitäre Stimme übte er während der Corona-Pandemie eine grundsätzliche Kritik an der Freiheitsbeschneidung, die – daran sollte man auch hier wieder erinnern – vielen Wortführern immer noch nicht weit genug ging. Über Merkels dreiste Formulierung von 2021, solange die Zahlen nicht besser würden, könne es keine neuen Freiheiten geben, sagte er: „Darin kommt die irrige Vorstellung zum Ausdruck, dass Freiheiten den Menschen gewissermaßen vom Staat gewährt werden, wenn und solange es mit den Zielen der Politik vereinbar ist. Nein, es ist umgekehrt! Die Grundrechte sind als unverletzliche und unveräußerliche Menschenrechte des Einzelnen verbürgt.“
Genau diese Sätze hätte man sich damals von einem Bundespräsidenten gewünscht.
Papier hielt den Abgeordneten des Bundestages außerdem vor, die parlamentarische Kontrolle der Corona-Maßnahmen freiwillig abgetreten zu haben. Er übte, was bei ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichts selten vorkommt, auch Kritik an diesem Verfassungsorgan. Auf einer Veranstaltung zur Corona-Aufarbeitung im September 2023, organisiert von der Denkfabrik R21, erklärte der Staatsrechtler, die Verfassungsrichter des 1. Senats unter Stephan Harbarth hätten bei ihrem Urteil zur „Bundesnotbremse“ von der Bundesregierung den Nachweis anhand von Daten verlangen müssen, dass ihre Maßnahme überhaupt etwas gegen das Virus bewirkten. Stattdessen hätte das Gericht die Grundrechtseinschränkungen einfach pauschal durchgewunken: „Das entspricht nicht unserer freiheitlichen Ordnung“.
Hans-Jürgen Papier verkörpert den Gegenentwurf nicht nur zu Steinmeier, sondern auch zu der aussichtsreichsten Nachfolgerin. Wer sich bisher gleich bei zwei gewichtigen Themen dem Strom von Opportunismus und Ignoranz entgegenstellte, ändert das höchstwahrscheinlich auch im höchsten Staatsamt nicht. Der Jurist sieht sich als Verteidiger der Bürger und ihrer Rechte. Und er weiß, was Bürgernähe bedeutet: In Hamburg veranstaltet ein Privatmann in seiner Wohnung einen Salon, gut dreißig Leute finden sich mehrmals im Jahr dort ein, um zusammen mit einem Gast über gesellschaftliche Themen zu sprechen. Dieser Bürger lud Papier zu sich ein – und der Verfassungsgerichtspräsident a. D. kam, um zwei Stunden lang mit ihnen über Asylrecht zu debattieren. Übrigens ohne Honorar.
Nur in einem Punkt unterscheidet er sich natürlich nicht von dem Amtsinhaber: Es handelt sich auch bei Papier um einen älteren Mann. Nach einer Operation läuft er nicht mehr ganz geschmeidig. Das erwartet auch niemand von einem 82-Jährigen. Die Wirkung eines Bundespräsidenten liegt so oder so in der Rede. Und Papier besitzt im Gegensatz zu dem derzeitigen Mann an der Staatsspitze die Gabe der klaren Sprache. Er wirkt in seinen Auftritten sortierter und rhetorisch freier als mancher vierzigjährige Berufspolitiker. Kurzum, hier fände die Bundesversammlung den idealen Kandidaten, der zum Amt passt – aber eben nicht zum politmedialen Apparat. Nur genau das, diese fehlende Passung, sollte die einzige Eingangsvoraussetzung für dieses Amt sein.
Zu welchem Geschlecht ein Amtsträger gehört, interessiert außerhalb linker Berliner Kreise einschließlich der allermeisten dort tätigen Medienvertreter wirklich niemanden in diesem Land, zumal in einer Zeit, da sich sowieso jeder per Sprechakt zu einer Frau oder einem Mann erklären kann. Es gäbe hier und jetzt die Gelegenheit, die absurde Männer-Frauen-Debatte bei der Besetzung von Spitzenämtern endgültig zu begraben. Übrigens meint der Verfasser dieses Textes nicht, es müsste unter allen Umständen ein Mann werden. Eine Frau mit den Eigenschaften Papiers wäre selbstredend genauso geeignet. Nur drängt sich da niemand auf. Erwartungsgemäß dürfte der eine oder andere auch auf das fortgeschrittene Alter des früheren Verfassungsgerichtspräsidenten hinweisen. Wie schon erwähnt zeigt Papier in seinen Reden eine Geistesgegenwart und -schärfe wie kaum jemand in der ersten und zweiten Politikergarnitur, die in aller Regel einfach tausendmal gebrauchte Textbausteine ein tausenderstes Mal aufreiht. Aber selbstverständlich wäre ein Jüngerer mit den Qualitäten eines Papier hoch willkommen. Wer einen Namen weiß: bitte melden. Denn es geht um ebendiese Qualität, die der Aspirant oder die Aspirantin auf den Posten schon vor der Wahl beweisen sollte.
Der Zusammenstehapparat bekäme mit einem Präsidenten Papier (oder jemandem seines Zuschnitts) eine Person an der Staatsspitze, die sich nicht als Mechaniker dieser Maschinerie sieht, die Bürger dafür ein Oberhaupt, das zu ihnen spricht statt zu einer Funktionselite. Die Chancen dafür stehen aus genau diesem Grund nicht gut. Andererseits müssen die Zuständigen, die das Amt besetzen, sich in einer ruhigen Minute fragen, ob sie wirklich die Legitimität des politischen Betriebs mit der Kür eines Steinmeier-Nachfolgemodells noch ein bisschen weiter untergraben wollen.
Ein vorwitziger amerikanischer Reporter fragte einmal Kaiser Franz Joseph I., worin eigentlich dessen Funktion im Staat bestünde. Der antwortete: „Mein Volk vor den Launen der Regierung zu schützen.“ Darin liegt eine aphoristische Zuspitzung – aber nur eine leichte. Wenn das Bundespräsidentenamt überhaupt noch einen Sinn erfüllen soll, dann den des Gegengewichts zu einem selbstzufriedenen und gleichzeitig hochnervösen Juste Milieu in XXL, zu dem nicht nur Berufspolitiker und ihre Berater gehören, sondern auch Medien- und Kirchenleute, Agendawissenschaftler und opportunistische Manager. Als Wechselrahmen für Produkte der Berufspolitik braucht niemand den übrigens in der Unterhaltung ziemlich teuren Posten.
Auf die übliche Frage, wer es statt der Vorausgewählten denn sonst machen solle, gibt es also eine Antwort. Sollte 2027 trotzdem alles seinen geschmeidigen Berliner Lauf nehmen, dann müsste sich die Nachfolgerin Steinmeiers bei jeder Rede mit einem Hans-Jürgen Papier vergleichen lassen.
Diesen Schatten würde sie niemals los.
Dieser Beitrag erscheint auch auf Tichys Einblick.
Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” – fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt –, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.
Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.
Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.
Publico ist am Ende, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.
Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto
A. Wendt/Publico
DE88 7004 0045 0890 5366 00
BIC: COBADEFFXXX
Die Redaktion
Unterstützen Sie Publico
Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.





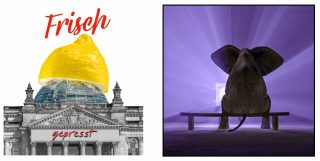

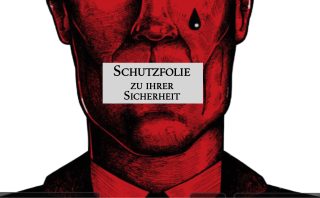



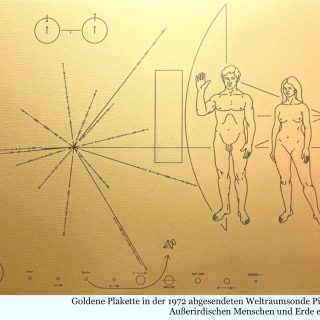
Klaus Dittrich
09.09.2025Wie immer ein exzellent geschriebener Artikel von A. Wendt.
Über die Person Steinmeier erübrigt sich weiteres Texten – dieser Mann ist ein „Labersack“, dessen größte (oder einzige) Leistung in der Nierenspende für seine Gattin besteht.
Interessanter ist die Frage der Nachfolge. Erster Punkt – Brauchen wir solch einen Symbolposten? Ich könnte auch ohne diese Amtsträger leben. Zweiter Punkt (für mich entscheidend) – Warum aus der Politikkaste? Mit Vaclav Havel haben es die Tschechen vorgemacht – ein Mann, der etwas zu schreiben und zu sagen hatte. Warum nicht auch in Deutschland? Mein Vorschlag: Juli Zeh. Gewiss, sie ist SPD-Mitglied, aber nicht mit Funktionärskrone. Sie kommt aus dem Westen, lebt aber lange genug im Land Brandenburg, um die Nöte im Osten zu verstehen. Und sie hat ein Alter – nichts gegen die Ausstrahlung von Herrn Papier, aber mir scheint er zu alt -, mit dem sich nach einer Amtsperiode wieder in den „echten“ Beruf zurückfinden lässt. Dass ich ihre Bücher schätze, sei nur am Rande vermerkt.
Aber klar, lieber latschen beide PEN geschlossen zur Bundesversammlung, um gewünschte Kandidaten abzunicken, als eine der ihren zu promoten.
Andreas Rochow
10.09.2025Bedenken! Frau Zeh gehört zu den eitlen öffentlichen Richtig-Meinern mit nicht zu übersehender linkspopulistischer Schlagseite. Das Merkmal des „Ossis“, als DDR-Insasse handfeste Erfahrungen mit der SED-Diktatur gemacht zu haben, erwirbt sie als Artist in residence im schönen und preiswerten Brandenburg nie! Das darf auch gar kein Eignungskriterium – Quote! – für das höchste Amt sein. Weisheit, Distanziertheit, Lebenserfahrung, Ideologiefreiheit und Urteilsvermögen eines Mannes wie Hans-Jürgen Papier sind es, die man prototypisch von einem Bundespräsidenten erwarten darf. Und – man wagt es kaum noch zu formulieren! – eine wohlwollende Haltung zum deutschen Volk und seiner Heimat, auch wenn es gottlob für linksgrüne Revolutionen mehrheitlich nicht zu begeistern war. Nicht linksgrün(extrem) ist nicht gleich faschistisch! Diese Gewissheit sollte Deutschland durch Merkels monströsen NGO-Propagandakrieg ausgetrieben worden. Der überstrapazierte Pappkamerad „Antifaschismus“ führt zwangsläufig in die „antifaschistischen“ Diktatur! Er ist ein Propagandamärchen, das Parteipolitik und Medien zu Getriebenen macht, die die Bedürfnisse des Volkes und die ursprüngliche Bedeutung des demokratischen Rechtsstaates aus den Augen verlieren. Es wäre so gesehen ein glücklicher Umstand, wenn sich ein lebenskluger Präsident fände, frei von Klassenkampfambitionen, von großer Transformationswut und antideutschem Anbräunungsgeifer – nur dem Volk und dem geschundenen Grundgesetz verpflichtet. Ein neutraler, menschlicher Supervisor ohne „Feine Sahne Fischfilet“ und Flixbuskolonnen gegen Rächtz.
Andreas Rochow
09.09.2025Wie immer dicken Bretter, die auf Publico gebohrt werden. Danke dafür.
Heute, da mehr und mehr der Eindruck aufkommt, eine verantwortungslose Kartell-Parteipolitik delegiere in ihrem Versagen die Verantwortung an einen gigantischen, milliardenschweren NGO-Untergrund, ist es wichtiger denn je, sich des demokratischen Rechtsstaats, seines Grundgesetzes und seiner wichtigsten Institutionen zu besinnen. Natürlich ist dem Bundespräsidenten die Rolle des Wellenbrechers zueigen. Nicht gegen den Souverän, sondern gegen sich durchsetzende autoritäre, grundgesetz-vergessene Tendenzen der Regierung! Da wäre das höchste Amt gut ausgefüllt durch einen verdienten, weisen (!) Mann, der in Krisen das Land und sein regierendes Personal wieder ins Fahrwasser der Verfassung bringen und den Demos vor einer panisch übergriffigen Regierung zu bewahren. Für den kartellfreien Ex-Bundesverfassungsrichter Hans-Jürgen Papier als Bundespräsident könnten sich respektable Mehrheiten des deutschen Volkes begeistern! Das Volk wird aber nicht gefragt. Aus Angst vor dem „unberechenbaren“ Demos wird die Wahl des Bundespräsidenten von einem wunderlichen Conclave namens Bundesversammlung vollzogen, deren Zusammensetzun gleichsam intransparent wie antidemokratisch ist. (Parallelen bestehen zur Komposition der Programm- und Aufsichtsräte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks!) in der Bundesversammlung versammeln sich neben dem Bundestag in gleicher Zahl Delegierte der Landtage, die sich aus Kulturschaffenden, Sportlern und „Gesellschaft“, zunehmend auch aus bunten Vertretern der Regenbogen- und anderen diskriminierten Minderheiten zusammensetzen. Da möchte man eher an Wahlchancen für Hirschhausen oder Lesch glauben und wenn es denn eine besondere Frau sein sollte, so etwas zwischen Dunja Hayali und Ferda Ataman. Der Würde des Amtes könnte allerdings mit Hans-Jürgen Papier beispiehaft entsprochen werden. Offenkundig kontraproduktiv ist das Ansinnen der linksgrün-bunten Bundesversammlung, eine(n) der ihren zu inthronisieren. Vor Überraschungen bei der BuPräs-Wahl will man sicher sein.
P.S. Ins Register der bemerkenswerten Verfehlungen des Bundespräsidenten Steinmeier gehört seine Rede in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau. Er denunzierte sein Volk mit dem Satz: „Die bösen Geister zeigen sich heute in neuem Gewand“, und manipulierte ein „Blutbad“ in der Synagoge von Halle hinein, das es gottlob nicht gegeben hat. Dieser Akt höchstamtliche Anbräunung des eigenen Volkes als „völkisch“ ist so ausgeleiert, dass es mittlerweile auch international mit Fassungslosigkeit und Kopfschütteln beobachtet wird. Das Regierungsversagen, seinem „völkischen“ Volk anzulasten, ist des Alleinstellungsmerkmal dieser Präsidentschaft. Keine Petitesse: Vorgänger Steinmeiers haben gewusst, wann sie zu gehen hatten. Die Zeiten haben sich drastisch geändert. Heute übertönt der laute NGO-Antifaschismus zuverlässig das Blut auf deutschen Straßen und die fortschreitende Deindustrialisierung des kaputtregierten Merkeldeutschland. Und Steinmeier trägt dafür wesentliche Verantwortung.
Tanyma
09.09.2025Herr Wendt, also wirklich. Ilse Aigner hat bahnbrechende Erkenntnisse als Landwirtschaftsministerin verbreitet! Heumilch, also Milch von Kühen, die nur mit Heu/Gras gefüttert werden, ist laktosefrei! Ich lache heute noch. Das hatte damals schon Baerbock-Niveau. Ein Glück dass die gerade lukrativ für sich in NY aufgeräumt ist, sonst käme die auch als Kandidatin ins Spiel, bin ich mir sicher….
Werner Bläser
09.09.2025Warum nicht Maja T. als Bundespräsidentin – oder müsste man in diesem Fall sagen, Bundespräsident? Es wäre der erste deutsche Spitzenpolitiker, der dort sitzt, wo er hingehört, nämlich zur Zeit im Knast in Ungarn. – Es tut mir leid, aber mir fällt zu deutscher Politik nichts Ernsthaftes mehr ein. Es ist ja nur noch ein einziges grosses Kabarett. Allerdings ein trauriges.
N. Schneider
10.09.2025„Wer mich kennt, weiß, dass ich es mir nie einfach gemacht habe, sondern immer auch unbequeme Dinge sage, für die es in der Öffentlichkeit keinen Applaus gibt.“ (F.-W. Steinmeier)
Zum Schieflachen.
Maru
10.09.2025Ganz ehrlich, Papier ist mit 82 einfach zu alt für diesen Job. Um die 65 sollte der BuPrä höchstens sein, aber nicht älter.
Einen Alternativvorschlag habe ich auf die Schnelle nicht. Vielleicht, wenn‘ s eine Frau sein soll, eine Comedian wie Monika Gruber oder Lisa Fitz. Wenigstens hätten wir dann was zu lachen.
Momentan kann davon leider nicht die Rede sein, alles ist bierernst und schwer.
Oder jemand Adliges. Die Windsors z.B. finde ich hochgradig unterhaltsam.
Auf jeden Fall machen die mehr her als die langweiligen Bundespräsidenten
Julius
10.09.2025Der Artikel wundert mich jetzt schon, es steht doch fest, daß das Merkel Bundespräsidierende wird.
E. Denecke
05.10.2025Den gleichen Gedanken – besser: Nachtmahr – habe ich seit kurzem auch. Eingeflößt hat ihn mir eine italienische Zeitung – leider vergessen, welche es war.
Es wäre von bestechender Konsequenz.
Gerald Gründler
11.09.2025Wie immer exzellent. Vielen Dank! Der Text ist ein opulentes Kompendium für alle, die sich Gedanken um eine wahrheitsgemäße Bilanzierung der präsidialen Steinmeier-Jahre machen.
Im Übrigen bin ich dafür, das Amt als Beispiel für den überfälligen Bürokratieabbau endlich zu schleifen.
Elisabeth Köster
11.09.2025Lieber Herr Wendt,
ich wundere mich, dass Sie nicht von selbst drauf kommen: Kristina Schröder! Frau, CDU und gescheit. Herr Papier ist wirklich zu alt.