Es fängt mit dem Ort an
Roger Scruton schreibt die Autobiografie eines Konservativen – und wirkt dabei sehr gegenwärtig

Manchem deutschen Leser dürfte der Brite Roger Scruton schon ein Begriff gewesen sein, bevor die deutsche Übersetzung von „How to be a Conservative“ 2019 im Finanzbuchverlag erschien.
Im April 2019 twitterte ein Journalist des New Statesman angebliche Zitate aus einem Interview, das er mit Scruton geführt hatte – Beleidigendes über Chinesen, einen antisemitischen Kommentar über den Finanzier George Soros, aggressive Bemerkungen über den Islam. Nur vier Stunden später entfernte die britische Regierung unter Theresa May den Philosophen von seinem (unbezahlten) Posten einer Kommission für besseres Bauen. Der New-Statesman-Journalist postetet daraufhin ein Bild von sich selbst, auf dem er mit Champagner zu sehen war und den Abschuss des konservativen Publizisten feierte.Dann stellte sich ziemlich schnell heraus, dass die vermeintlich empörenden Scruton-Zitate von ihm verkürzt, verdreht und zurechtfrisiert worden waren. Ein öffentlicher Proteststurm zwang das Magazin, das volle Transkript des Interviews zu veröffentlichen. Und das zeigte Scruton als eigensinnigen, libertären, sehr englischen Individualisten, als Konservativen und luziden Beobachter – und zwar ohne eine Spur von Rassismus und Antisemitismus.
Nach einer Schamfrist (die Scham bezog sich auf den zuständigen Minister) bekam er sogar seinen Job in der Kommission zurück.
Wer ist der Philosoph, der diesen Sturm stoisch über sich ergehen ließ? Roger Scruton, Jahrgang 1944, besitzt die seltene Fähigkeit, über Ideen so zu schreiben wie Rudyard Kipling über Personen und Landschaften. Die Begriffe in „Von der Idee, konservativ zu sein“ bleiben nicht abstrakt. Denn seine Idee des Konservativseins ist die der Begrenzung: Eine Gemeinschaft freier Bürger kann für ihn nur in überschaubaren Gebilden und nur im freiwilligen Zusammenschluss existieren (weshalb Scruton auch den Brexit begrüßt). „Wenn die Gesellschaft von oben organisiert wird, entweder durch die vertikale Führung einer revolutionären Diktatur oder durch die unpersönlichen Verordnungen einer undurchschaubaren Bürokratie, verschwindet die Verantwortung schnell aus der politischen Ordnung ebenso wie aus der Gesellschaft. Eine vertikale Regierung gebiert verantwortungslose Individuen, und die Enteignung der bürgerlichen Gesellschaft durch den Staat führt dazu, dass die Bürger nicht mehr willens sind, für sich selbst zu sorgen.“
Für sich selbst sorgen können Bürger seiner Meinung nach nur, wenn sie die geerbten Traditionen zwar kritisch mustern, aber vor allem als ihren eigentlichen Schatz verstehen. Zum Gewachsenen gehört nach Scruton vor allem der oikos, der Ort: „Menschen werden sesshaft, indem sie den Erste-Person-Plural erwerben – einen Ort, eine Gemeinschaft, eine Lebensweise, die sie ‚unser’ nennen können.“ Hier zieht er den entscheidenden Trennstrich. Auf der einen Seite zeichnet er sein Bild einer bestimmten Gesellschaft, die auch wandlungs- und aufnahmefähig ist, in der aber Platz und kulturelles Erbe etwas zählen, und die sich nicht endlos ausdehnen lässt. Auf der Gegenseite steht der Entwurf einer supranationalen beziehungsweise globalistischen Gesellschaft, die weder Bürger noch Grenzen und Wurzeln kennt, sondern nur noch frei flottierende Menschen- , Güter- und Kapitalströme. Zu Scrutons wichtigsten Anliegen gehört es, den Begriff des Konservatismus aus der Nähe der Ökonomie zu befreien, in die er vor allem auf der Insel durch Margaret Thatcher geraten war, und wieder auf den Begriff des autonomen Bürgers zurückzuführen.
Was den Autor von vielen anderen westlichen Konservativen unterscheidet, ist seine Erfahrung des östlichen Totalitarismus. Er reiste schon in den siebziger Jahren zu Zeiten der Charta 77 nach Prag, um sich dort mit Dissidenten zu treffen. Wenn er von seiner ersten Begegnung mit diesem Untergrund in einer Prager Privatwohnung erzählt, ist Scruton gleichzeitig Historiker, Autobiograf und Philosoph. „In jenem Zimmer hatte sich der arg mitgenommene Rest der Prager Intelligenzia eingefunden: alte Professoren in abgenutzten Westen, langhaarige Poeten, Studenten mit frischen Gesichtern, Priester, Romanautoren, und Theologen […] Auch hatte ich entdeckt, dass sie alle den gleichen Beruf hatten: sie waren Heizer.“
Den von dem Regime in den Hilfsberuf abgedrängten Oppositionellen, schreibt Scruton, sei es am wichtigsten gewesen, die Erinnerungen an die Ideen wachzuhalten, an deren Verdrängung der kommunistische Apparat arbeitete. Mit diesem Bild des realexistierenden Sozialismus vor Augen attackierte er schon lange vor dem Fall des Eisernen Vorhangs die linken Intellektuellen des Westens: „Ich sah nun in der Realität die Fiktionen, die in den Hirnen meiner marxistischen Kollegen herumschwammen.“ Vermutlich verschaffte ihm gerade dieser doppelte Blick so viele erbitterter Gegner.
In seinem Buch gibt es durchaus melancholische Passagen; den Verlust etwa der religiösen Spiritualität, den er für unumkehrbar hält, bedauert er außerordentlich. Dennoch lautet sein Appell an Konservative, nicht ständig über Verluste zu klagen, sondern vor allem darüber zu sprechen, was sich trotz aller Umbrüche im Westen an kulturellen Beständen erstaunlicherweise erhalten hat. Zum 30. Jahrestag der Samtrevolution reiste er im November 2019 noch einmal nach Prag, zwar gezeichnet von der Chemotherapie, aber auch mit Triumph. Im Spectator schrieb er vor wenigen Tagen, beim Fall der Mauer 1989 sei es Tschechen, Polen und den anderen Völkern nicht um Grenzenlosigkeit gegangen, sondern darum, dass sie nach dem Untergang des Ostblocks wieder in eigenständigen Staaten leben konnten: „We are celebrating the restoration of national sovereignty to people who had been absorbed and oppressed by a lawless empire.“
Renitente Bürger, die an Ideen festhalten, davon ist Scruton überzeugt, können mächtiger sein als Imperien.
Roger Scruton: Von der Idee, konservativ zu sein: Eine Anleitung für Gegenwart und Zukunft
FinanzBuchverlag 300 Seiten 22,99 Euro
Werdet erwachsen, nehmt einen steifen Drink
Bret Easton Ellis setzt in Trump-Zeiten das Individuum gegen die politische Korrektheit
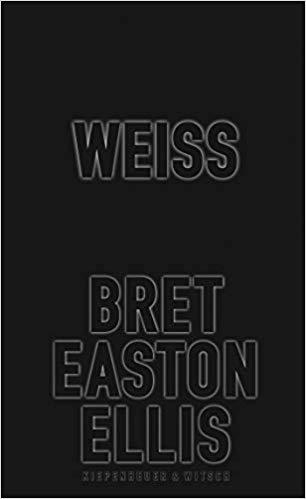
Im November 2020 finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Die Chancen stehen einigermaßen gut, dass Donald Trump, dessen Wahlsieg 2016 als Skandal galt, noch eine zweite Amtszeit gewinnt. Wer wissen will, warum es zu diesem ersten Skandal kam, warum es eine Wiederholung geben könnte und was zwischendurch mit und in Amerikas intellektueller Elite passierte, der kann in Bret Easton Ellis’ „Weiß“ Antworten finden. Und noch einiges mehr. Denn sein Buch taugt genauso gut als Bestandsaufnahme der politischen Korrektheit und ihrer Folgen in Europa.
Den meisten Lesern wird Bret Easton Ellis als Autor von „Unter Null“ bekannt sein, vor allem als Verfasser von „American Psycho“, einem Buch, das in den Neunzigern hauptsächlich wegen seiner Mordszenen den Autor berühmt und gleichzeitig zum Träger des Labels umstritten machte. Als Autor politischer Texte fiel er bisher nicht auf. Bei seinem Buch „Weiß“ handelt es sich im Grunde auch um keinen klassischen politischen Text. Das gehört zu den Vorzügen des Buchs. Was ist es dann? Ein Band von gut 300 Seiten, der deutsche Buchhändler in Verlegenheit bringt, weil er nicht in die hiesige Genreaufteilung passt. „Weiß“ ist Autobiografie, Essay, Spott, ein sezierender Schnitt in die Ideologie der politischen Korrektheit. Und über weite und unterhaltende Strecken eine Beschreibung des linksliberalen und wohlmeinenden amerikanischen Milieus nach der Trump-Wahl 2016. Diese Passagen gehören zu den dichtesten in Bret Easton Ellis’ neuestem Werk.
Es gibt inzwischen den spöttischen Begriff des „Trump Derangement Syndrome“, der tief in die privaten Beziehungen reichenden Konfusion von Leuten, die sich sicher waren, dass jemand wie Trump niemals Kandidat werden könnte, dann niemals Präsident, dann von Rechts wegen amtsenthoben werden musste, kurzum, deren Denken so zwanghaft um Trump kreist wie ein Meteor, der vom Schwerkraftfeld eines Sterns eingefangen wurde. Jetzt sieht es so aus, als würde noch eine Extrarunde bis 2024 fällig.
Der Autor, Jahrgang 1964, bleibt bei all seinen Analysen gleichzeitig das, was er immer war, nämlich Erzähler. Ellis bekennt, 2016 weder Clinton noch Trump, sondern gar nicht gewählt zu haben. Er hielt beide nicht für überzeugende Kandidaten. Allerdings empfand er Trumps Sieg aber auch nicht als Katastrophe, anders als sehr viele seiner Freunde, Bekannten und Angehörige der kulturellen Szene. Er beschreibt, wie er Anfang 2017 zu einem Podiumsgespräch im Royal Institut of Great Britain eingeladen war, wo der Moderator von ihm offenbar ein flammendes Bekenntnis gegen den frisch vereidigten Präsidenten erwartet hatte. „Der Moderator fragte mich, was ich von dem ‚endlosen Horror’ hielte, der sich gerade in den vereinigten Staaten abspiele. Ich musste ihn unterbrechen und klarstellen, dass diese apokalyptische Erzählung von der Wahl eines Präsidenten und ihren Folgen nichts weiter als das sei. Eine Erzählung. Sie spiegle nur die ungeheure Epidemie von Alarmismus und Katastrophengeilheit wider, die von amerikanischen Medien befördert werde. Ich erinnerte den Moderator daran, dass trotz seiner persönlichen Meinung über Trump ungefähr die Hälfte der Wähler ganz zufrieden mit dem Ergebnis der Präsidentenwahl sei. Als ich das sagte, hätte man im ausverkauften Saal eine Stecknadel fallen hören können.“
Ein Schriftsteller, ein Angehöriger der kulturellen Elite, ein offen schwul lebender Intellektueller, der nicht in die übliche Trump-Verdammungsrhetorik einfällt: Nicht nur der Gastgeber im Royal Institute fragte sich, wie das passieren konnte. Eine Antwort, die Ellis gibt, lautet: Er nahm Trump wahrscheinlich gelassener hin als andere in seiner Umgebung, weil dessen Wahl ihn nicht sonderlich überraschte.
An einer Stelle beschreibt er, wie er 2016 mit überwiegend Millenials zusammenarbeitete, die sich meist für den linken Demokraten-Kandidaten Bernie Sanders erwärmten. Über Trump erregten sich die meisten. Hillary Clinton ließ fast alle kalt. Dass sie von den meisten Medien als „qualifizierteste“ Bewerberin angepriesen wurde, schreibt er, hätten offenbar sehr viele als Chiffre für ‚Mitglied der bürokratischen Politelite’ gelesen, also das, was sie mit Sicherheit nicht wollten.
Zum anderen kam Trump als Nemesis über ein von Selbstgerechtigkeit durchtränktes linksliberales Milieu. Bret Easton Ellis weiß, wovon er schreibt, denn er kennt es bestens, ohne selbst wirklich dazuzugehören. In seinem abgeklärten Ton erzählt er von einem Abendessen mit einem Paar, in dessen Verlauf einer in einem Wutausbruch ruft, die linksliberale Ost- und Westküste sollte bestimmen, „wer Scheißpräsident wird“. Und nicht die deplorables (Clinton) der Fly-Over-States dazwischen: „Ich bin ein stolzer Vertreter der liberalen Elite, und ich finde, wir sollten den Präsidenten aussuchen, weil wir es besser wissen.“
Dieser kulturell-medialen Schicht, die mit Trump den Schaden bekam, gibt der Autor in „Weiß“ noch reichlich Spott obendrauf: „Barbra Streisand erzählte den Medien, sie nehme wegen Trump zu. Lena Dunham erzählte den Medien, sie nehme wegen Trump ab. Die Menschen gaben dem Präsidenten inzwischen die Schuld für ihre persönlichen Probleme und Neurosen.“ Den so durchgeschüttelten empfiehl er einerseits: „Es wurde Zeit, dass sich alle mal die Erwachsenenkleider anziehen, an der Bar einen steifen Drink nahmen und sich richtig miteinander unterhielten.“ Anderseits weiß er, dass das nicht mehr geht. Die Konversation ist kaputt.
Das allein wäre noch nicht genügend Stoff für ein Buch von über 300 Seiten. Ellis erzählt auch über große Strecken (manchem werden sie lang vorkommen, anders als dem Rezensenten) von seiner kulturellen Bildung als kalifornischer Mittelschichtsjunge, von der Anziehungskraft, die Filme und Songs auf ihn hatten, und vor allem von seiner ausgeprägten Faszination für die hochglanzpolierte Populärkultur der Siebziger und Achtziger (seine erotische Initation verdankt er „American Gigolo“ mit dem blutjungen Richard Gere). Für ihn ist das hauptsächlich ein wehmütiger Those-Were-The-Days-My-Friend-Rückblick auf eine unschuldige Zeit, in der politische Korrektheit, Identitätspolitik und Angst, irgendetwas Sexistisches beziehungsweise überhaupt Skandalisierbares zu sagen, noch nicht alles durchtränkt hatte.
In einer Szene schildert er, wie er sich mit einem jungen Mann – nach der Wahl Trumps – darüber unterhält, welche aktuellen Songs sie mögen. Ellis sagte, er höre gerade Popsongs, die den Country weiterentwickelten. Worauf sein Gesprächspartner ihn anstarrt und antwortet: Country, das sei die Musik der Trump-Wähler. Also der Feinde. Darüber, schreibt Bret Easton Ellis, habe er sich bis dahin nie Gedanken gemacht, für ihn sei es immer nur darum gegangen, ob ein Song ihm gefällt.
Seinem halb so jungen Gesprächspartner war diese Haltung völlig fremd.
Bret Easton Ellis: Weiß
Kiepenheuer & Witsch 320 Seiten 20 Euro
Der Spötter kann auch Liebhaber sein
Michael Klonovsky stellt Fragen, die exklusiv sind – und gibt genau so individuelle Antworten

In seiner fortlaufenden Chronik „Acta diurna“ tritt der Autor Michael Klonovsky meist als ätzender Spötter auf. Nicht immer möchte er dem „polemischen Laster“ (Thomas Mann) eigentlich nachgeben. Aber die Verhältnisse sind nicht so, beziehungsweise: sie sind eben so.
In seinem Band „Der fehlende Hoden des Führers“ schlägt er einen anderen Ton als in seiner Chronik an, denn er versammelt Klonovskys Essays, die allein schon deshalb anders wirken, weil sie nicht mehr in der Nachbarschaft tagespolitischer Kommentare stehen. Der Autor besitzt in vielen seiner Stücke das Talent, Fragen zu stellen, auf die nur er kommt, und entsprechend überraschende Antworten zu geben, denen man schon aus reiner Neugierde folgt. Vieles, was er seinen Lesern ausbreitet, ist also im wahrsten Sinn unerhört. Warum und wie kam Richard Wagner in den Ruf, ein bis heute gefährlich kontaminierter Rechter zu sein? Michael Klonovsky erzählt in seinem Stück „Ein deutscher Linker. Über Richard Wagner“ die Geschichte des Revolutionärs von 1848, der in die Nähe des Nationalsozialismus gezogen wurde, obwohl sein Werk dazu kein Material liefert. Ganz nebenbei weist der Autor dabei nach, wie wenig Wagner von den meisten Nazis geschätzt wurde, eben mit der einen Ausnahme, nämlich Hitler. An ihm liegt es, dass dem Komponisten auf deutschen Regietheaterbühnen bis heute erst braune Flecken aufgepinselt und dann rituell abgeschrubbt werden.
In einem anderen Essay fragt er: Warum nicht einmal – anhand des Buches eines Apologeten – 1400 Jahre Geschichte aus islamischer Perspektive betrachten? (Um dann allerdings seine Sicht entgegenzuhalten).
Und nun zum titelgebenden Text: „Der fehlende Hoden des Führers. Eine spirituelle Leibschau“. Über die Sache mit der Unvollständigkeit wussten ja schon britische Soldaten Bescheid, die im zweiten Weltkrieg den Colonel-Bogey-March sangen: „Hitler has only got one ball / Goring has two but very small / Himmler is very sim’lar / and poor old Goebbels has no balls at all“.
Aber als die Bild mit der Sondermeldung herausplatzte: “Jetzt amtlich: Hitler hatte nur einen Hoden“, da war der Wirbel doch beträchtlich. Ja, wieso eigentlich? „Reden wir hier allen Ernstes über Hitlers Eier? Wen interessiert das?“, fragt Klonovsky. Um anzufügen: „Aber gemach, vielleicht kommen wir aus der Sache mit einem Erkenntnisgewinn heraus.“ Ja, das ist der Fall. Denn der Autor benutzt die Einhodigkeit des Führers, um darzulegen, dass Hitler körperlich, also als Angehöriger der Gattung Mensch eigentlich nicht vorstellbar war und ist, und dass er auch selbst genau darauf Wert legte. Anders als Stalin kannte er – als Nichttrinker, Nichtraucher – keine Gelage, es gibt (anders als von Mao) keine Bilder von ihm im unbekleideten Zustand. Seine Sexualität versteckte er, Kinder wollte er ausdrücklich nicht. Er führte keine Gespräche, sondern monologisierte. Er liebte niemanden, das deutsche Volk schon gar nicht, dem er zum Schluss den Untergang wünschte. „Mit einem Wort: er vermied es, als Mensch in Erscheinung zu treten.“ Dieser kurze Text Klonovskys zählt zu den luzidesten, die über Hitler geschrieben wurden, denn er zeigt, wie (auch) diese Körperlosigkeit des „Geschöpfs von unausrechenbarer Fremdheit“ dazu führt, dass Hitler bis heute als böser Geist in beziehungsweise über der deutschen Mentalitätsgeschichte hockt.
Von Michael Klonovsky gibt es, siehe oben, viel Spöttisches, es gibt viele angeschärfte Gedanken. Aber, um Brecht zu bemühen: „Und fragst du mich, was mit der Liebe sei?“ In dem Essayband zeigt er auch diese Seite, und zwar ausführlich. Seine Texte über Anton Bruckner, Richard Strauss, über den Rundgang durch die Münchner Pinakothek an der Seite des Malers Peter Schermuly, sein, wie er schreibt, „Kniefall“ vor Lampedusas „Gattopardo“ – diese Stücke sind nicht nur von reicher Kenntnis durchzogen, sondern auch, ganz ernsthaft, von Liebe. Damit beschenkt er seine Leser.
Michael Klonovsky: Der fehlende Hoden des Führers: Vermischte Essais.
Mit einem Nachwort von Lorenz Jäger
Karolinger Verlag 235 Seiten 23 Euro
Himmel Erde tiefdunkel gelb
Zhou Xingsi schrieb die erste Schulfibel der Welt – und bildet jetzt auch deutsche Leser
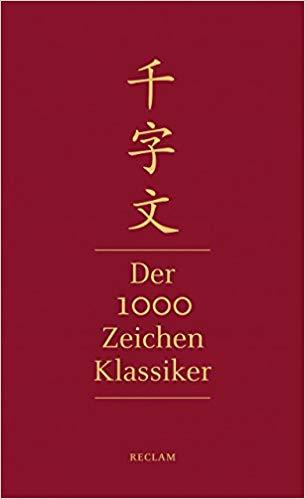
Im 6. Jahrhundert wünschte sich Chinas Kaiser Wu einen zusammenhängenden Text aus den berühmten eintausend Schriftzeichen, die bis dahin als mustergültige Zusammenstellung zur Einübung der Kalligrafie galten. Der Gelehrte Zhou Xingsi (469 -521) erfüllte ihm den Wunsch. Er schrieb den „Tausend Zeichen Klassiker“, ein Gedicht, in dem jedes der tausend Zeichen nur einmal vorkam. Sein Lehrgedicht schreitet die gesamte (Antike) chinesische Welt ab: Von Himmel und Erde, Pflanzen und Tieren, Pflanzen und Früchten geht es zu Unterweisungen in Höflichkeit („meide auch schicklich / müßiges Reden / Über die Schwächen / anderer Leute”) weiter zur Beschreibung des Landes und zum Staatsaufbau. Der Kaiser, heißt es in Überlieferungen, war sehr zufrieden.
Zum ersten Mal gibt es dieses Buch, das über Jahrhunderte als Schulfibel benutzt wurde und in China immer noch populär ist, in deutscher Übersetzung. Deren Besonderheit besteht darin, dass sie die Mandarin-Schriftzeichen, die Lautumschrift, eine poetische deutsche Übertragung von Eva Lüdi Kong und die Interlinearübersetzung nebeneinander stellt. Die Interlinearübersetzung entfaltet noch einmal ihren eigenen Reiz. Die Verse „Der Himmel hoch oben / Die Erde hienieden; / In tiefblauem Dunkel / Und irdenem Gelb“ lauten beispielsweise in der reduzierten Form so: „Himmel / Erde / tiefdunkel / gelb“.
Die kenntnisreichen Kommentare und Bilder machen den „1000 Zeichen Klassiker“ nicht nur zu einem literarischen Schatz, sondern auch zu einem Geschichtsbuch.
Wer etwas über China aus der Kultur selbst erfahren will, der kann hier reichlich schöpfen.
Zhou Xingsi: Qianziwen – Der 1000-Zeichen-Klassiker
Reclam 156 Seiten 24 Euro
Zwischen Baum und Baum der Himmel
Die Dieterichsch’sche Verlagsbuchhandlung führt mit japanischer Anmut durch das Jahr 2020
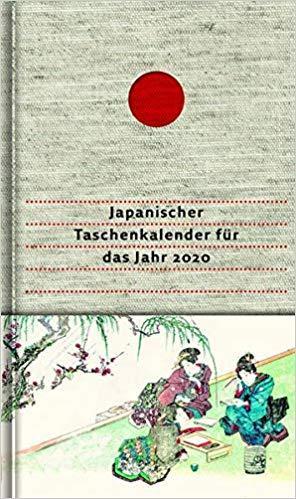
Ein Taschenkalender ist praktisch. Er kann außerdem noch schön sein. So wie der japanische Taschenkalender für 2020: Neben dem Platz für Notizen zu jedem Tag begleitet er mit Haikus von Bashô bis Ryôta durchs Jahr, illustriert mit klassischen japanischen Zeichnungen.
„Ach, nun ist es Herbst / zwischen Baum und Baum und Baum / Farbe des Himmels“. Aber am Anfang: „Entlaubtes Reisig / schon geschnitten, sprießen noch / Knospen hervor“.
Der Kalender ist einfach ein schönes Buch. Ganz von selbst schreibt man darin schöner als sonst, wenn man seine Einträge macht.
Japanischer Taschenkalender für das Jahr 2020:
Mit 53 Haiku von Matsuo Bashô und seinen Meisterschülern
Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung 240 Seiten 24 Euro
Unterstützen Sie Publico
Publico ist werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Mit Ihrem Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Danke!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl auf ein Konto überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punkt Über.











Dieter Schilling
22. Dezember, 2019Super, Herr Wendt! Meine Tocher (12) versucht gerade Japanisch zu lernen, weil sie wohl alles Japanische so toll findet. Endlich habe ich ein Weihnachtsgeschenk für Sie!
Vielen Dank und frohes Fest!
Dieter S.
Stephan Landgrebe
23. Dezember, 2019Im Großen und Ganzen finde ich Ihre Empfehlungen nicht ganz uninteressant. Was Richard Wagner betrifft, bin ich leider ganz anderer Meinung. Zweifellos war Wagner 1848 auf der Seite der Revolutionäre, aber sein unsägliches Pamphlet “Über das Judentum in der Musik”, sowie seine spätere Anbiederung an seine “Weihnachtsganz” Ludwig II und die Hofierung des Preußischen Königs Wilhelms I, zeigen, dass er doch wohl gründlich die Seiten gewechselt hatte. Mir selbst als Berufsmusiker war immer gegenwärtig, dass mein Großvater als Halbjude die Musik ablehnte, nicht allein wegen ihrer Oberflächlichkeit und dem Bombast, sondern auch wegen ihrer Länge. Gern zitierte er Rossini, der befragt über seine Eindrücke vom Tristan, dessen Uraufführung er in Paris noch erlebte, antwortete: “Ja der Tristan hat schöne Momente, aber böse Viertelstunden.” Mein Großvater verabscheute auch die “Meistersinger”, nicht nur, weil er als Bratscher in der Staatsoper Berlin vier Stunden pausenlos Mittelstimmen abzufideln hatte, sondern auch wegen des deutschtümelnden Ausspruchs von Hans Sachs: “Was deutsch und echt!” Mir selbst wird nach anfänglicher jugendlicher Begeisterung im Studium diese Musik immer suspekter.
Werner Bläser
28. Dezember, 2019Wenn man Wagner aus musikalischen Gründen nicht mag, okay – ich mag ihn auch nicht. Aber ein Kunstwerk abzulehnen, weil der Schöpfer des Werks charakterlich oder sonstwie moralisch zweifelhaft ist, ist albern. Ein Kunstwerk ist ein Kunstwerk, weil es sich als Werk in gewissem Mass verselbständigt hat, allgemeinmenschlich ist, und über die Schöpfung einer einzelnen Person hinausgeht.
Wollen Sie Rudyard Kiplings grossartige Werke ablehnen wegen seines Gedichts “The White Man’s Burden”, in dem er den Kolonialismus verherrlichte? Er fand sogar verständnisvolle Worte für das Massaker von Amritsar. Wollen Sie François Villons Werke ablehnen, weil er ein Verbrecher war? Brecht, weil er Kommunist und – gegenüber seinen Frauen – ein ausbeuterischer Parasit war? George Bernard Shaw, weil er in unglaublich dämlicher, vernagelter Weise den Stalinismus rechtfertigte? Caravaggio, weil er ein Totschläger und Händelsucher war? Rimbaud, weil er (auch einmal) Waffenhändler war?
Man muss zwischen Autor und Werk trennen. Manche Autoren verstehen ihre eigenen Werke sogar nur unvollkommen – es gibt keine schlechteren Interpretationen der Werke von Flaubert als die des Autors selbst.
Das Kunstwerk nicht vom Schöpfer trennen zu können, heisst, es als Kunstwerk zu verneinen.
Kotzbrocken (pardon!) können Kunstwerke erster Güte schaffen – und nette Menschen Banales.
Sigrid Ebert
23. Dezember, 2019Danke für die Bücherliste! Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen glücklichen Neujahrsbeginn.
Dieter Kief
29. Dezember, 2019Lorenz Jäger hat das Nachwort zu Michael Klonovskys wie ich zustimme interessanter Essay-Sammlung geschrieben. So so. Aber das ist ja ebenfalls super! Die zwei Haikus aus dem japanischen Taschenkaender sind auch super!
Gute Wünsche für 2020 – das wird bestimmt spannend!
PS
Dass Hitler biologisch und geistig kein Mensch gewesen sei, weil er nur einen Hoden hatte, keine Kinder wollte, monologisierte – ach Gottchen! auch Autisten sind Menschen, selbstvertändlich!
Der treffliche Michael Klonovsky hat eine kleine schwache (ungeschützte) Stelle, er kennt Goethe nicht so gut – nicht so gut wie Schiller. Das merkt man auch hier: Denn laut Goethe gilt der Satz, ihm sei nichts Humanes fremd, durchaus (Goethe, meint damit, übersetzt ins aktuelle Deutsch: Unbedingt!)
PPS
Der Klonovsky Rezeptions-Boykott in den bürgerlichen Medien sollte mal dringend aufgehoben werden. Peter Frey z. B. liegt hier sehr schief. Auch Roland Tichy, mein’ ich.