

Als wären sie immer noch da
Monikas Marons Roman „Stille Zeile 6” von 1991 erscheint neu – und erweist sich sogar als gegenwärtiger und politischer als vor dreißig Jahren
Nach ihrem Wechsel von S. Fischer zu Hoffman und Campe entschied sich der neue Verlag, alle Bücher Monika Marons noch einmal in der neuen literarischen Heimat herauszubringen. Für jüngere Leser und alle, die spät, womöglich erst durch den Konflikt der Autorin mit Fischer auf Maron aufmerksam wurden, bieten die Neuausgaben die Chance, ihre früheren Romane zu entdecken. Wer sich für Monika Marons „Stille Zeile 6“ von 1991 entscheidet, der kann hier ein für die Autorin nicht untypisches Phänomen wahrnehmen (übrigens auch beim Wiederlesen nach 30 Jahren): den langen Hall ihrer Geschichten in die Zeit hinein. „Stille Zeile 6“ wirkt 2021 nicht nur so aktuell wie damals, sondern aus dem Abstand sogar gewichtiger, gegenwärtiger, auch politischer. Unmittelbar nach dem Einschnitt von Mauerfall und Kollaps der Erziehungsdiktatur, der damals tief und endgültig wirkte, schien Marons Mitte der Achtziger in der DDR angesiedelte Geschichte nur noch zu erklären, was war. Heute kann es Lesern durchaus so vorkommen, als würden sie mit diesem Roman nicht nur einen Blick in den tiefen Brunnen der Vergangenheit werfen. Bei Karl Kraus heißt es: „Was vom Stoff lebt, stirbt mit dem Stoff, aber was von der Sprache lebt, lebt mit der Sprache.“ Bei Maron lebt beides, ihr Romanstoff, und ihre Erzählstimme.
„Stille Zeile 6“ spielt in einer Transformationszeit. Mitte der Achtziger verglimmen die letzten Zukunftsbilder, die führenden Kader und Sinnstifter der Staatspartei ein paar Jahrzehnte vorher entworfen hatten, um die Bevölkerung für ihre Gesellschaftsvorstellung zu begeistern. Niemand glaubt mehr an den weltweiten Sieg des Sozialismus, an das Überholen, ohne Einzuholen und den Bau-Auf-Optimismus. Jeder, auch die Kader selbst, wissen, dass Verfall, Verschleiß und Erstarrung das Klima im Land bestimmen. Viele Insassen des Staates reisen aus, oder sie ziehen sich ins Private zurück und warten darauf, dass die greisen Männer an der Spitze endlich verschwinden, ohne genau zu wissen, wer und was dann folgen soll. Und auch die Führungsgreise selbst scheinen nur noch ihre restliche Zeit abzusitzen.
Die Buchheldin und Erzählerin Rosalind Pokowski gehört zu den Aussteigern in diesem stillstehenden und ziellosen Land, in dem ständig von Fortschritt und Zukunft die Rede ist; Herbert Beerenbaum, mit dem sie eine Verbindung eingeht, die man nach heutigen Begriffen toxisch nennen würde, gehört zu den alten mächtigen Männern. Er wohnt noch wie andere Parteikader der zweiten und dritten Garnitur in dem Pankower Städtchen, dem früheren Viertel der Spitzenfunktionäre rund um den Majakowski-Ring, während der innerste Zirkel längst in ihrer eigenen hermetisch abgeriegelten Siedlung außerhalb von Berlin lebt. Rosalind Pokowski läuft zum Beginn durch das Städtchen, auf dem Weg zu Beerenbaums Beerdigung (der Leser erfährt ziemlich früh, wie die Begegnung zwischen ihnen ausgeht), und ihr Blick auf diese Straßenzüge setzen den Ton des Romans:
„Der Ort war öde wie eine Goldgräberstadt, deren Schätze erschöpft waren. Nur klapperte hier nirgends eine Tür oder ein Fensterflügel im Wind. Wie von Geisterhand wurde Ordnung gehalten, als wären die, die fort waren, immer noch da.“
Die Gründe für den Ausstieg der Erzählerin aus ihrem Beruf in einem Institut, in dem sie als Historikerin eine kleine Parzelle der Arbeiterbewegungsgeschichte zu beackern hatte, klingt erst einmal zeitlos und unpolitisch. Sie kommt eines Tages zu dem Schluss, „dass es eine Schande ist, für Geld zu denken.“ Gemeint ist: Sie will nicht mehr an der Sinnschöpfung für die Partei und diesen Staat mitwirken. In einem Café, in dem sie nun viel Zeit verbringt, trifft sie auf den gut doppelt so alten Professor Herbert Beerenbaum, eine ehemals wichtige Figur des DDR-Wissenschaftsbetriebs, der immer noch die Gesten der Macht beherrscht, allerdings, nach einem Schlaganfall, nicht mehr seine rechte Hand. Darunter leidet sein letztes großes Vorhaben, die Abfassung seiner Lebenserinnerungen. Er braucht eine Assistentin, der er seine Memoiren diktieren kann, Rosalind Pokowski braucht zwar nur wenig Geld, aber eben ein Minimum für Lebensmittel und Miete. Es gibt aber noch einen tieferen Grund, warum die beiden sich nicht nur handelseinig werden, sondern auf den nächsten Seiten geradezu ineinander verbeißen. Abgesehen davon, dass Beerenbaum, seit kurzem Witwer, sich wieder weibliche Gesellschaft wünscht, weckt die desillusionierte Frau auch seine Neugierde und seinen „polemischen Charakter“, den sie schon bei ihrer ersten Begegnung an ihm diagnostiziert. Darin ähnelt er Rosalind sogar. Sie, der die Funktionärswelt fremd ist, erkennt in ihm ihre Gegen- und sogar Hassfigur, die sie auf paradoxe Weise in ihre Schwerkraftfeld zieht.
Beerenbaums Lebenserinnerungen, die sie zu Papier bringen soll, liegen als aufgeladene Atmosphäre zwischen ihnen. Denn es handelt sich nicht um Memoiren. Beerenbaums Gedächtnis funktioniert zwar exzellent, aber jemand wie er käme natürlich nicht auf die Idee, das zu diktieren, woran er sich erinnert, beispielsweise an das Moskauer Hotel „Lux“, in dem sich die kommunistischen Emigranten aus Deutschland gegenseitig denunzierten, und in dem Stalins Geheimpolizei in der Nacht Beerenbaus Genossen abholte. Ein Funktionär wie Herbert Beerenbaum hält Selbsterforschung und Reflexion auch am Lebensende für bürgerlichen Schnickschnack. Das Buch, das ihm Rosalind Pokowski in seinem Haus in der Stillen Zeile tippen soll, dient ausschließlich der Rechtfertigung – seines Lebens, seiner Partei und seines Staates. Dafür braucht er auch gar keine eigene Sprache. Er benutzt dafür vorgestanzte, schon tausende Male benutzte und bewährte Formelsätze. Eigentlich könnte seine Assistentin das Werk auch ohne ihn fertigstellen, denn sie kennt diese tote Sprache. „auch den Ton, in dem er sie sprechen sollte. Alles hatte ich genau so schon gehört“. In der Szene wird sie zu seiner Stimme: „Es war eine schöne, aber schwere Zeit, sagte ich, weil ich wusste, dass dieser Satz jetzt gesagt werden musste
Ja, sagte Beerenbaum, es war eine schwere, aber schöne Zeit. Und wir haben viel erreicht.
Und das werden Sie verteidigen gegen jeden, der…
…der das Rad der Geschichte zurückdrehen will. Jawohl, das werden wir, sagte Beerenbaum. Erst danach sah er mich erstaunt an.
Ich ahnte gar nicht, dass wir uns darin so einig sind.“
Worauf sie antwortet: „ich habe nur meinen Vater zitiert.“
Von ihm, Schuldirektor und Mitglied der neuen herrschenden Kaste, kennt sie all diese Wendungen, und vor allem die völlige Abdichtung des eigenen Gedankengebäudes gegen den „Ffeindt“, wie Beerenbaum das Wort ausspricht. Und Ffeindt, das ist zu diesem Zeitpunkt praktisch alles außerhalb der eigenen Überzeugungskapsel.
Davon erzählt Marons Buch: Wie durchaus intelligente und persönlich nicht bösartige Menschen es schaffen, ein Weltbild zu rechtfertigen, obwohl diese Welt um sie herum längst in Trümmern liegt. Rechtfertigungsmaschinen verfügen über ein Eigenleben. Sie laufen und laufen noch, wenn sonst nichts mehr funktioniert. Und irgendwann dient die Begründungsmaschine nicht mehr dem Funktionär, sondern umgekehrt.
Marons Buch bewegt sich auf zwei Bahnen. Eine verbindet Rosalinds Kindheitserinnerungen und die Begegnungen mit Beerenbaum, dem Wiedergänger ihres Vaters. Wie in einer griechischen Tragödie läuft die Beziehung zwischen den beiden unerbittlich auf das schon vorweggenommene Finale zu. Auf der anderen Spur folgen die Leser ihr ins Milieu der inneren DDR-Emigranten, ihrem Freundeskreis, zu dem ihr früherer Lebensgefährte Bruno gehört (auf gewisse Weise immer noch ihr Gefährte), außerdem ein Sinologe, der aus politischen Gründen in Haft saß, und die Klavierlehrerin Thekla Fleischer, die sich als Selbständige in einem Staat durchschlägt, der eigentlich keinen Platz für solche nicht angestellten Existenzen vorsieht. Westdeutschen und Jüngeren bietet sich hier der Blick auf eine DDR-Gesellschaft, zu der eben zwischen den Funktionären, den Angepassten und der kleinen Opposition auch die Zurückgezogenen gehörten. Bruno und der Sinologe sind gewitzt, hochgebildet und nicht gewillt, ihre Intelligenz diesem Staat zur Verfügung zu stellen. Und der Staat verzichtet seinerseits großzügig auf alle, die nicht sein Glaubensbekenntnis sprechen wollen.
Es gibt auch mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR erstaunlich wenig Literatur, die in diesem Staat spielt, und dabei etwas für die Gegenwart zu erzählen hätte. Und keins nähert sich so wie „Stille Zeile 6“ einen wichtigen mentalen Kern dieses Staates, dem ewigen intellektuellen Unterlegenheitsgefühl seiner herrschenden Funktionären, die meist aus Handwerker- und Arbeiterfamilien des Kaiserreichs stammten, in den Straßenkämpfen der Weimarer Republik sozialisiert wurden, dann im politischen Untergrund des Nationalsozialismus und in der für sie oft genau so lebensgefährlichen Emigration in der Sowjetunion, und die dann verspätet ihre Erziehungsdiktatur errichteten, die sie eigentlich schon in den dreißiger Jahren verwirklichen wollten. Es fällt nicht schwer, ihre Selbstgerechtigkeit abstoßend zu finden, sich über ihre unbeholfene Funktionärssprache lustig zu machen. Bruno und der Sinologe tun das auch reichlich in ihrer kompensatorischen Verachtung. Rosalind ekelt sich außerdem vor Beerenbaums, wie es heißt, „Lurchgesicht“, vor seinen künstlichen Zähnen und seinen faltigen Händen.
Trotzdem, und darin liegt Marons Erzählkunst, wirkt ihr Buch nirgends denunziatorisch. Ihr Beerenbaum ist kein Pappkamerad zum Scheibenschießen, sondern eine Figur aus eigenem Recht. Die Autorin, Stieftochter des DDR-Innenministers Karl Maron, die 1988 die DDR verließ, nachdem ihr Debütroman „Flugasche“ nur im Westen erscheinen konnte, kennt die Welten gut, von denen sie erzählt. Trotzdem wäre es ein Fehler, die Hauptfigur des Romans einfach für eine literarische Stellvertreterin Monika Marons zu halten. Sie achtet im Gegenteil auf Distanz, auch zu ihrer Heldin.
In dem raffinierten Aufbau des Romans liegt ein gewisser Verfremdungseffekt. Er beschreibt die DDR im Jahr 1985 schon in einer End- und Übergangszeit, also in einer Phase, in der noch der ZEIT-Hochtöner Theo Sommer mit Einstecktuch und stasibetreut durch die DDR tourte und seinen Lesern meldete, es ginge überall munter voran, und die DDR-Insassen brächten Erich Honecker so etwa wie stille Verehrung entgegen. Die intellektuelle Ausstattung, so etwas zu schreiben, ist das eine. Die Fähigkeit, dann nach 1990 nicht etwa nur noch mit einer Papiertüte über dem Kopf an der Alster zu spazieren, sondern sich unverändert als Welterklärer weiter zu spreizen, das andere.
Rosalind Pokowski neigt bei ihren Besuchen in der Stillen Zeile zu einer Milde, gegen die sie sich selbst wehrt. Denn sie erlebt Beerenbaum als kranken Greis, nicht mehr als machtbewussten Funktionär, der nicht zögert, andere ins Gefängnis zu schicken, die seiner Meinung nach das Rad der Geschichte in die falsche Richtung drehen könnten. Eben deshalb, weil Beerenbaum hinfällig ist, überlebt er diese letzte Begegnung mit seiner Assistentin nicht.
Westdeutsche erfuhren nach 1990 die ehemaligen Herrscher der DDR ausschließlich so: den Diktator a. D. als Krebskranken, der sich mit Fistelstimme vor Gericht verteidigte. Den Geheimdienstchef als ridikülen Senior mit speckigem Lederhütchen.
Die meisten DDR-Erfahrenen lernten den Staat kennen, den diese Männer im Vollbesitz ihrer Kraft prägten. Darüber wiederum wollen sich viele Westdeutsche bis heute am liebsten nichts oder nur Konfektioniertes erzählen lassen. Das Schweizer Analyseinstitut MediaTenor und das Allensbach-Institut stellten 2021 fest, dass der Tenor der medialen Erzählungen über die DDR schon vor einigen Jahren ins Positive kippte, besonders deutlich bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Das Land eines Herbert Beerenbaum zeigen sie ihren Publikum wahlweise als Klamotte oder als Kulisse für privatistische Erzählungen – nur nicht als Diktatur. Nicht nur der Bundespräsident scheint mittlerweile das deutsche Kaiserreich negativer zu bewerten als den Ausläufer des sowjetischen Imperiums, der bis zur Elbe reichte. Die Formel, man müsse aus der Geschichte lernen, damit sie sich nicht wiederholt, gilt ausgerechnet für diese noch gar nicht so entfernte Vergangenheit nicht.
In dieser Verdrängungsatmosphäre scheint es manchmal so, als wären die Figuren von damals auch heute immer noch da.
Wäre Monika Marons „Stille Zeile 6“ nur ein Buch über die Vergangenheit – es wäre auch drei Jahrzehnte nach seiner Erstausgabe noch gut und lesenswert. Aber es ist eben sehr viel mehr: Kein Buch, dem das Etikett ‘DDR-Roman‘ genügen würde, sondern ein sehr gegenwärtiger und eigentlich zeitloser Text über Begründungsapparate, die auch ohne Energiezufuhr weiter klappern. Ein Buch über selbstauferlegte Blindheit. Und über das Phänomen, dass gesprochene Formeln mehr Macht besitzen können als die Wirklichkeit. Zumindest für einige Zeit.
Monika Maron „Stille Zeile 6“, Hoffman und Campe, 173 Seiten, 24 Euro (gebundene Ausgabe), E-Book 9,99 Euro

Der Kulturkrieg: wie alles begann
Arthur M. Schlesingers „Die Spaltung Amerikas“ erschien mit über 20 Jahren Verspätung auf Deutsch. Wer die Wurzeln der Identitätspolitik verstehen will, die mittlerweile den gesamten Westen ergriffen hat, der kommt um dieses hoch luzide Buch nicht herum
Auch jahrelange Feldzüge, in denen die Frontlinien manchmal im Schlachtnebel verschwinden, beginnen mit einer ersten Salve auf ein begrenztes Ziel. Im Fall des amerikanischen Bürgerkriegs war das bekanntlich die Kanonade auf Fort Sumter am 12. April 1861. Brigadegeneral Pierre G.T. Beauregard, der damals das Feuer eröffnen ließ, hätte möglicherweise seine Hand zurückgezogen, wenn er gewusst hätte, welche Gemetzel in den kommenden vier Jahren folgen würden. Major Robert Anderson, Kommandeur von Sumter, wäre vielleicht schon vor dem ersten Schuss kapitulationsbereit gewesen und nicht erst einen Tag später, wenn er für einen Moment in die Zukunft geschaut hätte. Oder auch nicht, denn er hätte dann auch gewusst, dass seine Seite ganz am Ende gewinnen sollte.
Arthur M. Schlesingers „Die Spaltung Amerikas. Überlegungen zu einer multikulturellen Gesellschaft“ handelt von einem Kriegsausbruch, der mit begrenzten Angriffen begonnen hatte, seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten anhält und mittlerweile die gesamte westliche Welt im Griff hält. Den Kulturkrieg leugnen mittlerweile nur noch wenige. Überall, wo jemand seine Existenz bestreitet, erinnern sich zumindest Ältere an Leonard Cohens Songzeilen: „There is a war between the ones who say there is a war / And the ones who say there isn’t.“
Im Sommer 2021 erreichte er seinen vorläufigen Höhepunkt, als nach dem Tod von George Floyd in den USA Denkmale niedergerissen oder abtransportiert wurden, selbst der Name Abraham Lincoln für manche Schulen nicht mehr als akzeptabel galt, als die Statue von Queen Victoria im britischen Leeds von Leuten beschmiert wurde, die sie, eine überzeugte Gegnerin der Sklaverei, als Vertreterin der Sklavenhalterkaste denunzierten, als weltweit gut 30 Menschen durch Ausschreitungen von Mobs starben, als geachtete liberale Professoren wegen eines als rassistisch oder auch nur als traumatisierend ausgelegten Satzes von ihren Lehrstühlen flogen und als klassische Musik an der Universität Oxford als kulturelles Erbe der Sklavenzeit verdammt wurde, in Kanada Bücher, die der neuen Orthodoxie nicht genügten, in Flammen aufgingen, und sich mehrere Kommissionen in Berlin an die Arbeit machten, um wenn schon nicht die Straßen, dann wenigsten die Straßennamen zu säubern.
In diesem Kulturkrieg gibt es ein teils verborgenes, mitunter aber auch offen ausgesprochenes Ziel: Das gesamte westliche Erbe einschließlich der Aufklärung soll zu einem einzigen weißen Schuld- und Schamkomplex schrumpfen. Die Bürgergesellschaft hat zu verschwinden zugunsten einer neuen tribalistischen, an Rasse, Herkunft und Religion und Geschlecht ausgerichteten Ordnung, in der es keine Individuen mehr gibt, sondern nur noch Angehörige von Identitätskollektiven.
Von den ersten Salven dieses Krieges erzählt Arthur M. Schlesingers Buch „Die Spaltung Amerikas“. Wer es liest, gibt dem Impuls nach, immer wieder ganz nach vorn zu blättern, um sich zu vergewissern, dass es im Original tatsächlich schon 1998 erschien. Nur wenige Autoren besaßen je die analytische Intelligenz und Prognosekraft des 1917 geborenen Historikers, der im äußerlich tiefsten Frieden der späten Clinton-Jahre schon alle Zutaten des kommenden identitätspolitischen Gemetzels erkannte. Auf Deutsch liegt Schlesingers Buch erst seit 2020 vor. Erst durch die lange Perspektive, durch den Rückblick des Autors bis in die Sechziger und weiter in die Vergangenheit und die Position des Lesers in der Gegenwart treten die Konturen dieser Auseinandersetzung in aller Deutlichkeit hervor.
Seine eigene Position versteckt Arthur M. Schlesinger Jr. In diesem Buch so wenig wie in seinen anderen Werken. Der 2007 gestorbene Historiker arbeitete als Redenschreiber für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Adlai Stevenson in den Fünfzigern, 1961 zog er als Sonderberater – gewissermaßen als Präsidentschaftschronist – mit John F. Kennedy ins Weiße Haus. Für seine Kennedy-Biografie erhielt er den Pulitzer-Preis. Der lebenslange Demokrat gehörte immer zu den entschiedenen Verfechtern der amerikanischen Idee in pluribus unum: niemand sollte seine biografischen Wurzeln leugnen oder beschneiden müssen, und trotzdem als amerikanische Bürger in seinen Rechten den anderen gleich sein. Mit der Emanzipation der Schwarzen zu gleichberechtigten Bürgern, wie sie Martin Luther King vorschwebte, wäre aus Schlesingers Sicht das amerikanische Versprechen erfüllt.
Sein Buch handelt davon, wie die Entwicklung, zunächst langsam und kaum bemerkt, nicht den Weg Kings nahm, sondern einen anderen: der Segregation, der Betonung ethnischer Unterschiede, der Identitätspolitik. Und die speiste sich erst einmal aus ganz verschiedenen Quellen. Schlesinger zitiert den weißen Philosophen Michael Novak, Autor von „The Rise of Unmeltable Ethnics“, der schon in den Siebzigern eine „neue ethnische Politik“ forderte, in der „Gruppen die Regeln, Ziele und verfahren der amerikanischen Politik“ steuern sollten, und nicht mehr Bürger. Der Autor erinnert auch daran, dass das „Ethnic Heritage Studies Program Act“, ein „Gesetz zur Untersuchung des ethnisches Erbes“ schon 1974 vom Kongress verabschiedet wurde. „Das Gesetz“, so Schlesinger, „ignorierte völlig jene Millionen von Amerikanern – sicherlich eine Mehrheit – , die es ablehnten, sich als einer bestimmten Gruppe zugehörig zu identifizieren.“ Von da aus brauchte es nur noch einen weiteren Schritt zu der Behauptung einer neuen Gelehrtenkaste, das gesamte an den Schulen und Universitäten gelehrte Wissen sei „weiß“, „eurozentrisch“ und setze damit die rassistische Unterdrückung aller Nichtweißen auch nach deren formalrechtlicher Emanzipation fort, so, wie es der amerikanische Afrozentrist Molefi Kete Asante in dem schon damals üblichen schrillen Anklageton formulierte: „In gewisser Hinsicht tötet das eurozentrische Curriculum unsere Kinder, es löscht ihr Bewusstsein aus.“
Dem Aufstieg akademischer Scharlatane wie Asante, Asa G. Hilliard, Amos Wilson und anderen, die behaupteten, Schwarze seien eigentlich den Weißen mental und genetisch bedingt überlegen (Wilson schrieb das der Melanin-Produktion zu), Afrika sei eigentlich die kulturelle Wiege der Menschheit (zu der wurde kurzerhand das alte Ägypten erklärt, das allerdings nie zu Schwarzafrika gehörte), und die alle Schwarzen in den USA kulturell zu „Afrikanern“ erklärten, dem Gespinst also, das am Anfang der heutigen Identitätsideologe stand, widmet Schlesinger einen mit präzisen Strichen gezeichneten Abriss mit teils umfangreichen Zitaten.
Die neuen Rassenideologen mit anderem Vorzeichen konzentrierten sich von Anfang an erfolgreich auf zwei Gebiete, die heute die Hauptschlachtfelder der Identitätspolitik bilden: Die Geschichtsschreibung – und die Schul- und Universitätsbildung. Ihren Einfluss konnten sie auch deshalb schnell ausweiten, weil sehr viele liberale Akademiker die historische Sklaverei in den USA mit guten Gründen für den großen entstellenden Fleck auf der amerikanischen Idee hielten (so auch Schlesinger), und die deshalb anders als Schlesinger glaubten, mit der Umschreibung von Lehrplänen und Geschichtsbüchern ließe sich früheres Unrecht wieder gutmachen. Geschichtsschreibung, stellt der Historiker Schlesinger fest, sei von mehr und mehr seiner Kollegen vor allem als Mittel zur Therapie ethnischer Minderheiten gesehen worden. „Werden schwarze Kinder wirklich besser in der Schule, wenn ihnen beigebracht wird, dass alles, was die Welt an Gutem hervorgebracht hat, letztlich aus Afrika stammt?“, fragt Schlesinger. Zu den Pointen der neuen kompensatorischen Rassenlehre gehört es, dass sowohl Ostasien als auch die ostasiatischen Einwanderer aus dem Bild geschnitten werden müssen: Erstens darf der Weltteil kulturell nichts zur Menschheitsgeschichte beigetragen haben, wenn alle wesentlichen Erfindungen aus Afrika stammen sollen. Und zweitens stört der unübersehbare akademische und wirtschaftliche Erfolg der Amerikaner mit ostasiatischen Wurzeln die These von der weißen Unterdrückung aller Nichtweißen erheblich. Auch die innerafrikanische (und muslimische) Sklaverei muss natürlich aus dem neuen Weltgeschichtsentwurf verschwinden. „Geschichtsschreibung als Therapie zu verwenden bedeute, die Geschichtsschreibung als solche zu korrumpieren“, urteilt Schlesinger. Der „Ethnizitätswahn“, so der Autor, sei eben keine Heilung, er verschärfe die Probleme noch, indem er behauptet, reale soziale Fragen mit scholastischer Quacksalberei, Geschichtsfälschung und Rassentheorie lösen zu können.
Schlesinger beschreibt, wie die neue Ideologie trotz ihrer intellektuellen Dürftigkeit schon in den Neunzigern die Universitäten erobert, die Schullehrpläne okkupiert – vor allem in stark demokratisch dominierten Städten wie New York oder Portland – und wie sie von dort aus in die Gesellschaft vordringt. Und wie diese Lehre ziemlich schnell ihre Mutationen hervorbrachte – etwa den „Ableismus“, also die angebliche Unterdrückung von Behinderten durch die zu starke Dominanz Nichtbehinderter, oder den „Heterosexismus“, der alle Nichtheterosexuellen zu strukturell Unterdrückten erklärt und künstlich ethnifizierte.
Auch das entsprechende Denunziationsklima in der akademischen Welt gegen alle, die sich der neuen Lehre nicht unterwerfen wollten, Kritik anmeldeten, oder, noch viel schlimmer, darüber spotteten, war in den Neunzigern schon weit ausgebildet. Diese Praxis, schreibt Schlesinger, erinnere ihn „an jene rechtsgerichteten Studenten, die in den Tagen Joe McCarthys bei liberalen Harvard-Professoren (wie mir) die Unterrichtsräume heimzusuchen pflegten in der Hoffnung, ein Büchlein von Marxismus vom Katheder herab erschnuppern zu können.“ Der Begriff „Hassrede“ zur argumentfreien Denunziation aller missliebigen Äußerungen war ebenfalls schon etabliert, als Schlesinger „Die Spaltung Amerikas“ verfasste. Darin besteht die gar nicht zu unterschätzende Lehre dieses Buchs, das mit über zwanzig Jahren Verspätung auf Deutsch vorliegt: Kein Begriff und keine Argumentationskette der Identitätspolitik ist neu. Ihre Wurzeln liegen in den siebziger Jahren, voll ausgebildet fand der Autor die Ideologie samt ihren Ablegern schon Ende der Neunziger vor. Schon gar nicht stellen Identitätspolitik und seine Speerspitze Black Lives Matter eine Reaktion auf Donald Trump oder ein Einzelereignis wie den Tod von George Floyd dar. Die Identitätspolitik findet ihre stärksten Unterstützer nicht etwa in den Gruppen, denen sie angeblich zugutekommen soll. Sondern in einer politisch-medialen Elite, die mit dieser Orthodoxie ein Machtmittel in die Hand bekommen hat, das Eingriffe in die gesamte Gesellschaft rechtfertigt, und es außerdem erlaubt, jeden, der etwas dagegen einwendet, zumindest als strukturellen Rassisten zu brandmarken. Es handelt sich, wie der von Schlesinger zitierte Gunnar Myrdal schon bemerkenswert früh erkannte, bei der „Begierde nach ‚geschichtlicher Identität“ nicht um eine Bewegung von unten, sondern um einen „intellektuellen Oberklassen-Romantizismus“.
An einer Stelle zitiert Schlesinger auch Theodore Roosevelt: „Der einzige absolut sichere Weg, diese Nation zu ruinieren, bestünde darin, es zuzulassen, dass sie zu einem unentwirrbaren Knäuel sich zankender Nationalitäten wird“ – um hinzuzufügen: „was für Roosevelt ein Alptraum war, (ist) heute der Traum der multikulturellen Ideologen“.
Anders als bei dem amerikanischen Bürgerkrieg zeichnet sich nicht nur kein Ende ab. Es stellt sich auch die Frage, wer eigentlich in den USA und den anderen Ländern, in denen der Kulturkrieg geführt wird, irgendwann siegen soll, und was ein Sieger, wer auch immer es ist, dann mit der gründlich verbrannten Erde anfängt.
Das Buch gibt auf seinen gut 180 Seiten auch indirekt eine Antwort darauf, wie eine quasireligiöse Erlösungslehre von den Universitäten über die Schulen, in die Medien und schließlich in die Demokratische Partei überspringen konnte, und warum sich dieser Prozess bis ins Detail nur leicht zeitversetzt in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und eigentlich überall im Westen mit der gleichen Durchschlagskraft wiederholen konnte: Weil ihn zu viele am Beginn nicht ernst genug nahmen, und sich dann, als er seine destruktive Kraft entfaltete, sich nicht mehr trauten, ihm etwas entgegenzusetzen. Schlesinger traute sich. Aber auch er unterschätzte die Wucht dieser Ideologie – und das Phänomen, dass seine Ideologen sich in ihrem Missionseifer durch den wachsenden Widerstand nie gebremst, sondern bis heute immer nur bestätigt und immer neu gerechtfertigt fühlen.
„Die Situation an unseren Universitäten“, glaubte Schlesinger 1998, „wird sich bald von selbst berichtigen, sobald die große schweigende Mehrheit der Professoren ‚Genug‘ ruft und all das anficht, von dem sie weiß, dass es ein zeitgeistiges Geschwätz ist.“
Auch Ende 2021 tut das nur eine winzige Minderheit unter den Akademikern – während eine deutlich größere Gruppe schweigt, und eine Avantgarde ‘noch mehr‘ ruft.
Arthur M. Schlesinger „Die Spaltung Amerikas. Überlegungen zu einer multikulturellen Gesellschaft“. Deutsch von Paul Nellen, mit einem Vorwort von Sandra Kostner, ibidem, 180 Seiten, 22 Euro (Paperback), E-Book 9,99 Euro
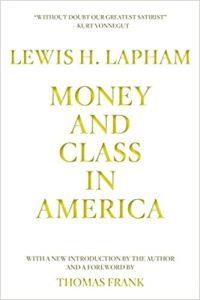
Die Goldene Horde
Lewis H. Lapham schreibt so scharfsinnig wie kein anderer amerikanischer Autor über die Verknüpfung von Geld und Transzendenz in der amerikanischen Kultur. Leider gibt es immer noch keine deutsche Übersetzung
In der kleinen hier vorgestellten Serie wieder aufgelegter Bücher ist Lewis H. Laphams „Money and Class in America“ das älteste: zum ersten Mal erschien es 1988, in der Ära von Ronald Reagan (und Gordon Gekko). Lapham brachte es mit einem neuen Vorwort 2018 noch einmal heraus – und es erweist sich als frisch, sogar verjüngt, auch ein wenig kostbarer als damals. Denn so elegant, mit Witz und einem Henry-James-ähnlichen Scharfblick für den inneren Gesellschaftsaufbau wie der heute 86-jährige Autor schreiben heute nur noch sehr, sehr wenige, egal in welcher Sprache.
Wer den ehemaligen Herausgeber von „Harpers“ und Gründer von „Laphams Quarterly“ ein wenig kennt, der ahnt schon, dass er in seinem Buch keine Lust verspürt, den Materialismus und die Gier seiner Landsleute zu geißeln. Lapham stammt selbst aus der „Equestrian Class“ wie er es nennt, aus jener Schicht, in der sich Leute selbst nie als ’reich’ bezeichnen, sondern allenfalls als ’affluent‘. Wären Amerikaner einfach nur so materialistisch, wie es Nichtamerikaner gern unterstellen, schreibt er, dann würden sich die Behausungen der wohlhabenden New Yorker wahrscheinlich zum Wasser hin öffnen, und das Essen in den Restaurants wäre besser, kurzum, reiner Genuss würde eine größere Rolle spielen. Was ihn interessiere, sei nicht so sehr Eitelkeit und Gier, „sondern der Platz des Geldes in der amerikanischen Vorstellungswelt“. Für sehr viele Amerikaner, schreibt der Autor, besitzt Geld eine transzendente, die Richtigkeit des eigenes Lebensentwurfs rechtfertigende Kraft. Darin ähneln viele Reiche dieses Landes, in dem immer noch mehr Millionäre und Milliardäre leben als in jedem anderen Staat der Welt, eher holländischen Calvinisten als italienischen oder französischen Renaissancefürsten. Und gerade die calvinistische Variante des Reichtums braucht die Rückspiegelung durch die „Gesellschaft der Erwählten“ (Calvin) dringender als der, der einfach nur konsumiert. Einer der schönen Lapham-Sätze lautet: „A Frenchman can afford to be interested in a truffle rather than in what the truffle means“.
In dem Buch finden sich nicht nur brillante Beobachtungen aus dem Inneren der amerikanischen Gesellschaft – über weite Strecken klingt es, als verrate Lapham Betriebsgeheimnisse eines Landes – sondern auch oft genug das Gegenstück, der europäische Umgang mit Geld und Reichtum. Kaum ein amerikanischer Autor kennt die Vereinigten Staaten und gleichzeitig Europas Geschichte so gut wie er (wovon sich der Leser von „Laphams Quaterly“ vier Mal im Jahr überzeugen kann).
Vielleicht findet das neu erschienene Buch den einen oder anderen neuen Leser. Und das Werk selbst endlich seinen deutschen Verleger.
Lewis H. Lapham „Money an Class in America”, OR Books, 352 Seiten, E-Book 8,24 Euro
Unterstützen Sie Publico
Publico ist werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Mit Ihrem Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Danke!
Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl auf ein Konto überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punkt Über.











Libkon
18. Dezember, 2021“Money and Class in America” enthält ein Vorwort von Thomas Frank. Frank schrieb vor Jahren ein Buch, worin er sein Unverständnis beklagte, dass republikanische Wähler ständig die Konservativen wählen würden, ohne, dass sie davon einen klaren Vorteil hätten (What´s The Matter With Kansas?).
Die gleiche Frage stellt sich jetzt: Was ist los mit den Linken in den USA? Wieso wählen sie Biden, der sich als nicht gut für die Wirtschaft und den Zusammenhalt im Lande herausgestellt hat? Wie kann man jemanden wählen, der so gut wie keinen Wahlkampf geführt hat? Welchen konkreten Nutzen haben die Wähler von Links davon? Schürt die Demokratisch/Sozialistische Partei nicht die Spaltung in Schwarz/Weiß? Galloppiert nicht die Inflation? Wird von den Linken nicht die Rassentrennung bewusst (wieder) eingeführt? Wo ist Thomas Frank, wenn man ihn braucht?
Axel Gerold
18. Dezember, 2021ZVAB-Fundstelle: The Disuniting of America: Reflections on a Multicultural Society
Arthur M. Schlesinger
454 Bewertungen bei Goodreads
ISBN 10: 0393033805 / ISBN 13: 9780393033809
Verlag: W W Norton & Co Inc, 1992
Geschrieben 1991, also sogar nahezu ein Jahrzehnt früher, vor 30 Jahren!
A. Iehsenhain
19. Dezember, 2021Guten Abend, Herr Wendt! Schön, wieder etwas von Ihnen zu lesen! Ich hoffe, Sie erholen sich weiterhin gut! Den “Merkel-Zapfenstreich” habe ich schon mit Genuss gelesen, aber auch die hiesiegen Empfehlungen wecken hoffentlich allgemein ein reges Interesse. Ich fand die Beschreibung von Schlesingers Buch elektrisierend, ein Name, den ich auf jeden Fall in meiner Liste notieren muss. Besten Dank und viele Grüße – A. Iehsenhain.
Thomas Schweighäuser
20. Dezember, 2021Ich weiß gar nicht, wem ich den Preis fürs schiefere Bild lieber überreichen würde, der Frau Maron (“Der Ort war öde wie eine Goldgräberstadt, deren Schätze erschöpft waren.”) oder dem Herrn Wendt (“Begründungsapparate, die wie ein Perpetuum mobile immer weiter klappern, obwohl ihnen keine Energie mehr zufließt”). Vielleicht können sich beide darauf einigen, den Preis zu teilen?
Publico
20. Dezember, 2021Wenn Sie begründen, warum es sich um schiefe Bilder handeln soll, können Sie den Preis gern zu gleichen Teilen vergeben.
-Redaktion
Thomas
22. Dezember, 2021Danke für diese Buchempfehlungen.
Wer nach Gründen sucht, der wird in guten Büchern fündig. Etwas redlich zu begründen, ist der Grund eines redlichen Buches.
Es geht auch anders. Wozu begründen, es geht doch auch so? In den Schrottbüchern ist das heute sogar modern? Wo kommt so etwas her? Nun, anything goes. „Ich weiß gar nicht, wem ich den Preis fürs schiefere Bild lieber überreichen würde, der Frau … (usw.)“
Gründe?
Nun, wer Spekulationen darüber anstellt, was „Schauspieler:innen“ der Aktion #allesdichtmachen über Folgen der Covid-19-Erkrankung denken (6. Mai, 2021) oder welche „Pegida-Märsche und Querdenkerdemos“ der Herr Zeller besucht (18. Mai, 2021) oder wer von „rassistischen Entgleisungen“ des hellgrünen Herrn Palmer erzählt (11. Mai, 2021), der will seinen Preis fürs schiefere Bild wohl zu Recht überreichen – diese Auszeichnung bleibt aber besser dort, wo sie hingehört.